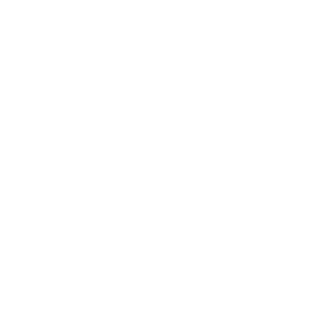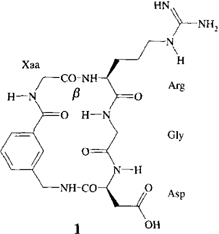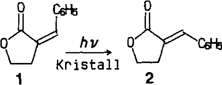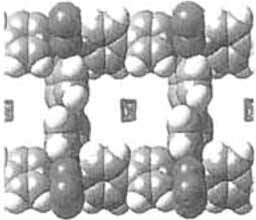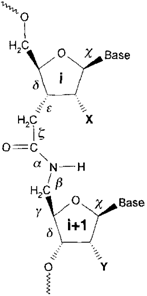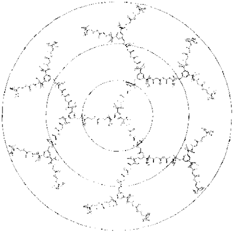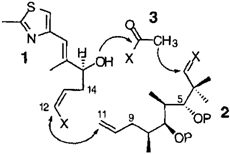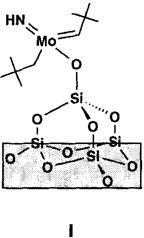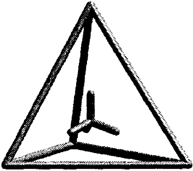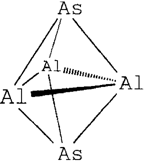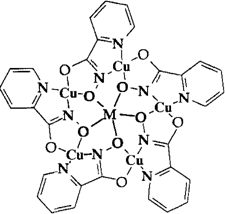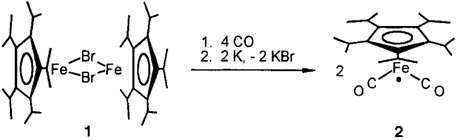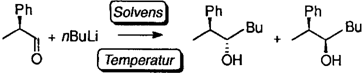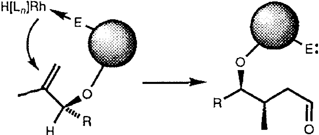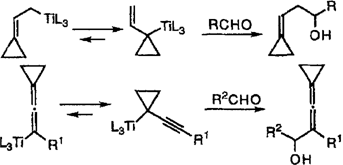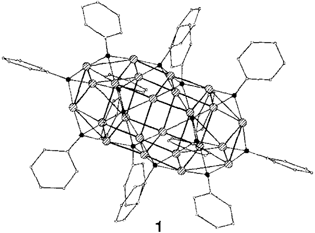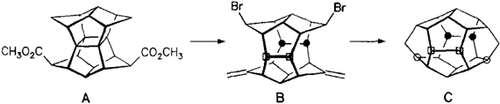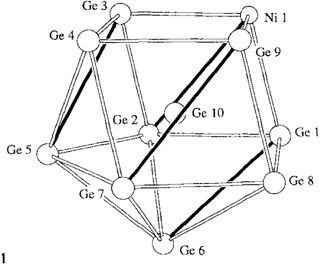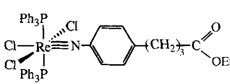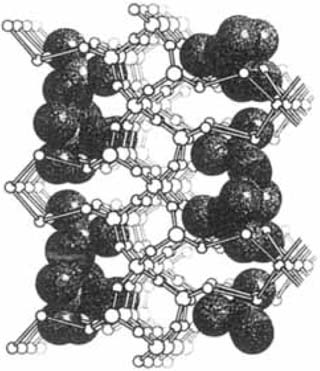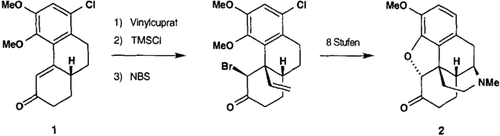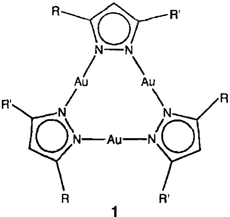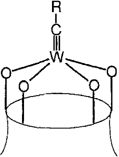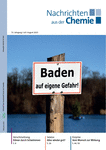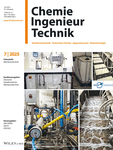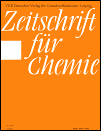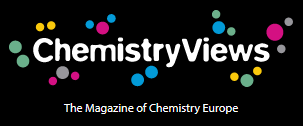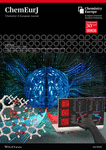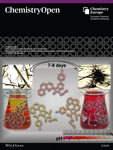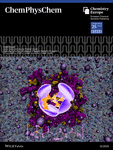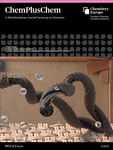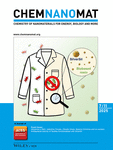Journal list menu
Export Citations
Download PDFs
Titelbild
Impressum
Graphisches Inhaltsverzeichnis
Aufsätze
Die Selbstregeneration von Stereozentren (SRS) — Anwendungen, Grenzen und Preisgabe eines Syntheseprinzips
- Pages: 2881-2921
- First Published: 16. Dezember 1996
Die Synthese enantiomerenreiner Verbindungen ausgehend von achiralen Vorläufern ist heute wohl eine der größten Herausforderungen an die organische Synthese. Ein möglicher Weg, dieses Ziel zu erreichen, findet seinen Ursprung in Untersuchungen über die „Selbstregeneration von Stereozentren”︁ (SRS). Dieses Syntheseprinzip wurde mit Verbindungen realisiert, die ein Chiralitätszentrum aufweisen, z. B. die natürlich vorkommenden enantiomerenreinen Aminosäuren. In neuerer Zeit wurden die Erkenntnisse auch auf achirale Verbindungen wie Glycin, 3-Aminopropionsäure und Acetessigsäure ausgedehnt. Die Methoden haben breite Anwendung in der Synthese von nichtproteinogenen und von radioaktiv markierten Aminosäuren gefunden und sind besonders zur Synthese von Naturstoffen mit tertiären C-Atomen von großem Nutzen.
Erich Hückel – Pionier der Organischen Quantenchemie: Leben, Wirken und späte Anerkennung
- Pages: 2922-2937
- First Published: 16. Dezember 1996
Rückblickend schwer verständlich ist, wie die Chemikerwelt auf die Theorie zur Aromatizität und Antiaromatizität von Erich Hückel ursprünglich reagiert hat. Die Entwicklungen nachzuzeichnen, Gründe für die mangelnde Akzeptanz aufzuzeigen und moderne Bestätigungen der breiten Gültigkeit der Theorie trotz ihrer erheblichen Vereinfachungen vorzustellen sind die Ziele dieser Übersicht.
Highlights
Neue Carbokationen – von der physikalisch-organischen Chemie zur Biochemie†
- Pages: 2939-2940
- First Published: 16. Dezember 1996
Im ersten Carbotetrakation, 1, sind die geladenen Gruppen an einem Adamantangerüst tetraedrisch angeordnet. Carbokationen sind längst nicht mehr nur eine Domäne der physikalisch-organischen Chemie, sie spielen auch eine Rolle in der metallorganischen Chemie und in der Biochemie, wie ein Samarocenkomplex mit einem Norbornadienylkation-Fragment und der Begriff „Olah-Enzym”︁ zeigen.
Die β-Schleife als Selektivitätsschalter: βI oder βII′? – Das ist hier die Frage†
- Pages: 2941-2943
- First Published: 16. Dezember 1996
Die β-Schleife avancierte in den letzten Jahren zum Designprinzip in der Peptid-basierenden Wirkstofforschung. Aus dem Gebiet der antiadhäsiven RGD-Mimetica wurde jüngst berichtet, daß in cyclischen Pentapeptiden 1 mit gleicher Leitsequenz die Rezeptorselektivität im Typ der β-Schleife kodiert ist. Dabei invertiert der Wechsel im Schleifentyp von βII′ nach βI das Selektivitätsprofil einer ursprünglich antithrombotisch wirkenden zu einer antimetastatischen Verbindung.
Zuschriften
Präzedenzlose Umwandlung einer Verbindung mit Metall-Metall-Bindung in einen solvatisierten molekularen Draht†
- Pages: 2946-2948
- First Published: 16. Dezember 1996
Durch die Einelektronenreduktion des Rhodiumkomplexes 1 gelang es erstmals, ein „Dimer”︁ mit Metall-Metall-Bindung in ein 1D-Polymer (eine Ansicht ist rechts gezeigt) zu überführen. Als dessen Formel ergab sich 2, das erste derartige Polymer mit kationischem statt anionischem Gerüst. Zudem eröffnet sich hier die Möglichkeit, durch Variation des organischen Restes eine Feinabstimmung von Materialeigenschaften vorzunehmen.
E/Z-Isomerisierung in Kristallen – Phasenumbildung bei der Photolyse mit langwelliger Strahlung†
- Pages: 2948-2951
- First Published: 16. Dezember 1996
Drei Festkörpertechniken wurden kombiniert, um (E)/(Z)-Isomerisierungen im Kristall, z.B. 1→ 2, trotz ihres raumgreifenden Charakters möglich sind: Kraftmikroskopie (AFM), herauszufinden, warum Röntgenstrukturanalyse und diffuse Reflexionsspektroskopie. Dabei zeigte sich unter anderem, daß auch bei Einstrahlung in die Endabsorption der Kristalle Oberflächenstrukturen gebildet werden.
Gezielte Strukturierung von Iod mit mikroporösem SiO2†
- Pages: 2951-2953
- First Published: 16. Dezember 1996
Als Schablonen für die Anordnung yon Gastmolekülen dienen die Hohlraumstrukturen mikroporöser SiO2-Phasen. Über die Dimensionalitäten der Hohlraumstrukturen lassen sich die Wechselwirkungen zwischen den Gastmolekülen gezielt steuern. Im Falle von Iod als Gastkomponente läßt sich dies an der Farbe der Insertionsverbindungen erkennen, die für die unten gezeigten Wirtsysteme von violett bis rotbraun variiert.
Bindung von Anionen: Selbstorganisation von Polypyrrolmakrocyclen†
- Pages: 2954-2957
- First Published: 16. Dezember 1996
Aufgrund der Fähigkeit, Anionen zu koordinieren, kommt es zur Selbstorganisation der carboxylatsubstituierten polypyrrolischen Makrocyclen Sapphyrin und Calix[4]pyrrol (siehe schematische Darstellung rechts). Erst durch Zusatz von F–(Sapphyrin) oder polaren Lösungsmitteln (Calix[4]pyrrol) werden die Dimere aufgebrochen.
Eine nicht selbstdurchdrungene molekulare Leiter mit hydrophoben Hohlräumen†
- Pages: 2957-2960
- First Published: 16. Dezember 1996
Ausnahmsweise nicht selbstdurchdrungen, sondern mit Solvensmolekülen gefüllt sind die großen Hohlräume des Polymers [Co(NO3)2(4,4′-bpy)1,5]n, dessen Struktur vom Lösungsmittelsystem, aus dem es kristallisiert, abhängig ist. Eine der beiden möglichen Strukturen (Ausschnitt im Bild rechts) weist hydrophobe, ca. 11 × 11 Å große Öffnungen auf. Die Solvensmoleküle lassen sich entfernen, es ist aber noch nicht geklärt, ob dieser Prozeß auch umkehrbar ist.
Stark erhöhte Affinität modifizierter Oligonucleotide mit in ihrer Konformation eingeschränkten Furanose-Ringen für komplementäre RNA-Stränge†
- Pages: 2960-2964
- First Published: 16. Dezember 1996
Eine erhöhte Stabilität von Duplices zwischen amidmodifizierten Oligonucleotiden (siehe rechts) und RNA wird durch Einführen von 2′-OMe-Gruppen erreicht. Da die modifizierten Oligonucleotide eine sehr hohe Affinität zur komplementären RNA aufweisen und erheblich stabiler gegenüber Nucleasen sind, konnten sie als Antisense-Reagentien verwendet werden. × = H, OH, OMe; Y = H, OMe.
In-situ-Nachweis transienter Phänomene bei Reaktionen an Zeolithkatalysatoren mit Hilfe der Positronenemission
- Pages: 2964-2966
- First Published: 16. Dezember 1996
Reaktanten- und Produktkonzentrationen in einem Durchflußreaktor direkt zu bestimmen gelingt mit der hier vorgestellten Technik, die auf der Messung der beim Positronenzerfall von 11C gebildeten γ-Photonen beruht. Dies wird an der technisch sehr wichtigen Hydroisomerisierung von n-Hexan an einem Pt/H-Mordenit-Katalysator gezeigt. Dabei konnte unter anderem geklärt werden, welche Prozesse bei der Vorkonditionierung des Platins und bei der Katalysatordesaktivierung ablaufen.
Die Titan(IV)-katalysierte Epoxidierung von Alkenen durch tert-Alkylhydroperoxide†
- Pages: 2966-2969
- First Published: 16. Dezember 1996
Hochaktiv katalysiert werden Alken-Epoxidierungen durch Titan-modifizierte mesoporöse MCM41-Kieselgele, wenn 2-Methyl-1-phenyl-2-propylhydroperoxid (MPPH) als Oxidationsmittel eingesetzt wird. Dies ist das erste Mal, daß MPPH als effektives Zwei-Elektronen-Oxidationsmittel genutzt wurde, was beweist, daß es sich als Ersatz für tert-Butylhydroperoxid in Metall-katalysierten Kohlenwasserstoff-Oxidationen, die nicht über Radikale verlaufen, eignet und daß Ti-MCM41-katalysierte Alken-Epoxidierungen ohne Radikalbeteiligung verlaufen.
Synthese und enzymatischer Abbau von Dendrimeren aus (R)-3-Hydroxybuttersäure und Trimesinsäure†
- Pages: 2969-2972
- First Published: 16. Dezember 1996
Synthese und DNA-Bindungseigenschaften von Hybriden aus der Kohlenhydrat-Einheit von Calicheamicin γ1I und den Aglycon von Daunorubicin: Calichearubicine A und B†
- Pages: 2972-2975
- First Published: 16. Dezember 1996
Im Calichearubicin B (rechts) sind das Aglycon von Daunorubicin und die Kohlenhydrat-Einheit von Calicheamicin γ11: durch einen Spacer verknüpft (im Calichearubicin A fehlt dieser Spacer). Das Aglycon fungiert als anthracyclinähnlicher Intercalator, während die Kohlenhydrat-Domäne an die kleine Furche der DNA bindet. Damit weist Calichearubicin B Eigenschaften beider Stammverbindungen auf.
Totalsynthese von (—)-Epothilon A†
- Pages: 2976-2978
- First Published: 16. Dezember 1996
In Rekordzeit gelang die Totalsynthese des cytotoxischen Epothilons A, dessen genaue Struktur erst im Juli – ebenfalls in der Angewandten Chemie – publiziert wurde. Die wegen ihrer biologischen Wirksamkeit begehrte Verbindung wird aus den Bausteinen 1, 2 und 3 aufgebaut. Schlüsselschritt ist eine beachtenswerte Makroaldolkondensation, die den Ringschluß zum Makrolid ermöglicht.
Ein molekular definierter, oberflächengebundener Katalysator zur Olefin-Metathese aus Tris(neopentyl)nitridomolybdän(VI)†
- Pages: 2978-2980
- First Published: 16. Dezember 1996
Durch 1,2-Addition von SOH-Gruppen auf SO2-Oberflächen an die MoN-Gruppe der Titelverbindung und anschließende α-Eliminierung von Neopentan bildet sich die katalytisch aktive Oberflächenverbindung I. Dies ist der erste Fall, bei dem ein alkylierter Komplex die Heterogenisierung in molekular klar definierter Weise durchläuft. Der immobilisierte Katalysator 1 ist in Ringöffnungs-Metathesepolymerisationen wesentlich aktiver als der molekulare Vorläufer.
Chirale Heterocyclencarbene in der asymmetrischen Homogenkatalyse†
- Pages: 2980-2982
- First Published: 16. Dezember 1996
Die ee-Werte der Hydrosilylierung von Acetophenon mit dem Rhodiumkatalysator 1 sind zwar nicht hoch, dafür ist die Stabilität des Katalysators beeindruckend : Der gut verfügbare und leicht variierbare chirale Carbenligand bleibt in Lösung bis über 100°C am Metall gebunden, so daß auch keine Ligandenüberschüsse bei den katalytischen Reaktionen nötig sind.
Supramolekulare Wirt-Gast-Verbindungen mit Tripod-Metall-Templaten als Eckbausteinen†
- Pages: 2983-2984
- First Published: 16. Dezember 1996
In einer Eintopfreaktion bildet sich aus 15 Komponenten durch Selbstorganisation eine tetraedrische Wirt-Gast-Verbindung. Die Eckpunkte des Tetraeders (siehe rechts) bilden Tripod-Eisen(II)-Gruppen, die Kanten sind durch 1,2-Dinitril-Liganden überbrückt, im tetraedrischen Hohlraum ist ein BF4−-Ion eingebaut.
Ca2+-Ionen als Cofaktoren für ein neuartiges RNA-spaltendes Desoxyribozym†
- Pages: 2984-2988
- First Published: 16. Dezember 1996
Bei In-vitro-Selektionsexperimenten wurde ein unerwartetes, aber nichtsdestoweniger interessantes Resultat erhalten. Ein RNA-spaltendes DNA-Enzym, das in Gegenwart von Mg2+ selektiert worden war, wies mit Ca2+ als Cofaktor eine wesentlich höhere Effizienz auf. Dies ist wegen der geringeren hydrolytischen Wirksamkeit von Ca2+ um so überraschender.
Der erste stabile Kupfer(III)-Komplex mit aliphatischen Thiolaten als Liganden: struktureller und spektroskopischer Nachweis von CuII- und CuIII-Ionen in Komplexen mit quadratisch-planaren CuN2S2-Koordinationssphären†
- Pages: 2989-2991
- First Published: 16. Dezember 1996
Als nahezu unmöglich wurde die Synthese authentischer CuII- und insbesondere CuIII-Komplexe mit aliphatischen Thiolaten in der Koordinationssphäre betrachtet, da im allgemeinen CuII-Zentren leicht durch Thiolate reduziert werden. Dieses Ziel ist nun mit der Darstellung der quadratisch-planaren Komplexe (NEt4)2[Cu(phmi)]· H2O und (PPh4-[Cu(phmi)] (Formel der Anionen rechts, n = 1, 2) erreicht worden. Die Oxidationszustände dieser beiden äußerst ungewöhnlichen Verbindungen mit dem niedrigsten Redoxpotential für ein CuIII/CuII-Redoxpaar, sind eindeutig bestimmt worden.
Osmiumkatalysierte asymmetrische Aminohydroxylierung: kleinere Substituenten am Stickstoffatom erleichtern die Reaktion†
- Pages: 2991-2995
- First Published: 16. Dezember 1996
Alle Selektivitätskriterien der katalytischen asymmetrischen Aminohydroxylierung mit Sulfonamiden [GI. (a)] werden verbessert, wenn statt des ursprünglich für diese Reaktionen verwendeten Chloramin-T dessen Methyl-Analogon Chloramin-M 1 eingesetzt wird. Dieses neu eingeführte Reagens weist eine deutlich höhere Ligandenabhängigkeit auf, und für die meisten Substrate tritt das erwünschte Phänomen der ligandenbeschleunigten Katalyse auf. DHQ-H = Dihydrochinin, PHAL = 1,3-Phthalazindiyl.
Erhöhung der Effizienz der katalytischen asymmetrischen Aminohydroxylierung durch N-Halogencarbamat-Salze†‡
- Pages: 2995-2999
- First Published: 16. Dezember 1996
Bessere Enantioselektivitäten und einfache Entschützung machen Natrium-N-chlorcarbamate zu den Oxidantien/Stickstoffquellen der Wahl für die Osmium-China-Alkaloid-katalysierte asymmetrische Aminohydroxylierung von Olefinen [siehe z.B. Gl. (a)]. Diese Methode ermöglicht einen einfachen Zugang zu einer Vielzahl von Verbindungen wie nichtnatürlichen Aminosäuren und anderen pharmakologisch wichtigen Substanzen. DHQ-H = Dihydrochinin, PHAL = 1,3-Phthalazindiyl, Z = Benzyloxycarbonyl.
Te6, [Te8Cl18]2− und [TeCl3]−: Neue Tellur-und Chlorotellurato-Liganden in den Re6-Clusterverbindungen Re6Te16Cl18 und Re6Te16Cl6†
- Pages: 2999-3001
- First Published: 16. Dezember 1996
Re6-Oktaeder in Te8-Würfeln enthalten beide Titel-verbindungen als gemeinsames Strukturelement. Im Bild rechts sieht man einen Strukturausschnitt von Re6Te16Cl18, in dem das Re6-Oktaeder und die Bindung des Clusters an den [Te8Cl18]2−-Liganden gut zu erkennen sind. Doch unterschiedliche Verknüpfungen zu den Liganden bedingen bei Re6Te16Cl18 eine dreidimensionale Struktur, wahrend die von Re6Te16Cl6, zweidimensional ist.
Erkennung der Gängigkeit von Polypeptidhelices durch einen chiralen Metalloporphyrinrezeptor†
- Pages: 3001-3003
- First Published: 16. Dezember 1996
Die Sekundärstruktur ist von zentraler Bedeutung! Die D- und L-Formen von α-helicaler Poly(glutaminsäure) und (PGA) werden selektiv durch das (R)- bzw. (S)-Isomer des chiralen Rezeptors 1, der einen Porphyrinrest eine Xylylendiaminbrücke ent-hält, komplexiert. Enantiomerenreines 1 kann somit zur Trennung von Gemischen links- und rechtsgängiger helicaler Polypeptide eingesetzt werden.
As2(AlCp*)3 — eine Verbindung mit polyedrischem As2Al3-Gerüst†
- Pages: 3003-3005
- First Published: 16. Dezember 1996
Die Bindungsverhältnisse heteropolyedrischer Verbindungen vom closo-Boran-Typ werden am Beispiel des As, (AlCp*)3-Clusters, dessen Molekülstruktur durch Röntgenbeugung charakterisiert wurde, diskutiert (Gerüst siehe rechts). Anhand quantenchemischer Rechnungen für einige trigonal-bipyramidale E2VEIII3-Grundkörper wurden unter Berücksichtigung mehrerer Liganden die Bindungsverhältnisse studiert (Cp* = C5Me5 EIII: Element der 3. Hauptgruppe, EV: Element der 5. Hauptgruppe).
Das erste über Sulfoniumgruppen gebundene Phenylenpolymer†
- Pages: 3005-3008
- First Published: 16. Dezember 1996
Alternierend aus einem Phenylenring und einer Methylsulfoniumgruppe aufgebaut ist das Polymer 1, das durch Polymerisation von Benzol mit Natriummethansulfinat entsteht. Die Reaktion wird in Trifluormethansulfonsäure durchgeführt. Statt Benzol können auch Xylol und Diphenylether als Monomere eingesetzt werden.
Theoretische Untersuchungen schließen eine [2 + 2]-Addition als einleitenden Schritt der Osmiumtetroxid-katalysierten Dihydroxylierung von Alkenen aus†
- Pages: 3008-3011
- First Published: 16. Dezember 1996
Um mindestens 35 kcal mol−1 unterscheiden sich nach aufwendigen ab-initio-Rechnungen die Aktivierungsbarrieren für die [2+2]- und die [3+2]-Addition von OsO4 an Ethylen (rechts sind die Strukturen der beiden Übergangszustände angegeben). Die relativen Barrieren der konkurrierenden Reaktionspfade und damit die Bevorzugung des [3+2]-Mechanismus verändern sich auch in Gegenwart von NH3 zum Modellieren der basenkatalysierten Reaktion nur unwesentlich. Damit stehen die theoretischen Befunde zum Mechanismus der asymmetrischen Dihydroxylierung im Widerspruch zu den Schlüssen aus kinetischen Studien von Sharpless, während sie die von Corey stützen.
Eine planare [15]-Metallakrone-5 zur selektiven Bindung von Uranyl-Ionen
- Pages: 3011-3013
- First Published: 16. Dezember 1996
Molekulare Erkennung mit vielzähnigen Liganden: Eine neuartige „Kupferkrone”︁ komplexiert, wie Konkurrenzexperimente mit Ca2+ und Cu2+ ergaben, bevorzugt UO2−2 (Bild rechts, M = UO2+2), Komplexierung von Actinoiden und Lanthanoiden durch expandierte Porphyrine macht. was diesen Liganden zu einer Alternative für die
Synthese und Charakterisierung des stabilen Dicarbonyl(cyclopentadienyl)eisen-Radikals [(C5R5)Fe(CO)2]⋅ (R = CHMe2)†
- Pages: 3013-3016
- First Published: 16. Dezember 1996
Diasteroselektive Addition von n-Butyllithium an 2-Phenylpropanal – Lösungsmittel- und Temperatureinflüsse: eine neue Beurteilung†
- Pages: 3016-3019
- First Published: 16. Dezember 1996
Enorm beeinflußt wird die Diastereoseitenselektivität der nucleophilen Addition von n-Butyllithium an 2-Phenylpropanal [Gl. (a)] durch die Lange des als Lösungsmittel verwendeten aliphatischen Kohlenwasserstoffs. Die Reaktionen in diesen Solventien weisen alle Inversionstemperaturen auf, die mit den Schmelzpunkten der Lösungs-mittel in Beziehung stehen.
Aggregatbildung durch Zink-Chlorine in unpolarer Lösung — Bacteriochlorophyll-c-Modellverbindungen mit vertauschten Hydroxy- und Carbonylfunktionen†
- Pages: 3019-3021
- First Published: 16. Dezember 1996
Die Selbstorganisation funktionell „invertierter”︁ Zink-Chlorine - in welchen die für die Aggregation der Bacteriochlorophylle c, d und e funktionell unverzichtbaren 31-Hydroxy- und 131-Carbonylgruppen vertauscht worden sind - ist in unpolaren Lösungsmitteln möglich (siehe schematische Darstellung unten). Dieses Resultat zeigt die Strukturvoraussetzungen für die Bildung großer Aggregate auf, die in ähnlicher Form auch bei den Bacteriochlorophyllen in vitro und in Lichtsammelantennen-Systemen von Photosynthese-Bakterien vorliegen.
Substratdirigierte, diastereoselektive Hydroformylierung von Methallylalkoholen†
- Pages: 3021-3023
- First Published: 16. Dezember 1996
Mit einer reversibel koordinierenden Hilfsgruppe gelingt erstmals eine hoch diastereoselektive Hydroformylierung von acyclischen Methallyl-alkoholen (siehe rechts, syn-anti-Verhältnis bis zu 96:4, Hilfsgruppe als Kugel dargestellt). Die Reaktion läßt sich zum Aufbau von Stereotriaden, einem zentralen Strukturinkrement polyketider Naturstoffe, nutzen. R beispielsweise Ph, CO2Me, Me, CH2Ph.
Ungewöhnliche Regioselektivitäten bei der Reaktion von Carbonyl- mit Allyl- oder Allenyl/Propargyltitanverbindungen: ein effizienter Zugang zu Alkylidencyclopropanderivaten
- Pages: 3024-3025
- First Published: 16. Dezember 1996
Sterische Spannungen verschieben Gleichgewichtslage bei Allyl- oder Allenyltitanverbindungen, die Cyclopropylreste enthalten, hin zu den isomeren Vinyl- bzw. Propargylcyclopropanen. Dies führt zu einer ungewöhnlichen Regioselektivität bei der Addition an elektrophile Carbonyle und eröffnet so einen einfachen Zugang zu synthetisch wertvollen Alkylidencyclopropanen (siehe rechts).
Neue imidoverbrückte Übergangsmetallcluster – Synthesen und Strukturen von [Cp4Ti4(NSnMe3)4], [Co11(PPh3)3(NPh)12], [Ni11Br6(NtBu)8] und [Li(thf)4]4[Cu24(NPh)14]†
- Pages: 3025-3028
- First Published: 16. Dezember 1996
Von Pagodanen zu nichtpentagonalen (Homo)Dodecahedranen – der Undecacyclo[10. 10.10.0.02, 20.03, 10.04, 19.05, 9.− 06, 18.07, 15.08, 13.019, 22.016, 21]docosan-Käfig†
- Pages: 3029-3031
- First Published: 16. Dezember 1996
Durch zweifache, transanulare Cyclisierung der aus dem Pagodandiester A erhältlichen Bis(methylen)bisseco-Intermediate B sind das nichtpentagonale Bis(homo)-dodecahedran C und paarweise symmetrisch funktionalisierte Derivate zugänglich. Einige dieser Produkte sind für die Quantifizierung der für die transanularen elektronischen Wechselwirkungen in Käfigstrukturen dieses Typs maßgebenden Faktoren wichtige Modellverbindungen mit definierten Dimensionen.
Synthese und Struktur des metallierten Zintl-Ions [Ge9(μ10-Ge)Ni(PPh3)]2−
- Pages: 3032-3033
- First Published: 16. Dezember 1996
Das erste metallierte Germanid-Ion und das erst zweite Beispiel für einen Cluster des seltenen nido-10-(iv+ iv)-Strukturtypes ist das Anion in 1, das aus [Ni(CO)2(PPh3)2], K4Ge9 und [2,2,2] Cryptand in Ethylendiamin (en) hergestellt wurde. Die Struktur des Ge10Ni-Clusters (Bild rechts) ist im Vergleich zur idealen nido-10-(iv + iv)-Geometrie allerdings deutlich verzerrt.
[K([2,2,2]Cryptand]2[Ge9(μ10-Ge)Nl(PPh3)]·en 1
Synthesekontrolle in der kombinatorischen Chemie durch Suspensions-1H-MAS-NMR-Untersuchungen an einzelnen Harzpartikeln
- Pages: 3034-3036
- First Published: 16. Dezember 1996
Zeitaufwendige Abspaltungs- und Isolierungsschritte werden durch die Methode der Suspensions-1H-Magic-Angle-Spinning(MAS)-NMR-Spektroskopie überflüssig, die eine Synthesekontrolle an einer einzelnen Harzpartikel im Nanoliterdetektionsbereich ermöglicht. Am Beispiel einer Hydantoin-Reaktionssequenz wurde dieses für die kombinatorische Chemie effiziente Verfahren erprobt.
Die experimentelle Bestimmung der Ionisationsenergien von Berkelium und Californium†
- Pages: 3036-3038
- First Published: 16. Dezember 1996
Nur 1012 Atome eines Elements sind nötig, um dessen Ionisationsenergie durch Resonanzionisation mit Laserlicht in einem äußeren elektrischen Feld und nachfolgende Massenspektrometrie zu bestimmen. Das Bild rechts zeigt für die Actinoide Berkelium und Californium die auf diese Art gemessenen Ionisationsschwellen Wth und deren Extrapolation auf die Ionisationsenergie I (49989(2) bzw. 50665(2) cm−1) bei der äußeren Feldstärke E = 0.
Funktionalisierte Organoimidorhenium(V)-Komplexe als potentielle Radiopharmaka – die Synthese von Glycinderivaten und die strukturelle Charakterisierung eines Rheniumanalogons von Chlorambucil†
- Pages: 3039-3040
- First Published: 16. Dezember 1996
Zwei Aspekte machen diese Arbeit interessant: 1. Es wird ein Verfahren vorgestellt, um Imidokomplexe von radioaktiven Metallisotopen herzustellen. 2. Mit dem Imidliganden wird die maßgeschneiderte Entwicklung von Radiopharmaka enorm erleichtert, weil die Bindung hydrolyse- und säurestabil ist, die Löslichkeit des Radiopharmakons erhalten bleibt und eine Vielfalt von Metallen gebunden werden dürfte. Hier wird unter anderem die Synthese des Chlorambucil-Analogons 1 in unmarkierter und in 188Re-markierter Form beschrieben.
Ein neuer Schichtsilicatstrukturtyp: der Zeolithvorläufer RUB-15: [N(CH3)4]8[Si24O52(OH)4] · 20H2O†
- Pages: 3041-3044
- First Published: 16. Dezember 1996
Ein Bindeglied in der Reihe Inselsilicathydrat–Schichtsilicathydrat–Gerüstsilicat ist RUB–15, ein neuartiges Silicathydrat mit einem dreidimensionalen Bindungsnetzwerk aus schichtartig angeordneten Silicat-Ionen und Wassermolekülen, die durch Wasserstoffbrückenbindungen verknüpft sind. RUB-15 verdeutlicht die enge kristallchemische Verwandtschaft von SiO2 und H2O. Ein Ausschnitt aus der Struktur ist rechts gezeigt.
Lösungsmittelabhängige CN-Bindungslängen in einem protonierten Orthoamid†
- Pages: 3044-3046
- First Published: 16. Dezember 1996
Formale Totalsynthese von (−)-Morphin über konjugierte Cuprataddition
- Pages: 3046-3048
- First Published: 16. Dezember 1996
«Goldene» Pyrazolatringe – Dreikernkomplexe, die bei Raumtemperatur columnare Mesophasen bilden†
- Pages: 3048-3051
- First Published: 16. Dezember 1996
Das flüssigkristalline Verhalten von Gold(I)-Komplexen vom Typ 1 wird wesentlich durch die Substituenten R und R′ sowie durch die Symmetrie der Komplexe bestimmt. Die Moleküle sind in einer hexagonalen columnaren Mesophase angeordnet, die auch bei Raumtemperatur beständig ist. R = 3,4-(H21C10O)2C6H3, R′ = R, 3,4,5-(H21C10O)3−C6H2.
Alkylidinwolframverbindungen, die an planaren Oberflächen mit vier Sauerstoffatomen verankert sind: erschöpfende Alkylierung eines Calixarenwolframkomplexes†
- Pages: 3051-3053
- First Published: 16. Dezember 1996
Verankerung bringt Stabilität. Dies zeigte sich jetzt bei der Protonierung und der Deprotonierung neuartiger Wolframkomplexe. Sie bestehen aus einem Alkylidinwolfram-Komplexfragment, das an ein Calix[4]aren (im Bild schematisch gezeigt) gebunden ist. Der Rest R am dreifach an Wolfram gebundenen C-Atom kann Phenyl, n-Butyl und Trimethylsilyl sein.
Vinylglycoside in der Oligosaccharidsynthese: eine Strategie für die Herstellung von Trisaccharidbibliotheken, basierend auf einer latentaktiven Glycosylierung†
- Pages: 3053-3056
- First Published: 16. Dezember 1996
256 unterschiedliche Trisaccharide aus nur 4 geschützten Grundbausteinen sind mit der hier vorgestellten Methode zur Synthese von Trisaccharidbibliotheken im Prinzip zugänglich. Die Methode nutzt eine latent aktive Glycosylierung; einen Eindruck von den in der Bibliothek enthaltenen Verbindungen gibt die Formel unten.
5-exo oder 6-endo? Theoretische Untersuchungen von Übergangsstrukturen der Umlagerungen von 4-Penten-1-oxyl-Radikalen†‡
- Pages: 3056-3059
- First Published: 16. Dezember 1996
Ein exo-endo-Verhältnis von 98:2 - die Thermochemie hätte das Gegenteil vorhergesagt! Radikale aber bevorzugen dank kinetischer Reaktionskontrolle die exo-Cyclisierung in 5-Hexenyl-Umlagerungen. Ausgewählte ab-initio-Methoden sind in der Lage, intramolekulare Additionen des 4-Penten-l-oxyl-Radikals (rechts) präzise zu beschreiben.