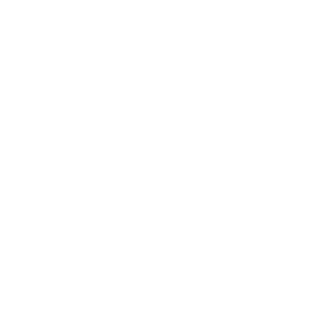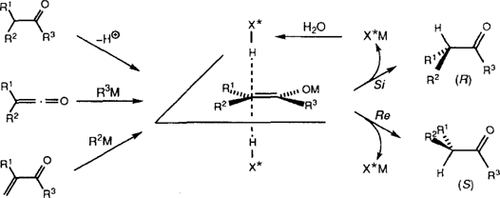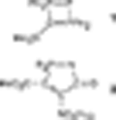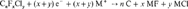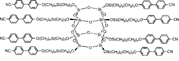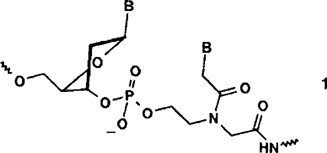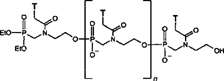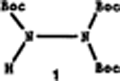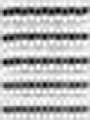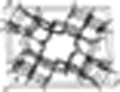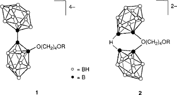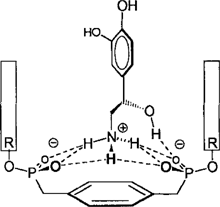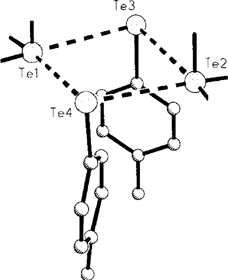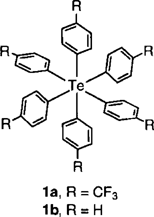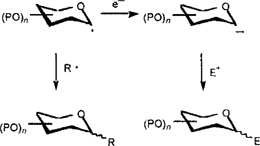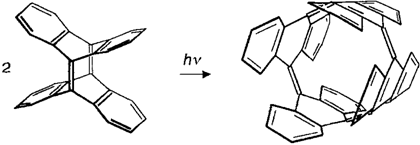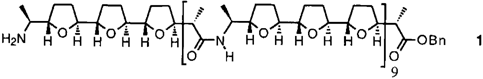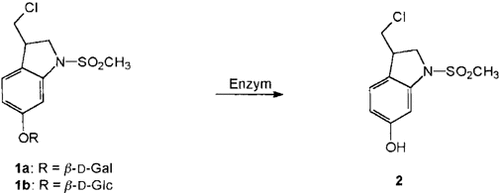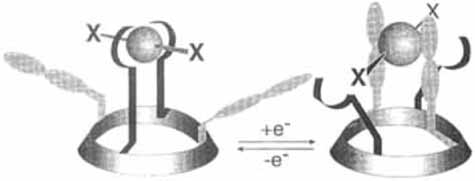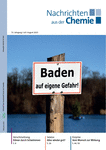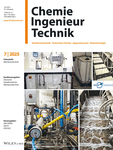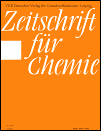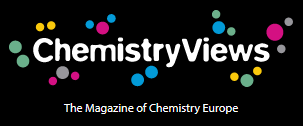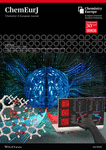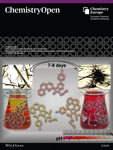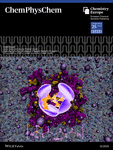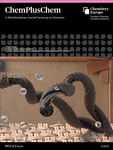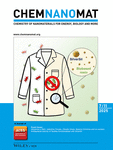Journal list menu
Export Citations
Download PDFs
Titelbild
Impressum
Graphisches Inhaltsverzeichnis
Aufsätze
Enantioselektive Protonierung von Enolaten und Enolen
- Pages: 2726-2748
- First Published: 18. November 1996
Der bevorzugte Protonentransfer auf eine enantiotope Seite eines Enolats oder Enols durch einen chiralen Protonendonor H*X oder eine achirale Protonenquelle in Gegenwart eines chiralen Liganden bekommt als neuartige Synthesemethode einen immer höheren Stellenwert. Durch umsichtige Wahl des Reagens können sowohl Ketone als auch Carbonsäuren nahezu enantiomerenrein erhalten werden (siehe schematischen Überblick unten).
Was läßt sich aus der molekularen Erkennung in Protein-Ligand-Komplexen für das Design neuer Wirkstoffe lernen?
- Pages: 2750-2778
- First Published: 18. November 1996
Viel, aber noch nicht genug, das ist die Antwort, die auf die Titelfrage gegeben werden kann. Wie sich aus den Strukturen von Enzymliganden im Kristall und im Komplex mit ihrem Enzym allgemeingültige Regeln zur Integration in Computerprogramme für das Ligandendesign ableiten lassen, wird hier beschrieben. Aber es werden auch Belege dafür vorgestellt, daß Vorsicht angebracht ist – vor allem bei nur auf strukturellen Argumenten basierenden Überlegungen, denn Wechselwirkungen wie H-Brücken und lipophile Kontakte können zu völlig unerwarteten Orientierungen von Liganden in einer Proteinbindetasche fuhren.
Highlights
Phosphorchemie weiter im Aufwind: ylidische Vierringsysteme mit vier π-Elektronen
- Pages: 2779-2782
- First Published: 18. November 1996
Ungesättigte, viergliedrige Phosphorheterocyclen mit wenigstens einem λ5, σ4-Phosphoratom wie das Triphosphet 1, das von Karsch et al. hergestellt wurde, sind erstaunlich stabil, wenn man sie mit antiaromatischen Mono- und Oligophospheten mit zweifach koordinierten Phosphoratomen vergleicht. Unter Ringerweiterung können sie zu fünfgliedrigen Heterocyclen, z.B. 2, reagieren (nach Bertrand et al.), Komplexe bilden oder Additions- und Substitutionsreaktionen eingehen.
Defluorierung von Perfluoralkanen und Chlorfluorkohlenstoffen†
- Pages: 2783-2785
- First Published: 18. November 1996
Durch Elektronentransfer zum Fluorkohlenstoff leiten reduzierend wirkende Verbindungen die Spaltung der starken und scheinbar reaktionsträgen C-F-Bindungen ein. Dieser Prozeß ist zur Defluorierung von Perfluoralkanen zu Perfluorarenen oder -alkenen - auch unter milden katalytischen Bedingungen – sehr gut geeignet. Chlorfluorkohlenstoffe können z. B. mit Alkalimetalloxalaten als Zwei-Elektronen-Reduktionsmittel bei Raumtemperatur vollständig abgebaut werden [Gl. (a)].
Zuschriften
Biomimetisches Wachstum und Selbstorganisation von Fluorapatit-Aggregaten durch Diffusion in denaturierten Kollagen-Matrices†
- Pages: 2788-2791
- First Published: 18. November 1996
Mit elongierten, hexagonal-prismatischen Keimen beginnt das hierarchische Wachstum anisotroper Kugelaggregate aus Fluorapatit in Gelatine-Matrices. Durch selbstähnlich verzweigte, nadelförmige Aufwachsungen an den Enden der Keime entstehen diskrete Hantelaggregate (rasterelektronenmikroskopische Aufnahme rechts), die sich mit fortschreitenden Generationen zu Kugeln mit Durchmessern bis 400 μm schließen. Das System erlaubt, die Entwicklung eines abiotischen Informationsmusters bis in den makroskopischen Bereich zu verfolgen.
Flüssigkristalline, substituierte Octakis(dimethylsiloxy)octasilsesquioxane: oligomere, supramolekulare Materialien mit definierter Topologie
- Pages: 2791-2793
- First Published: 18. November 1996
Synthese und Eigenschaften von PNA/DNA-Chimären†
- Pages: 2793-2797
- First Published: 18. November 1996
Phosphonsäureester-Nucleinsäuren (PHONAs): Oligonucleotid-Analoga mit achiralem Rückgrat
- Pages: 2797-2800
- First Published: 18. November 1996
PHONAs sind wegen ihrer guten Wasserlöslichkeit und ihrer Fähigkeit, komplementäre DNA zu binden, als Therapeutika von Interesse. Ähnlich wie bei den PNAs sind die Nucleobasen über Methylencarbonyl-Linker an das Rückgrat geknüpft (siehe unten). Durch Blockkondensation können diese Verbindungen synthetisiert werden.
Katalytische Antikörper als Sonden für die Evolution von Enzymen: Modellierung einer frühen Glycosidase†
- Pages: 2800-2802
- First Published: 18. November 1996
Die Hydrolyse nicht aktivierter cyclischer Ketale des Typs 1 (siehe unten) wird durch Antikörper katalysiert, die gegen 2, ein Analogon des Übergangszustands, gerichtet sind. Diese Umwandlung ist eng verwandt mit der Spaltung der glycosidischen Bindung und basiert hauptsächlich auf der elektrostatischen, weniger auf der räumlichen Komplementarität von 2 zum Übergangszustand.
Ein prototypisches Reagens für die Synthese substituierter Hydrazine†
- Pages: 2802-2803
- First Published: 18. November 1996
Daß fast alle Möglichkeiten erschöpft seien, nahm H. Wieland im Vorwort seiner Monographie Die Hydrazine von 1913 hinsichtlich der Synthese N,N′-substituierter Hydrazine an, und bis heute fehlte es an geeigneten Reagentien und Methoden zur Herstellung dieser Verbindungen, die für die Pharmazie, die Agro- und die Farbstoffchemie von großer Bedeutung sind. Mit dem leicht zugänglichen, geschützten Hydrazin 1 liegt nun ein Reagens vor, daß hier Abhilfe schafft.
Cyclisches [6]- und [8]Paraphenylacetylen†**
- Pages: 2803-2805
- First Published: 18. November 1996
Die gürtelförmig konjugierten Verbindungen 1 und 2 wurden durch Bromierung/Dehydrobromierung der korrespondierenden Hexaene bzw. Octaene synthetisiert. Die luftempfindlichen, aber isolierbaren Substanzen weisen merkliche Spannungen in den Dreifachbindungen und große Stokes-Verschiebungen in den Emissionsspektren auf.
Kontrollierte Synthese von [TiSe2]m[NbSe2]n-Überstrukturen aus modulierten Reaktanten†
- Pages: 2805-2809
- First Published: 18. November 1996
Miteinander verwachsene Dichalkogenidschichten mit im voraus bestimmter Modulation der Zusammensetzung lassen sich durch kontrolliertes Kristallisieren von „Überstruktur-Reaktanten”︁ herstellen. Die Produkte (im Bild erkennt man den allmählichen Übergang von einer Atomsorte (schwarze Kugeln) zu einer anderen (graue Kugeln)) bilden sich in Form dünner Filme, in denen die Dichalkogenidschichten parallel zur Substratoberfläche ausgerichtet sind. Die gezielte Einstellung chemischer und physikalischer Eigenschaften über die gewünschte Überstruktur ist somit ein Stück näher gerückt.
(enH2)0.5[Zr2(PO4)2(HPO4)F]·H2O — ein neuartiges Zirconiumfluoridphosphat mit Hohlraumstruktur†
- Pages: 2809-2811
- First Published: 18. November 1996
Mittelgroße Kanäle durchziehen die Struktur des ersten Zirconiumfluoridphosphats, das jetzt synthetisiert worden ist (Strukturausschnitt im Bild). Das Gerüst wird aus ZrO6- und ZrO5F-Oktaedern sowie PO4- und PO3(OH)-Tetraedern aufgebaut. Durch Variation des als Templat verwendeten Amins sollten weitere offene Gerüststrukturen dieser Art synthetisierbar sein.
Die neuartige, [n-B20H18]2−-vermittelte, nucleophile Ringöffnung von Tetrahydrofuran durch Alkoholat-Ionen†
- Pages: 2811-2813
- First Published: 18. November 1996
Völlig unerwartet bildet sich [ae-B20H17O(CH2)4OR]2− 1 bei der Reaktion von [n-B20H18]2− mit Alkoholaten NaOR (R = Methyl, Isopentyl) statt des erwarteten [ae-B20H17OR]4−. Ursache ist der nucleophile Angriff eines Alkoholat-Ions auf ein an [n-B20H18]2− assoziiertes THF-Molekül. Bei der Oxidation von 1 in Ethanol unter Wasserausschluß entstanden die [μ-B20H17O(CH2)4OR]2−-Ionen 2, die zum [μ-B20H17OH]2−-Ion hydrolysiert werden konnten.
Synthese und Struktur von CoB2P3O12(OH) · C2H10N2: das erste Metallborophosphat mit einer offenen Gerüststruktur†
- Pages: 2814-2816
- First Published: 18. November 1996
Kanäle mit Abmessungen von ca. 5.2 × 7.6 Å (O-O-Abstände) weist das erste strukturell mikroporöse Borophosphat auf (Strukturausschnitt im Bild rechts), bei dessen Hydrothermalsynthese Ethylendiamin als Templat wirkte. Das Gerüst wird aus BO4- und PO4-Tetraedern sowie CoO6-Oktaedern aufgebaut, und die Kanäle sind von den organischen Dikationen besetzt.
Auf dem Weg zu synthetischen Adrenalinrezeptoren – starke Bindung von Aminoalkoholen durch Bisphosphonate†
- Pages: 2816-2818
- First Published: 18. November 1996
Eine neue Klasse von Ammoniumrezeptoren bindet besonders stark an biologisch wichtige Aminoalkohole wie Glucosamin, Norephedrin und den Betablocker Propranolol (Ka > 50000 in Dimethylsulfoxid). Die Art der molekularen Erkennung (mit Kraftfeldrechnungen erstelltes Modell siehe rechts) ahmt dabei die des natürlichen Adrenalinrezeptors nach.
Cœlenteranden: eine neue Klasse von Einschlußliganden
- Pages: 2818-2820
- First Published: 18. November 1996
K7HW5O19 · 10 H2O – ein neuartiges Isopolyoxowolframat(VI)†
- Pages: 2820-2822
- First Published: 18. November 1996
Dimere Triaryltelluroniumaryltellurolate: neuartige metastabile Tetramere der Diaryltelluride†
- Pages: 2822-2824
- First Published: 18. November 1996
Als Paare von Ionenpaaren lassen sich die hier beschriebenen Telluroniumtellurolate R13TeTeR2 (R1 = Phenyl, R2 = 4-Methylphenyl (1a), R2 = 4-Methoxyphenyl (1b)) und die entsprechenden -selenolate auffassen, deren Existenzfähigkeit im festen Zustand eng mit kooperativen Chalkogen-Chalkogen-Wechselwirkungen zusammenhängt. Der zentrale Te4-Vierring von 1a ist rechts gezeigt (Phenyl-substituenten an Te1 und Te2 der Übersichtlichkeit halber weggelassen).
Haben die stabilsten anellierten Heterobicyclen auch den stärksten aromatischen Charakter?†
- Pages: 2824-2827
- First Published: 18. November 1996
Nein ist die Antwort der Autoren auf die Titelfrage: Die stabilsten Isomere der zum Pentalendianion isoelektronischen Heterobicyclen 1 und 2 weisen nicht die größte Aromatizität auf. Das folgt aus mit ab-initio-Methoden berechneten geometrischen und magnetischen Kriterien (magnetische Suszeptibilitäten und deren Anisotropie, 1H-NMR-chemische Verschiebungen und kernunabhängige chemische Verschiebungen).
TeAr6: Synthese und Struktur der ersten neutralen Hexaarylelementverbindungen
- Pages: 2827-2829
- First Published: 18. November 1996
Die höchstmögliche Oxidationsstufe, +6, weisen die Tellurzentren in den Hexaaryltellurverbindungen 1a, b auf, die beide thermisch sehr stabil und, anders als Tetraorganotellurverbindungen, lichtunempfindlich sind. Röntgenstrukturanalysen von 1a, b zufolge sind beide Verbindungen nahezu Th-symmetrisch, was äußerst selten ist.
Samariumdiiodid-vermittelte Kupplung von Glycosylphosphaten mit Kohlenstoffradikal- oder -anion-Acceptoren – Synthese von C-Glycosiden†
- Pages: 2829-2832
- First Published: 18. November 1996
Die als Kohlenhydratmimetica bei Erkennungsprozessen in biologischen Systemen eingesetzten C-Glycoside lassen sich durch SmI2-vermittelte Kupplung von Glycosylphosphaten mit Kohlenstoffradikal-oder Kohlenstoffanionen-Acceptoren synthetisieren. Die Reaktion verläuft wahrscheinlich in Einelektronen-schritten über Radikale oder Anionen als Zwischen-stufe (siehe rechts).
Inversion optisch aktiver Dihydropyridine durch Oxidation und Elektroreduktion†
- Pages: 2832-2834
- First Published: 18. November 1996
Durch stereoselektive Oxidation optisch aktiver Dihydropyridine mit NOBF4 oder MnO2 erhält man unter Inversion bzw. Retention der Konfiguration axial-chirale Arylpyridine (siehe unten), die bei kathodischer Reduktion die entsprechenden Dihydropyridine liefern. Damit gelang erstmals die Konfigurationsumkehr bei Di-hydropyridinen.
Ringerweiterungsmetathese von Tetradehydrodianthracen – Synthese und Struktur eines röhrenförmigen, vollständig durchkonjugierten Kohlenwasserstoffs†
- Pages: 2834-2836
- First Published: 18. November 1996
Oligo-THF-Peptide: Synthese, Membraneinbau und Untersuchungen zur Ionenkanalaktivität†
- Pages: 2836-2839
- First Published: 18. November 1996
Tumorselektiv aktivierbare Prodrugs des Cytostaticums CC-1065†
- Pages: 2840-2842
- First Published: 18. November 1996
Die O-Glycoside l des seco-CI-Derivats 2, das die seco-Form der pharmakophoren Gruppe des cytotoxisch hochwirksamen Antibioticums CC–1065 ist, weisen nur eine sehr geringe Toxizität auf. In der tumorselektiven Krebstherapie können sie mit Konjugaten aus Glycohydrolasen und monoklonalen Antikörpern, die an tumorassoziierte Antigene binden, eingesetzt werden. Die Glycohydrolasen spalten die Prodrugs 1 unter Freisetzung der cytotoxischen Komponente 2.
Molekulare Redoxschaltungen durch Ligandenaustausch†
- Pages: 2842-2845
- First Published: 18. November 1996
Nur umklappen müssen die Liganden des im Bild links schematisch dargestellten Calix[4]aren-Eisen(III)-Komplexes, um das weiche Eisen(II)-Ion, das durch Reduktion erhalten wurde (rechts), komplexieren zu können (X = Moleküle der Pufferlösung). Um das zu gewährleisten, trägt das Calixaren zwei Sätze von ionenbindenden Gruppen: einen für harte, einen für weiche Metallionen. Das Hin-und-her-Schalten des Moleküls zwischen den beiden Zuständen bei Redoxvorgangen läßt sich auch UV/Vis- spektroskopisch in Echtzeit verfolgen.
Berichtigungen
Bücher
Chemie der Zukunft – Magie oder Design? Von P. Ball. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1996. 515 S., 48.00 DM. – ISBN 3–527–29387–6
- Page: 2847
- First Published: 18. November 1996
Das Rätselkabinett des Doktor Krätz. Von O. Krätz. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1996. 195 S., Broschur 38.00 DM. – ISBN 3–527–29391–4
- Pages: 2847-2848
- First Published: 18. November 1996
Das Milliarden-Dollar-Molekül. Von B. Werth. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1996. 430 S., Broschur 48.00 DM. – ISBN 3–527–29373–6
- Pages: 2848-2849
- First Published: 18. November 1996
Organische Chemie. Grundlagen, Mechanismen, bioorganische Anwendungen. Von M. A. Fox und J. K. Whitesell. Aus dem Amerikanischen übersetzt von E. Buchholz, F. Glauner, J. Lichtenthäler, S. Müller-Becker und K. Wolf. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 1995. 930 S., geb. 98.00 DM. – ISBN 3–86025–249–6
- Pages: 2849-2850
- First Published: 18. November 1996
Organometallics in Synthesis – A Manual. Herausgegeben von M. Schlosser. Wiley, Chichester, 1994. 603 S., geb. 60 £. ISBN 0–471–93637–5
- Pages: 2850-2851
- First Published: 18. November 1996