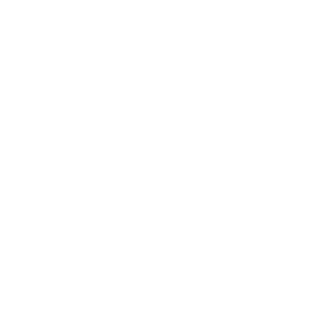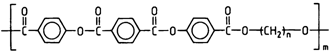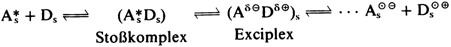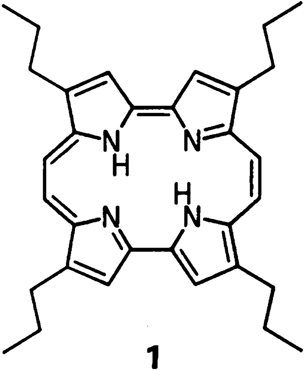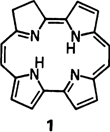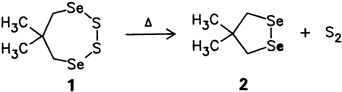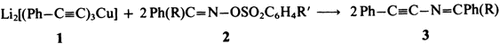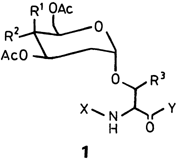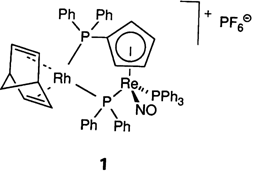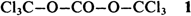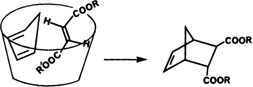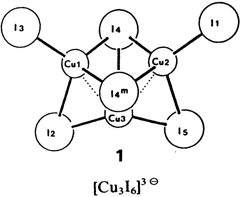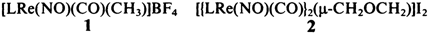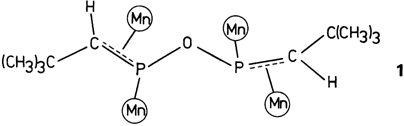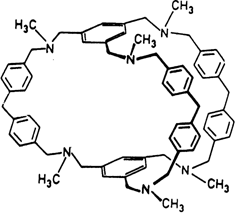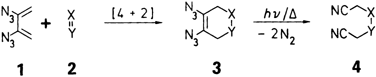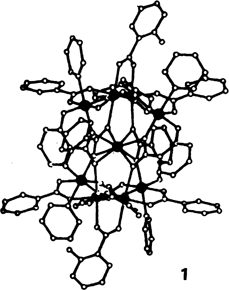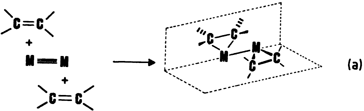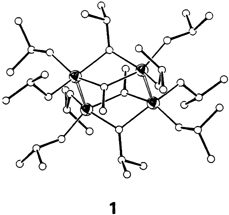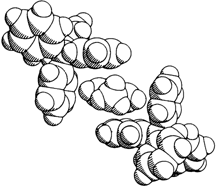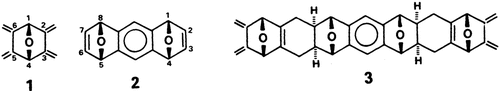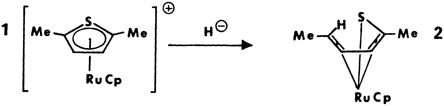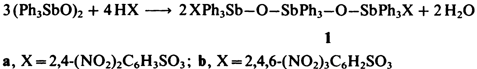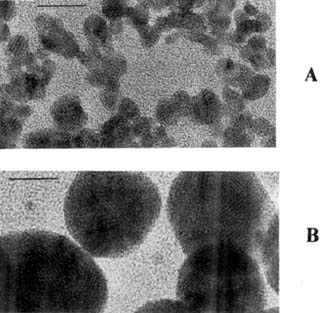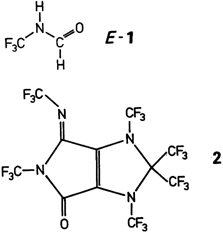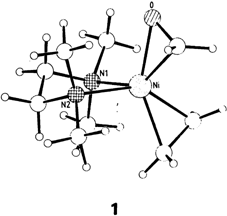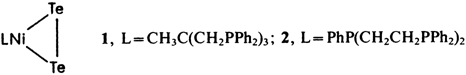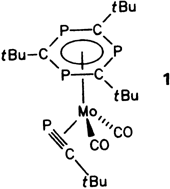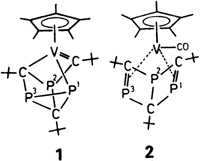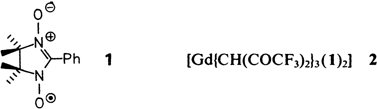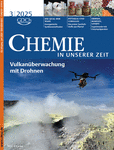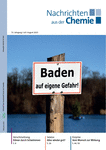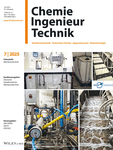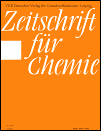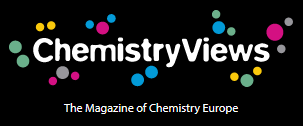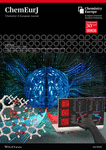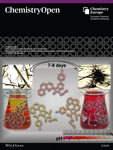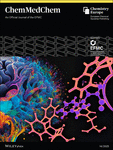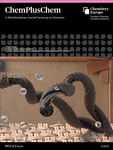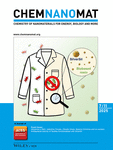Journal list menu
Export Citations
Download PDFs
Titelbild
Impressum
Graphisches Inhaltsverzeichnis
Aufsätze
Erzeugung und Charakterisierung von Molekülen durch Neutralisations-Reionisations-Massenspektrometrie (NRMS)†
- Pages: 829-839
- First Published: September 1987
Viele Spezies, die nach den Schuldogmen der Chemie nicht existenzfähig sein sollten, lassen sich durch spezielle Stoßexperimente im Hochvakuum eines Massenspektrometers erzeugen. Eine der dabei auftretenden Reaktionen ist die selektive Reduktion (Neutralisation) von Kationen. Unter den so erhaltenen Molekülen finden sich hypervalente Spezies (Rydberg-Radikale) wie H , van-der-Waals-Komplexe wie He2, mono- oder disubstituierte Acetylene wie HCCOH und H2NCCNH2 und Verbindungen wie Kohlensäure und Carbaminsäure.
, van-der-Waals-Komplexe wie He2, mono- oder disubstituierte Acetylene wie HCCOH und H2NCCNH2 und Verbindungen wie Kohlensäure und Carbaminsäure.
Flüssigkristalline Polymere
- Pages: 840-848
- First Published: September 1987
Gläser mit anisotropen physikalischen Eigenschaften können aus flüssigkristallinen Polymeren erhalten werden. Diese Polymere entstehen durch Einführung starrer, mesogener Strukturelemente in eine Polymerhauptkette oder als Seitengruppen der Monomereinheiten des Makromoleküls. Zahlreiche Anwendungen, nicht nur in der Optoelektronik, lassen sich heute schon absehen.
Ladungstransfer und Radikalionen in der Photochemie†
- Pages: 849-870
- First Published: September 1987
Der photochemisch induzierte Ladungstransfer von einem Donor(D)- auf ein Acceptormolekül(A) gehört zu den einfachsten Elementarprozessen in Lösung. Derartige bimolekulare Photoreaktionen verlaufen meist mehrstufig über „komplexartige”︁ Zwischenstufen (Exciplexe). Das Ausmaß des Ladungstransfers bestimmt dabei nicht nur die Bindungsstärke im Exciplex, sondern beeinflußt über den resultierenden Charge-Transfer-Charakter auch die Struktur des Exciplexes und damit die Selektivität von Folgereaktionen der Radikalanionen und -kationen.
Die Begegnung von Chemie und Physik im Festkörper
- Pages: 871-906
- First Published: September 1987
Wollen Chemiker die erstaunlichen elektronischen Eigenschaften von Festkörperverbindungen verstehen, müssen sie die Sprache der Festkörperphysik, der Bandstrukturen, erlernen. Diese Sprache läßt sich dadurch entmystifizieren, daß klare Parallelen zu allgemein bekannten Begriffen der Theoretischen Chemie gezogen werden. Der Chemiker bringt in das gemeinsame Bemühen von Physikern und Chemikern um ein Verständnis der Bindung in ausgedehnten Systemen ein hohes Maß an Intuition und einige einfache, aber wirkungsvolle Vorstellungen ein. Am wichtigsten sind dabei der Begriff der lokalisierten Bindung und der Gebrauch von Grenzorbital-Argumenten.
Zuschriften
2,7,12,17-Tetrapropylporphycen — Pendant des Octaethylporphyrins in der Porphycen-Reihe†
- Pages: 909-912
- First Published: September 1987
Die Titelverbindung 1 und ihr Nickelkomplex erfüllen die Hoffnungen, die in sie gesetzt worden waren: Durch die Substitution von Porphycen mit vier Propylgruppen werden (wie bei Porphyrinen) die Löslichkeit und das Kristallisationsvermögen erhöht. 1 zeichnet sich durch starke NH…N-Wasserstoffbrücken und durch NH-Tautomerie aus. Der Nickelkomplex hat die erwarteten Eigenschaften.
2,3-Dihydroporphycen – ein Analogon des Chlorins
- Pages: 912-914
- First Published: September 1987
15N-CPMAS-NMR-Untersuchungen des Problems der NH-Tautomerie in kristallinem Porphin und Porphycen†
- Pages: 914-917
- First Published: September 1987
Festkörper-15N-NMR-Untersuchungen bei variabler Temperatur ermöglichten Aussagen über das Verhalten der vier N-Atome und der beiden inneren H-Atome in den Isomeren Porphin und Porphycen. Aus den Spektren von Porphin wird eine statistische Fehlordnung der inneren H-Atome abgeleitet. Bei Porphycen wird auf zwei nicht äquivalente, unsymmetrische Protonentransfersysteme geschlossen. Da die NH…N-Abstände sehr kurz sind, ist die Energiebarriere für die Umlagerung sehr klein. Anders als bei Porphin ist bei Porphycen daher die gegenseitige Umwandlung der Tautomere so schnell, daß die Geschwindigkeitskonstanten für den Protonentransfer mit der 15N-CPMAS-NMR-Methode nicht ermittelt werden können.
5, 5-Dimethyl-1,2-dithia-3,7-diselenacycloheptaneine lagerfähige Quelle für Dischwefel, S2†
- Pages: 917-918
- First Published: September 1987
Erste Synthese von N-Methylen-inaminen (2-Aza-but-1-en-3-inen)†
- Pages: 918-919
- First Published: September 1987
Zuwachs für die C3H3N-Isomerengruppe ist HCC;NCH2, das den Titelverbindungen 3 zugrunde liegt. Diese ersten N-Methylen-inamine enthalten gegenüber den Inaminen eine zusätzliche konjugierte CN-Bindung. Die Verbindungen 3 konnten jetzt aus dem Cuprat 1 und den Oximestern 2 erhalten werden. Zur Sicherheit wurde auch das isomere Propargylidenamin PhCCC(Ph)NPh synthetisiert. Quantenmechanische Berechnungen machen Voraussagen zum Energieinhalt dieser Verbindungen möglich (a, RPh, R′Me; b, RMe, R′H).
Synthese von O-(α-Glyco)peptiden mit dem N-Iodsuccinimid-Verfahren†
- Pages: 919-921
- First Published: September 1987
Die Glycosylierung von Serin oder Threonin in (geschützten) Peptiden gelingt durch Umsetzung mit Glycalen und N-Iodsuccinimid. Dabei werden die 2-Iodderivate in hohen Ausbeuten und mit hoher. Diastereoselektivität erhalten. Diese Derivate lassen sich in 2-Desoxy-α-glycopeptide vom Typ 1 überführen (R1, R2 = H, OAc; R3 = H, Me; X, Y = Schutzgruppe, Aminosäure- oder Peptidderivat).
Ein neuartiger heterodinuclearer Katalysator für die asymmetrische Hydrierung — ein Bisphosphido-Ligand mit einem stereogenen Rheniumzentrum†
- Pages: 921-922
- First Published: September 1987
Der Rhodium-Rhenium-Komplex 1 kann als Prototyp einer neuen Generation von Hydrierkatalysatoren angesehen werden. Charakteristisch ist die Verknüpfung eines Rh1-Zentrums – bekannt für katalytische Aktivität bei Hydrierungen – mit einem Bis(diphenylphosphido)-Liganden, der im Gerüst ein pseudo-tetraedrisch koordiniertes, stereogenes Re-Atom enthält. Beispielsweise wird mit 1 (0.4 Mol-% in THF) α-Acetamidoacrylsäure mit 1 atm H2 bei Raumtemperatur zu (R)-N-Acetylalanin mit 98% ee hydriert (Ausbeute: 82%).
Triphosgen, ein kristalliner Phosgen-Ersatz†
- Pages: 922-923
- First Published: September 1987
Thermisch stabil, wenig flüchtig, einfach zu transportieren und zu lagern, exakt dosierbar – das sind die Vorteile von Kohlensäure-bis(trichlormethylester) 1 als Phosgen-Ersatz. Darüber hinaus genügen stöchiometrische Mengen 1 für Chlorformylierungen, Carbonylierungen, Chlorierungen und Dehydratisierungen, die obendrein mit guten bis sehr guten Ausbeuten verlaufen.
Stereoselektivitätsanderungen bei Diels-Alder-Reaktionen durch hydrophobe Solvenseffekte und durch β-Cyclodextrin†
- Pages: 924-925
- First Published: September 1987
Signifikante änderungen der endo/exo-Produktverhältnisse bei Diels-Alder-Reaktionen sind durch Verwendung wäßriger Lösungsmittel möglich. Die Diastereoselektivität läßt sich dabei als quantitative Funktion von Lösungsmittel-Solvophobie-Parametern beschreiben. Zusatz von β-Cyclodextrin bewirkt teilweise noch stärkere änderungen des endo/exo-Verhältnisses sowie die Bildung chiraler Diels-Alder-Addukte.
[{Co(Cp)2}{CuI2}]n (n=3,4), Cobaltocenium-Iodocuprate(I) mit ungewöhnlichen Anionen-Strukturen†
- Pages: 925-927
- First Published: September 1987
Große Kationen mit kleiner Ladung stabilisieren mehrkernige Iodocuprat(I)-Ionen. Dies belegt die Synthese der beiden homologen Komplexe [Co(Cp)2]3[Cu3I6] und [Co(Cp)2]4[Cu4I8]. Das Bestreben der Iodatome, sich in energetisch günstigen Kugelpackungen anzuordnen, und der Einfluß der Kationen auf die Art der Packung und die Besetzung ihrer Tetraeder- und Dreieckslücken mit Cu1 führten zu nicht vorhersehbaren Anionen-Strukturen wie 1.
Der Mechanismus von Substitutionsreaktionen an [LRe(NO)(CO)(CH3) ]⊕ in saurer Lösung und die Struktur von [{LRe(NO)(CO)}2(μ-CH2OCH2)]I2 (L = 1, 4, 7-Triazacyclononan)†
- Pages: 927-929
- First Published: September 1987
Der Ligand CH in 1 läßt sich säurekatalysiert durch Cl⊖ ersetzen. Dabei dürfte die unter Retention der Konfiguration an Re ablaufende Reaktion durch Protonierung eines NAmin-Atoms und Spaltung der ReNAmin-Bindung eingeleitet werden. Dagegen entsteht bei dem Versuch, CH
in 1 läßt sich säurekatalysiert durch Cl⊖ ersetzen. Dabei dürfte die unter Retention der Konfiguration an Re ablaufende Reaktion durch Protonierung eines NAmin-Atoms und Spaltung der ReNAmin-Bindung eingeleitet werden. Dagegen entsteht bei dem Versuch, CH durch I⊖ zu ersetzen, wenn nicht unter Luftausschluß gearbeitet wird, der zweikernige Komplex 2 mit der bisher unbekannten Brücke 2-Oxapropan-1,3-diid, die durch zwei O…HN-Brücken stabilisiert wird.
durch I⊖ zu ersetzen, wenn nicht unter Luftausschluß gearbeitet wird, der zweikernige Komplex 2 mit der bisher unbekannten Brücke 2-Oxapropan-1,3-diid, die durch zwei O…HN-Brücken stabilisiert wird.
(2, 2, 8, 8-Tetramethyl-5-oxa-4,6-diphospha-3, 6-nonadien) tetrakis[dicarbonyl- (methylcyclopentadienyl) mangan], der erste komplexierte Bis (phosphavinyl) ether†
- Pages: 929-930
- First Published: September 1987
Der Komplex eines neuartigen Liganden ist die Titelverbindung 1. Sie entsteht aus [(CH3C5H4)Mn(CO)2·thf] und (CH3)3CCP vermutlich unter H2O-Aufnahme. Im paramagnetischen Komplex 1 fungiert der Bis(phosphavinyl)ether als 8-Elektronendonor gegenüber den vier (CH3C5H4)Mn(CO)2-Einheiten (hier  abgekürzt).
abgekürzt).
Selektive molekulare Erkennung und Trennung isomerer und partiell hydrierter Arene†
- Pages: 930-932
- First Published: September 1987
Der selektive intramolekulare Einschluß diskusförmiger Arene, die größer als Naphthalin und kleiner als Coronen sind, gelingt mit der rechts wiedergegebenen neuartigen Wirtverbindung. Die besondere Gastselektivität ermöglicht unter anderem die präparative Trennung ähnlicher Kohlenwasserstoffe (z. B. Anthracen und Phenanthren) durch Flüssig/Flüssig- oder Fest/Flüssig-Phasentransfer.
[4 + 2]-Cycloadditionen von 2,3-Diazido-1,3-butadienen: Ein neuer Zugang zu vicinalen Vinyldiaziden und 1,4-Dicyanverbindungen†
- Pages: 932-934
- First Published: September 1987
Salicylat-vermittelte Bildung des diskreten, gemischtvalenten, neunkernigen Mangankomplexes [Mn9O4(O2CPh)8(sal)4(salH)2(py)4] (salH2 = Salicylsäure, py = Pyridin)†
- Pages: 934-936
- First Published: September 1987
Als eine Art „anorganische Sandwich-Verbindung”︁ ohne Metall-Metall-Bindungen kann der Komplex 1 angesehen werden: Er enthält zwei relativ flache [Mn4IIIO2]-Einheiten und dazwischen ein MnII-Atom. 1 bildet sich in Form schwarzer Kristalle aus [Mn3O(O2CPh)6(py)2(H2O)], das in Acetonitril gelöst und mit fester Salicylsäure versetzt wird. Bemerkenswert ist die hohe Ausbeute von ca. 40%. Die magnetische Suszeptibilität von 1 deutet auf eine starke Kopplung der einsamen Elektronen.
Koordination von Ethylen an einen Komplex mit M-M-Dreifachbindung: Bis(η2-ethylen)hexakis(neopentyloxy)diwolfram†
- Pages: 936-937
- First Published: September 1987
Die erste Addition eines einfachen Olefins an ein M-M-Mehrfachbindungssystem gelang bei der Umsetzung von [W2(OCH2tBu)6] mit Ethylen in Hexan bei 0°C. Das NMR-spektroskopisch charakterisierte, instabile 1 :2-Addukt [W2(OCH2tBu)6(CH2CH2)2] ist am besten als Dimetallabicyclopropyl zu beschreiben, in dem die Ringe senkrecht zueinander stehen. Gleichung (a) zeigt die Addition schematisch.
Darstellung und Struktur von [Mo4(OMe)2(OiPr)10]; warum dimerisiert [W2(OiPr)6], nicht aber [Mo2(OiPr)6]?†
- Pages: 937-939
- First Published: September 1987
Weil ein [MoMo]6⊕-Komplex thermodynamisch stabiler ist als ein entsprechender [WW]6⊕-Komplex! ist die Antwort auf die Titelfrage. Es wird vermutet, daß dieser Befund auf Kernabstoßungseffekte zurückzuführen ist, die bei Wolfram größer sind als bei Molybdän. Die Struktur des Titelkomplexes 1 ist durch zwei kurze und zwei lange Mo-Mo-Abstände (2.238(1) bzw. 3.344(1) Å) und damit durch zwei bisalkoxidverbrückte MoMo-Einheiten charakterisiert. Die Bildung von Alkoxidbrücken könnte ein wichtiger Schritt bei der Dimerisierung von [W2(OiPr)6] sein.
Nicht-kovalente bindende Wechselwirkungen zwischen Tetraphenylborat-Anionen und Paraquat- oder Diquat-Dikationen†
- Pages: 939-941
- First Published: September 1987
Einen ternären Komplex – in Lösung und im Kristall – mit π-π-Charge-Transfer-Wechselwirkungen bilden das Dikation Paraquat (Me\documentclass{article}\pagestyle{empty}\begin{document}$ \mathop {\rm N}\limits^ \oplus $\end{document} Ň5H4C5H4\documentclass{article}\pagestyle{empty}\begin{document}$ \mathop {\rm N}\limits^ \oplus $\end{document}
Ň5H4C5H4\documentclass{article}\pagestyle{empty}\begin{document}$ \mathop {\rm N}\limits^ \oplus $\end{document} NMe) und zwei Tetraphenylborat-Anionen. Dabei treten Fläche-auf-Fläche- und Fläche-auf-Kante-Wechselwirkungen zwischen Pyridinium- und Phenylringen auf. Vom langgestreckten Paraquat ist im Bild rechts kaum mehr als eine Methylgruppe zu erkennen.
NMe) und zwei Tetraphenylborat-Anionen. Dabei treten Fläche-auf-Fläche- und Fläche-auf-Kante-Wechselwirkungen zwischen Pyridinium- und Phenylringen auf. Vom langgestreckten Paraquat ist im Bild rechts kaum mehr als eine Methylgruppe zu erkennen.
Gürtel- und Kragenmoleküle: Ein Hexaepoxyoctacosahydro[12]cyclacen†
- Pages: 941-943
- First Published: September 1987
Wiederholte Diels-Alder-Reaktionen der passend gekrümmten, starren Edukte 1 und 2 ergeben über die zentrale Zwischenstufe 3 die nicht nur ästhetisch reizvolle Titel- (und Titelbild-)Verbindung. Im letzten Schritt der Synthese wird 3 unter hohem Druck (9–10 kbar) mit 2 umgesetzt (Ausbeute immerhin 20%). Die Diels-Alder-Reaktionen sind bemerkenswert stereoselektiv, die Zwischenprodukte topologisch äußerst interessant und das Endprodukt – es spricht für sich.
Cluster aus Clustern: Struktur des 37atomigen Clusters [(p-Tol3P)12Au18Ag19Br11]2⊕ und eine neuartige Serie von Superclustern aus eckenverknüpften Ikosaedern†
- Pages: 943-945
- First Published: September 1987
Als Derivat eines „kleinen Superclusters”︁ kann die Titelverbindung 1 angesehen werden. Dieser Supercluster gehört zu einer Reihe, die sich aus eckenverknupften Ikosaedern mit einem Metallatom im Zentrum des Ikosaeders aufbaut; die Grundeinheit besteht somit aus 13 Atomen. Der einfachste Supercluster aus 25 Atomen (das heißt zwei Einheiten mit einer gemeinsamen Ecke; 2 × 13 − 1 = 25) ist bekannt. Der 37atomige Cluster 1 und ein 38atomiges Analogon können auf ein Gerüst mit 3 × 13 − 3 = 36 Atomen zurückgeführt werden, das zusätzlich ein bzw. zwei apicale Ag-Atome enthält. (Tol = Tolyl)
Iodphosphoniumsalze mit ungewöhnlichen Eigenschaften und eine Strukturalternative für Halogenphosphorane†
- Pages: 945-947
- First Published: September 1987
Ungewöhnlich ist der NMR-spektroskopisch verfolgte Ablauf der Reaktion von tBu3P mit I2 in CH2Cl2: Es werden keine separaten Produktsignale gefunden, und die kontinuierliche Veränderung der chemischen Verschiebungen und Kopplungskonstanten endet nicht am „Äquivalenzpunkt”︁ (tBu3P:I2 = 1:1). Dies läßt sich mit den Gleichgewichten (a)-(c) erklären. Ungewöhnlich ist auch die Struktur von tBu3PI2 im Festkörper: tBu3PII.
CS-Bindungsbruch in einem (π-Thiophen)ruthenium-Komplex†
- Pages: 947-948
- First Published: September 1987
Nucleophiler Angriff von H⊖ auf das Komplexkation 1, das ein π-gebundenes Thiophenderivat enthält, führt zum Bruch einer CS-Bindung und zur Bildung des neutralen Butadienthiolat-Komplexes 2. Analoge Reaktionen sind auch mit anderen Nucleophilen und Komplexen mit anders substituierten Thiophenliganden möglich. Dagegen bleiben bei Mn statt Ru die CS-Bindungen intakt. Diese Befunde könnten helfen, die katalytische Hydrodesulfurierung von Rohöl mechanistisch besser zu verstehen.
Nonaphenyltristiboxan-1,5-diyl-disulfonate†
- Pages: 948-949
- First Published: September 1987
Tristiboxane waren bisher nicht zugänglich. Reaktion (a) ermöglichte nun die Synthese der Tristiboxane 1, die in Lösung vermutlich mit anderen Phenylantimon-Spezies im Gleichgewicht vorliegen. Die beachtliche Unsymmetrie innerhalb der gewinkelten Sb-O-Sb-Brücken von 1a läßt sich auf die positive Partialladung der äußeren Antimonatome und die daraus resultierende stärkere Wechselwirkung mit den freien Elektronenpaaren des Brückensauerstoffatoms zurückführen.
Kolloidale Bimetallkatalysatoren: Pt-Au†
- Pages: 949-951
- First Published: September 1987
Weitgehend kristallin, einheitlich groß und homogen sind die Partikel, die aus Pt100-x-Aux-Solen (0 < × < 100) erhalten wurden. Der Au-Gehalt beeinflußt die mittlere Partikelgröße deutlich (A, x= 10; B, x=90; Länge der Linie oben links: 10 nm). Die katalytischen Eigenschaften nach Adsorption dieser Bimetallpartikel auf Graphit ähneln denen von nicht-kolloidalen Pt-Au-Katalysatoren. Doch sollte im kolloidalen System eine Feinabstimmung der Eigenschaften leichter möglich sein.
Trifluormethylisocyanid als Synthesebaustein-Reaktion mit Trifluoressigsäure und mit Hexafluoraceton†
- Pages: 951-953
- First Published: September 1987
N-Trifluormethylformamid 1 bzw. das Hexahydropyrrolo[3,4-d]imidazol 2 sind die Produkte der Titelreaktionen. 1 ist eine bei 116°C unzersetzt destillierbare Flüssigkeit und liegt im Unterschied zu N-Methylformamid in unpolaren Solventien bevorzugt als E-Isomer vor. Die praktisch quantitative Bildung von 2, dessen Struktur nur röntgenographisch aufgeklärt werden konnte, ist sehr überraschend.
Synthese und Struktur des Formaldehydkomplexes [(tmeda)Ni(C2H4)(H2CO)]†
- Pages: 953-954
- First Published: September 1987
Der Ethen und Formaldehyd enthaltende Titelkomplex 1 kann in bis zu 35% Ausbeute in Form orangeroter, bis −15°C beständiger Kristalle durch Umsetzung von Tris(ethen)nickel, Paraformaldehyd und N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin (TMEDA) erhalten werden. Im Unterschied zu Formaldehydkomplexen stärker oxophiler Metalle ist in 1 die NiC- kürzer als die NiO-Bindung (1.936(2) bzw. 1.966(1) Å). 1 interessiert als Modellverbindung für Zwischenstufen der Fischer-Tropsch-Synthese.
Synthese und Struktur von side-on-Ditellur-Nickelkomplexen
- Pages: 955-956
- First Published: September 1987
Eine relativ kurze TeTe-Bindung charakterisiert die Komplexe 1 und 2; sie lassen sich durch Umsetzung einer Polytellurid-Lösung mit Ni(ClO4)2·6H2O in Gegenwart des jeweiligen Liganden L in guter Ausbeute als dunkelrote Kristalle gewinnen. 2 reagiert dank der nur einseitigen Abschirmung der Te2-Einheit mit [(PPh3)2Pt(C2H4)] zum Zweikernkomplex [{PhP(CH2CH2PPh2)2} NiTe2Pt(PPh3)2].
Metallinduzierte Cyclotrimerisierung eines λ3-Phosphaalkins: Bildung eines Molybdän-komplexierten 1,3,5-Triphosphabenzols†
- Page: 956
- First Published: September 1987
Das hervorragende, dem von Alkinen analoge Synthesepotential der Phosphaalkine konnte mit der Titelreaktion einmal mehr demonstriert werden. Die Umsetzung von [(η6-C7H8)Mo(CO)3] mit tBuCP in THF ergibt den 1H- und 31P-NMR- sowie IR-spektroskopisch charakterisierten Komplex 1 in Form oranger Mikrokristalle. Die 31P-chemische Verschiebung des koordinierten η6-Triphosphabenzol-Liganden in 1 beträgt δ=25.2.
Metallinduzierte Cyclotrimerisierung eines λ3-Phosphaalkins: Bildung von Vanadium-komplexierten Valenzisomeren eines 1,3,5-Triphosphabenzols†
- Pages: 957-958
- First Published: September 1987
Ein partiell gespaltenes 1,3,5-Triphosphaprisman-Derivat 1 entsteht in der Koordinationssphäre von Vanadium, wenn tBuCP mit η6-Naphthalin(η5-pentamethylcyclopentadienyl)vanadium in THF umgesetzt wird. Das Triphosphaprisman-Derivat zeigt bei Raumtemperatur in Lösung dynamisches Verhalten, und es reagiert mit CO in einfacher Weise zu dem dunkelgrünen 1,3,5-Triphospha-Dewar-Benzol-Komplex 2.
Struktur und magnetische Eigenschaften eines Addukts aus Gadolinium-hexafluoracetylacetonat und dem Radikal 4,4,5,5-Tetramethyl-2-phenyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-oxid-1-oxyl†
- Pages: 958-959
- First Published: September 1987
Verzerrt dodekaedrisch umgeben acht O-Atome das Gd3⊕-Ion in 2, dem ersten stabilen Addukt aus einem organischen Radikal (1) und einem Lanthanoid-Ion. Aus der Temperaturabhängigkeit der magnetischen Suszeptibilität von 2 läßt sich eine schwache ferromagnetische Wechselwirkung zwischen GdIII und den ungepaarten Elektronen beider Radikale sowie eine antiferromagnetische Wechselwirkung zwischen den beiden Radikalen ableiten. An der magnetischen Wechselwirkung sind f-Metallorbitale beteiligt, wie eine Winkelüberlappungsanalyse ergab.
[(η4-Dien)Fe(CO)3]-Komplexe: Dynamische Prozesse auf der IR-Zeitskala
- Pages: 960-961
- First Published: September 1987
Komplexchemiker sollten die IR-Spektren ihrer Verbindungen öfter auf Temperaturabhängigkeit überprüfen. Denn während die IR-Spektren der Fe(CO)3-Komplexe mit Norbornadien und 1,5-Cyclooctadien bei Raumtemperatur trotz Cs-Symmetrie nur zwei CO-Banden zeigen, findet man bei ca. 10 K die erwarteten drei Banden etwa gleicher Intensität. Es handelt sich also um eine in der IR-Spektroskopie erstmals beobachtete Koaleszenz durch eine sehr schnelle intramolekulare Umlagerung, deren durch Spektrensimulation erhaltene Aktivierungsenergie nur ca. 2.2 kcal mol−1 beträgt.
Neue Bücher
Organotitanium reagents in organic synthesis (Reihe: Reactivity and structure, concepts in organic chemistry, band 24). Von M. T. Reetz. Springer, Berlin 1986. X, 236 S., geb. DM 168.00. — ISBN 3-540-15784-0
- Page: 965
- First Published: September 1987
Polymer Synthesis. Von P. Rempp und E. W. Merrill Hüthig & Wepf Verlag, Heidelberg 1986. 315 S., geb DM 96.00 – ISBN 3-853739-116-2
- Pages: 965-966
- First Published: September 1987
Science of ceramic chemical processing. Herausgegeben von L. L. Hench und D. R. Ulrich. John Wiley, New York 1986. 594 S., geb. $ 90.30. — ISBN 0-471-82645-6.
- Page: 966
- First Published: September 1987