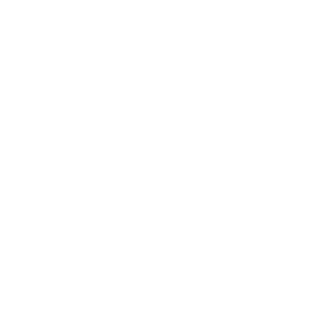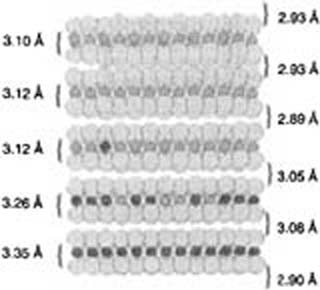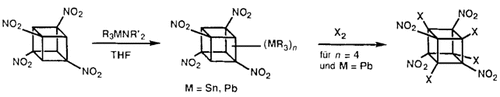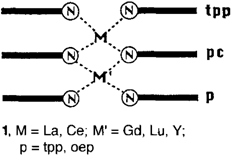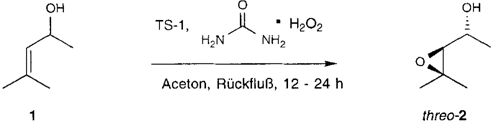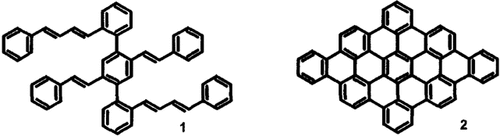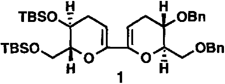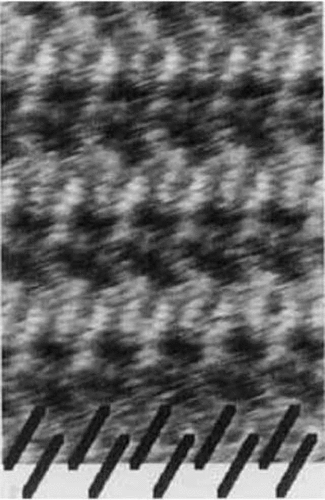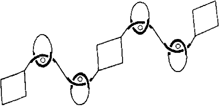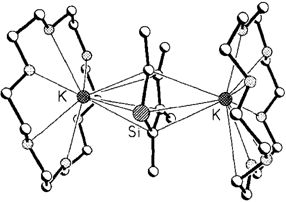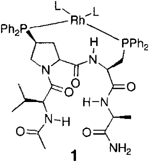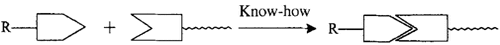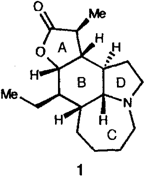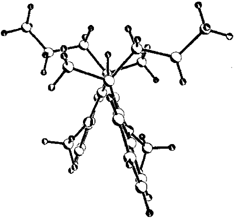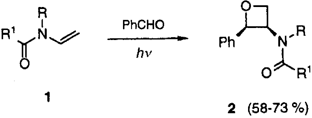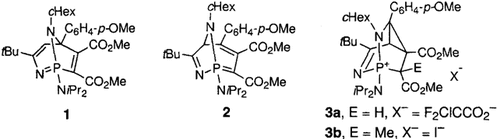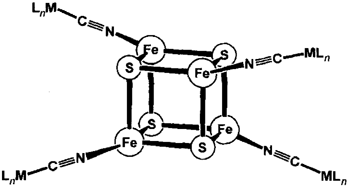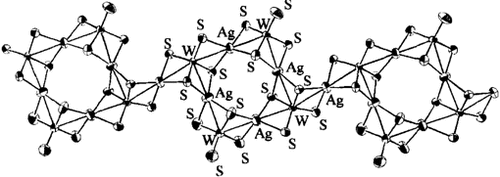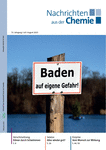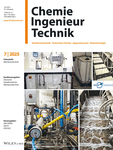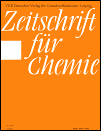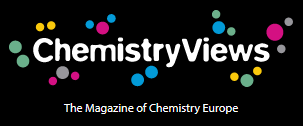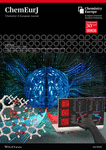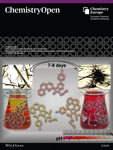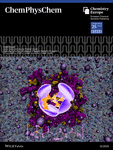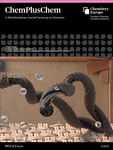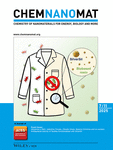Journal list menu
Export Citations
Download PDFs
Titelbild
Impressum
Graphisches Inhaltsverzeichnis
Aufsätze
Elektrospray-Massenspektrometrie von Biomakromoleülkomplexen mit nichtkovalenten Wechselwirkungen – neue analytische Perspektiven für supramolekulare Chemie und molekulare Erkennungsprozesse
- Pages: 878-899
- First Published: 18. April 1996
Schonende Ionisierungsmethoden, die zu vielfach geladenen Ionen intakter Komplexe ohne kovalente Wechselwirkungen führen, ermöglichen die direkte massenspektrometrische Analyse von Biomakromolekülkomplexen, z.B. Proteindimeren, Doppelstrang-Polynucleotiden und Enzym-Substrat-Komplexen, sowie von synthetischen Wirt-Gast-Systemen. Als Methode der Wahl zur Analyse von supramolekularen Strukturen in Lösung erwies sich die hier schwerpunktmäßig besprochene Elektrospray-Massenspektrometrie.
Hauptgruppenelementanaloga von Carbenen, Olefinen und kleinen Ringen
- Pages: 900-929
- First Published: 18. April 1996
Kohlenstoff ist ein „exotisches”︁ Element. Zu diesem Schluß gelangt man beim Vergleich der Strukturen und der elektronischen Eigenschaften von Olefinen, Cyclopropanen und Bicyclo[l.1.0]butanen mit analogen Verbindungen von Elementen oder Verbindungsfragmenten X, Y der 3.–5. Hauptgruppe (siehe rechts), die häufig aus ihren Carbenanaloga synthetisiert werden können. Strukturverzerrungen in Doppelbindungssystemen können mit dem Carter-Goddard-Malrieu-Trinquir (CGMT)-Modell beschrieben werden. Regeln mit umfassenderer Gültigkeit zur Vorhersage von Strukturen und elektronischen Eigenschaften lassen sich besser aus Studien an Verbindungen der schweren Hauptgruppenelemente ableiten.
Highlights
Trennen, Charakterisieren und Fraktionieren mit Nanolitermengen in der Kapillarelektrophorese
- Pages: 931-933
- First Published: 18. April 1996
Immer kleiner, immer weniger, das ist die Devise der Kapillarelektrophorese, wie hier an einigen der neuesten Entwicklungen aufgezeigt wird. Sowohl die Verknüpfung der Trennung kleinster Substanzmengen mit der eindeutigen spektroskopischen Charakterisierung der Komponenten als auch die Handhabung einzelner Molekule sind dank neuester Entwicklungen nicht mehr völlig utopisch.
Übergitter, dünne Filme und kontrollierte Materialsynthese – ein mechanistischer Ansatz
- Pages: 933-935
- First Published: 18. April 1996
Modulierte Dünnschichtsysteme bieten die Grundlage für eine neue, rationale Strategie zur kontrollierten Herstellung komplexer metastabiler Strukturen. Durch sequentielles Abscheiden der gewünschten Elemente und anschließendes thermisches Behandeln lassen sich gezielt Überstrukturen wechselnder Zusammensetzung synthetisieren. Das Bild zeigt ein Niobtitanselenid mit von oben nach unten zunehmendem Niobgehalt (zunehmende Intra- und Interschichtabstände; gezeigt ist eine Hälfte der Elementarzelle des Übergitters).
Zuschriften
Durch β-Nitrosubstituenten stabilisierte Anionen: zur Acidität und ortho-Metallierung von Nitrocubanen – Penta- und Hexanitrocubane†
- Pages: 937-940
- First Published: 18. April 1996
Die erste direkte Metallierung einer durch Nitrogruppen aktivierten ß-C-H-Bindung gelang bei der Umsetzung von 1,3,5,7-Tetranitrocuban 1 mit Basen (siehe unten). Das so erhaltene ß-Nitrocarbanion konnte zur Synthese von Penta- (2) und Hexanitrocubanen, den ersten Cubanen mit vicinalen Nitrogruppen, genutzt werden.
Stabile Zinn- und Bleiderivate von Nitrocubanen und ihre Verwendung zur Mehrfachfunktionalisierung†
- Pages: 940-942
- First Published: 18. April 1996
Die ß-Metallierung von Nitrocubanen mit Zinn- oder Bleiamiden ermöglichte den Zugang zu einer Reihe (n = 1–4) stabiler Stannyl- bzw. Plumbylcubane. Durch geeignete Spaltung der Cubyl-Blei-Bindungen wurden Tetrahalogentetranitrocubane sowie Penta- und Hexanitrocubane erhalten (siehe unten; R = Me, Et; R' = Et, SiMe3; × = Br, I).
Heteronucleare Tripeldeckerkomplexe mit dem Ligandensystem Porphyrin/Phthalocyanin/Porphyrin†
- Pages: 942-944
- First Published: 18. April 1996
An einem Metallatom oder am Phthalocyanin(pc)- Liganden findet die erste Oxidation der heteronuclearen Tripeldeckerkomplexe vom Typ 1 statt, je nachdem ob sie ein oxidierbares CeIII-Ion enthalten oder nicht. Mit 1, M = Ce, M' = Gd, p = oep, gibt es nun auch den ersten röntgenographisch charakterisierten derartigen heteronuclearen Tripeldecker- komplex.
Chemo- und diastereoselektive Epoxidierung von chiralen Allylalkoholen mit dem Wasserstoffperoxid-Harnstoff-Addukt (UHP), katalysiert durch das Titansilicalit TS-1†
- Pages: 944-947
- First Published: 18. April 1996
Der threo-Epoxyalkohol 2 ist das bevorzugte Produkt bei Epoxidierungen chiraler Allylalkohole 1, wenn das Titansilicat TS–1 als heterogener Katalysator und das Harnstoff-Wasserstoff-Addukt als Sauerstoffquelle verwendet werden. Der Hydroxy-dirigierende Effekt wird durch die Bildung einer Wasserstoffbrückenbindung erklärt, analog dem bei Epoxidierungen mit Persäure auftretenden Mechanismus.
Polybenzoide C54-Kohlenwasserstoffe – Synthese und Strukturcharakterisierung in geordneten monomolekularen Aufdampfschichten†
- Pages: 947-950
- First Published: 18. April 1996
Einen einfachen Zugang zu den Titelverbindungen, z.B. 2, bietet die elegante, struktur- beweisende Cycloadditions-Cyclodehydrierungs-Route (1 → → → 2). Die Hitze- beständigkeit der großen, polybenzoiden C54-Kohlenwasserstoffe ermöglicht ihre Charakterisierung in geordneten monomolekularen Aufdampfschichten durch Rastertunnelmikroskopie und Elektronenbeugung.
Das „nackte”︁ Uranyl(2+)-Kation UO22+†
- Pages: 950-952
- First Published: 18. April 1996
Durch Ion-Molekül-Reaktionen zwischen U2+ und Sauerstoffdonoren oder durch „Charge-stripping”︁-Kollisionen zwischen einfach geladenen UO+2-Ionen und O2,- Stoßpartnern lassen sich Uranyl(2 + )-Kationen in der Gasphase erzeugen. Diese dissoziieren nicht in einfach geladene Fragmente. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen von ab-initio-Rechnungen wurde die Standardbildungsenthalpie von UO2+2 zu 371 ± 60 kcal mol−1 bestimmt.
Kupfer(I)-unterstützte Stille-Kupplung von α-stannylsubstituierten Enolethern mit Enoltriflaten: Aufbau von komplexen Polyethergerüsten†
- Pages: 952-955
- First Published: 18. April 1996
Ein sehr einfacher und effizienter Weg zu Bitetrahydropyranyl-Systemen wie 1 wird hier beschrieben. Die Kupplung eines α-stannylsubstituierten Enolethers mit einem Enoltriflat in Gegenwart katalytischer Mengen [Pd(PPh3)4] sowie von CuCl und K2CO3, im Überschuß bei Raumtemperatur liefert in guten Ausbeuten auch komplexe Polyetherstrukturen, wie unter anderem an einem Strukturelement von Maitotoxin gezeigt werden konnte.
Direkte Beobachtung von aus Enantiomeren aufgebauten enantiomorphen Monoschicht-Kristallen mit der Rastertunnelmikroskopie†
- Pages: 955-957
- First Published: 18. April 1996
Die Bildung chiraler Strukturen aus achiralen oder racemischen Bestandteilen ist von großer Bedeutung z.B. hinsichtlich des Ursprungs der biologischen Chiralität. Monoschichten racemischer Moleküle können chirale Strukturen bilden, aber der Ursprung dieser Strukturen war nicht bekannt. Die kraftmikroskopische Abbildung der Oberflächenstrukturen von beiden Enantiomeren ((S)-Enantiomer rechts gezeigt) und dem Racemat einer flüssigkristallinen Verbindung mit der Rastertunnelmikroskopie liefert deutliche Hinweise darauf, daß das Racemat Domänen aus enantiomerenreinen Molekülen bildet.
Mehrkomponenten-Molekülsysteme aus Porphyrinen und Kupfer(I)-Komplexen: simultane Synthese von [3]- und [5]Rotaxanen†
- Pages: 957-960
- First Published: 18. April 1996
Kupfer(I)-Templat-katalysiert gelang die Synthese von Rotaxanen, die chelatisierende Phenanthrolingruppen in den Ringen sowie in der Kette und endständige sowie verbrückende Porphyrineinheiten enthalten. Rechts ist schematisch ein [5]Rotaxan dargestellt: ○ = Cu1, fett hervorgehoben = Phenanthrolin, ◊ = Porphyrin.
Silolyl-Anionen und Silol-Dianionen: Struktur von [K([18]krone-6)+]2C4Me4Si2−†
- Pages: 960-962
- First Published: 18. April 1996
Nahezu gleich lange C-C-Bindungen im Dianion C4Me4Si2−, das als Kaliumsalz in Gegenwart von [18]Krone-6 kristallin erhalten werden konnte (Strukturbild rechts), sind ein deutlicher Hinweis auf ein delokalisiertes π-Elektronensystem in diesem Heterocyclus. 29Si- und 13C-NMR-spektroskopische Untersuchungen der Silolyl-Anionen C4Me4SiR− (R = SiMe3, Si(SiMe3)C4Me4) dagegen zeigen, daß die Delokalisierung der π-Elektronen in diesen Systemen nur wenig ausgeprägt 1st.
Propargylierung von Carbonylverbindungen durch Umpolung von Propargylpalladiumkomplexen mit Diethylzink
- Pages: 962-963
- First Published: 18. April 1996
Synthese von Thiophosphorylprolinen als Bausteine für phosphanylsubstituierte Peptide mit β-Turns†
- Pages: 963-966
- First Published: 18. April 1996
Aminosäuren mit koordinierenden Phosphanylgruppen sind als Bausteine für Peptid-Metallkomplexe sehr vielversprechend. So wurden geschützte phosphanylsubstituierte Prolinderivate synthetisiert und in ein kurzes Peptid mit β-Turn-Struktur eingebaut. Die Struktur des Rh-Komplexes 1 mit einem solchen Peptidliganden wurde 2D-NMR-spektroskopisch charakterisiert.
Der Einfluß von Substituenten auf die durch Wasserstoffbrückenbindungen induzierte Bildung von Flüssigkristallen†
- Pages: 966-968
- First Published: 18. April 1996
Derivate von Pyridin und Benzoesäure können über Wasserstoffbrückenbindungen assoziieren (siehe unten), und es entstehen mitunter flüssigkristalline Systeme. Durch systematische Variation der Benzoesäuresubstituenten fand man das Knowhow: Schwach elektronenziehende Substituenten in der Benzoesäure induzieren den flüssigkristallinen Zustand am besten, wenn das Pyridin donorsubstituiert ist.
Untersuchungen zur asymmetrischen Synthese von Stemona-Alkaloiden: Totalsynthese von ()-Stenin†
- Pages: 968-970
- First Published: 18. April 1996
Synthese Bor-reicher Lysindendrimere zur Proteinmarkierung in der Elektronenmikroskopie†
- Pages: 970-973
- First Published: 18. April 1996
Ein neuartiges, dendrimerchemisches Verfahren für die Synthese von Markermolekülen mit acht Carboranylaminosäuren (MeCBA) (siehe rechts) überwindet die Unannehmlichkeiten bei der Synthese linearer Peptidkonstrukte. Markermoleküle dieses Typs sollten sich vorteilhaft in der Elektronenmikroskopie einsetzen lassen. R = geschützter Peptidrest.
Der erste chirale, C2-symmetrische Monomethinfarbstoff – eine scheinbare Verletzung der Helicitätsregeln für die optische Rotation†
- Pages: 973-975
- First Published: 18. April 1996
P-helical verdrillt ist der Chromophor des chiralen Monomethins (R,R)-l (Strukturbild rechts). Der negative Cotton-Effekt der Cyaninbande steht dabei in scheinbarem Widerspruch zu anerkannten Helicitätsregeln. Quantenmechanische Rechnungen sowie eine Komponentenanalyse bestätigen jedoch die experimentellen Befunde und stützen damit überraschenderweise diese Regeln. × = (CCH3)C3H2, Gegenion: CIO4−.
N-Acyl-Enamine in der Paternò-Büchi-Reaktion – stereoselektive Herstellung von 1,2-Aminoalkoholen durch C-C-Verknüpfung†
- Pages: 976-977
- First Published: 18. April 1996
Unter photochemischer Umpolung der Carbonylkomponente sind durch die Titelreaktion N-substituierte, α,β- difunktionelle Aminooxetane 2 durch C-C-Verknüpfung zugänglich. Die Umsetzung liefert mit geeigneten Alkenen l die Produkte in guten Ausbeuten und mit ausgezeichneten Regio- und Diastereoselektivitäten. R = H, Alkyl; R1 = Alkyl, OtBu.
[5+2]-Cycloaddition eines cyclischen N-Phosphino-1-azadiens: Synthese, Struktur und Reaktivität des ersten siebengliedrigen Iminophosphorans†
- Pages: 977-979
- First Published: 18. April 1996
Bildung eines neuartigen μ-Nonasulfidoliganden und dessen Abbau zu einem μ-Disulfidoliganden in einem Diiridiumkomplex†
- Pages: 979-981
- First Published: 18. April 1996
Aus erstaunlicherweise neun S-Atomen besteht der verbrückende Polysulfidoligand im Diiridiumkomplex 1, der durch Umsetzung von [Cp*Ir(μ-SiPr)2IrCp*] mit S8 hergestellt wurde und dessen Struktur im Kristall rechts dargestellt ist. Mit NaBPh4 wird der Nonasulfidoligand in einen verbrückenden Disulfidoliganden umgewandelt, was mit einer Ein-Elektronen-Oxidation der Diiridiumeinheit unter Bildung des paramagnetischen Diiridiumkomplex-Kations [Cp*Ir(p-SiPr)2(μ-S2)- IrCp*]+ einhergeht. Cp* = C5Me3. [Cp*Ir(μ-SiPr)2(μ-S9)IrCp*] 1
Carbenkomplexe des zweiwertigen Chroms†‡
- Pages: 981-983
- First Published: 18. April 1996
Einfach durch Addition von Halogenwasserstoffen an die Metall-Kohlenstoff-Dreifachbindung von [(μ5-C5)(CO)2 Cr=CNipr2]l konnten die ersten Carbenkomplexe 1 des zweiwertigen Chroms (R = H, Me; X= Cl, Br)selektiv erhalten werden. Mit Isocyaniden, Phosphanen und Phosphiten reagieren sie zu thermisch stabilen, kationischen CrII-Carbenkomplexen.
Kombination der Fe4S4- und M-CN-Fe-Redoxfunktionen†
- Pages: 984-985
- First Published: 18. April 1996
Ungewöhnlich niedrige magnetische Momente weisen die achtkernigen [Fe4S4(NC-MLn)4]-Cluster des nebenstehend gezeigten Typs im Vergleich zu anderen Fe4S4-Komplexen oder den Ferredoxinen auf. Die neuen Verbindungen sind redoxaktiv und enthalten Eisenzentren der Oxidationsstufe +2.5, was sich unter anderem an starken Intervalenz-Transfer-Absorptionen zeigt.
Aus Tetrathiowolframat und Silber(I) gebildete polymere Heterometall-Clusterverbindungen: Synthese und Kristallstruktur von {[AgWS4]}n[NH4]n und {[W4Ag5S16]}n-[M(DMF)8]n (M = Nd und La)†
- Pages: 985-987
- First Published: 18. April 1996
Aus achtkernigen, cyclischen Clusterfragmenten [W4Ag4S16]4−, verknüpft durch Ag+-Ionen, ist das unten gezeigte, eindimensionale, kettenförmige, polymere Anion aufgebaut. Zwischen den Ketten eingelagert sind Lanthanoid(III)-Ionen (Nd und La), die von acht DMF-Liganden umgeben sind und die bei der Bildung der Clusterverbindung eine entscheidende Rolle spielen.
Bücher
Enzyme Catalysis in Organic Synthesis, Vols. 1 and 2. A Comprehensive Handbook. Herausgegeben von K. Drauz und H. Waldmann. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1995, 1050 S., geb. 498.00 DM/475.00 $. – ISBN 3-527-28479-6
- Page: 989
- First Published: 18. April 1996
Aspekte der Organischen Chemie. Band 1. Struktur. Herausgegeben von G. Quinkert, E. Egert und E. Griesinger. Verlag Helvetica Chimica Acta, Basel, 1995. 503 S., geb. 148.00 DM. – ISBN 3-906390-II-X
- Page: 990
- First Published: 18. April 1996
Konzepte der Anorganischen Chemie. Von S. M. Owen und A. T. Brooker. Vieweg Verlag, Braunschweig/Wiesbaden, 1994. 261 S., Broschur 49.50 DM. – ISBN 3-528-06559-1
- Pages: 990-991
- First Published: 18. April 1996