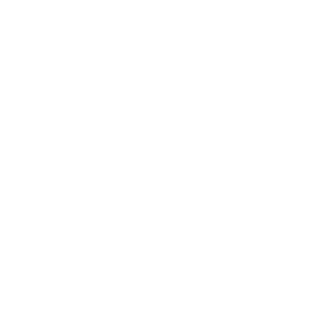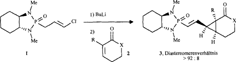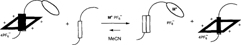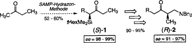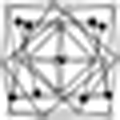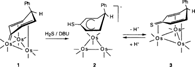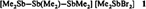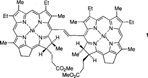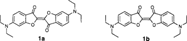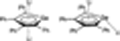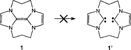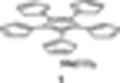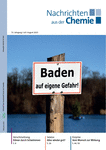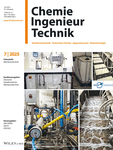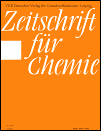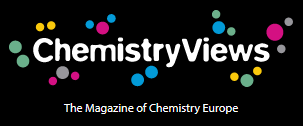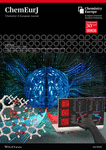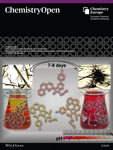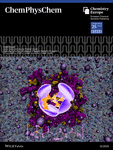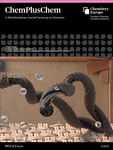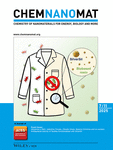Journal list menu
Export Citations
Download PDFs
Titelbild
Impressum
Graphisches Inhaltsverzeichnis
Aufsätze
Der Mechanismus der Claisen-Umlagerung – ein Déjà-vu
- Pages: 1014-1023
- First Published: 3. Mai 1996
Wie kann ein Enzym eine pericyclische Reaktion beschleunigen? Die Beantwortung dieser Frage und der, wie Lösungsmittel und Katalysatoren die Claisen-Umlagerung beeinflussen, liefert wichtige Informationen zum Reaktionsmechanismus und zeigt, daß die Fachwelt schlecht daran getan hat, diese Effekte zu ignorieren.
Protonierung von ungesättigten Kohlenwasserstoffliganden: Regio-, Stereo- und Produktspezifität
- Pages: 1024-1046
- First Published: 3. Mai 1996
Zur Aufklärung der vielfältigen Mechanismen, nach denen Kohlenwasserstoff-Übergangsmetall-Komplexe protoniert werden, haben besonders kinetische Analysen beigetragen. So sind die erzielbaren Selektivitäten bei der Freisetzung der Kohlenwasserstoffe nur selten auf den einfachen regio- und stereospezifischen Angriff eines Protons zurückzuführen, sondern hängen maßgeblich davon ab, ob zunächst das Metallatom oder der Kohlenwasserstoffligand protoniert wurde, und davon, welche Reaktionen (H-Wanderung, Deprotonierung, Zweitprotonierung usw.) sich anschließen.
Highlights
Metallorganische “Kohlenstoffstangen” – ein Längenrekord
- Pages: 1047-1049
- First Published: 3. Mai 1996
Neues bei enantioselektiven Synthesen von Cyclopropanen
- Pages: 1049-1051
- First Published: 3. Mai 1996
Als neuartiges chirales Vinylcarben-Äquivalent verwenden S. Hanessian et al. das optisch aktive Chlorallylphosphonsäureamid 1. Nach Deprotonierung addiert es sich an α,β-ungesättigte Carbonylverbindungen 2, R = H, Me, und liefert hochfunktionalisierte Cyclopropanderivate 3 mit hoher Enantiomerenreinheit. Das Substitutionsmuster der Cyclopropanderivate prädestiniert sie als Ausgangsmaterialien für viele Synthesen.
Zuschriften
Ein Prototyp eines optisch reagierenden molekularen Schalters auf Pseudorotaxan-Basis†
- Pages: 1053-1056
- First Published: 3. Mai 1996
Ein negativer allosterischer Effekt tritt in einem [2]Pseudorotaxan auf, das ein 1,5- Dioxynaphthalinderivat mit einer [18]Krone-6-Endgruppe enthält, wenn diese K +- Ionen komplexiert. Dieser Effekt kann genutzt werden, um eine optische Reaktion hervorzurufen, die UV-spektroskopisch verfolgt werden kann; das Prinzip ist unten schematisch gezeigt.
Einfache molekulare Maschinen: chemisch gesteuertes Ausfädeln und Rückeinfädeln eines [2]Pseudorotaxans†
- Pages: 1056-1059
- First Published: 3. Mai 1996
Das Ausfädeln des 2,7-Dibenzyldiazoniapyren-Dikations 22+ aus dem Pseudorotaxan 12+ gelingt durch Zugabe eines aliphatischen Amins A; Protonierung des Amins unterbricht die Wechselwirkung zwischen A und 22+ wieder, wodurch sich 22+ erneut in die 1,5-Dinaphtho-[38]krone-l0 3 einfädeln kann, was den gesamten Prozeß reversibel gestaltet. Die Änderung der relativen Positionen der Komponenten kann durch Absorptions- und Lumineszenzspektroskopie verfolgt werden.
Effiziente regio- und enantioselektive Mannich-Reaktionen†
- Pages: 1059-1062
- First Published: 3. Mai 1996
Über die leicht zugänglichen Silylketone (S)-1 gelingen die ersten praktikablen asymmetrischen Mannich-Reaktionen zur regio- und hochenantioselektiven α-Aminomethylierung von Ketonen. Die synthetisch und pharmazeutisch wertvollen Mannich-Basen (R)-2 werden in ausgezeichneten Ausbeuten und hohen Enantiomerenüberschüssen erhalten. tHex = 1,1,2-Trimethylpropyl.
Hückel-Arene mit zehn π-Elektronen: Die cyclischen Zintl-Anionen Si610− und Ge610−, isoster mit P64− und As64−
- Pages: 1062-1064
- First Published: 3. Mai 1996
Neue Zintl-Anionen X610− (X = Si, Ge) treten in den Verbindungen Ba4Li2Si6, Ba4Li2Ge6 und Ba10Ge7O3 auf. Die Bindungsverhältnisse in den Anionen sowie deren Wechselwirkungen mit den Kristallfeldern können mit Hilfe der Elektronen- Lokalisierungs-Funktion (ELF) beschrieben werden, deren Verlauf kovalente Bindungen, n-Elektronenpaare und Rumpfschalen sichtbar macht. Das Auftreten der sechsgliedrigen Si- und Ge-Ringe belegt, daß 10π-Elektronen-Hückel-Arene bei höheren Elementen der Gruppe 14 eine Alternative zur Bildung diskreter Doppelbindungen sind.
Molekulare, schalenartig aufgebaute Dilithium(silyl)phosphandiid- und Dilithium(silyl)arsandiid-Aggregate mit einem [Li6O]4+-Kern†
- Pages: 1064-1066
- First Published: 3. Mai 1996
Lithiumreiche Hauptgruppenelementcluster charakterisieren die Verbindungen 1 und 2 (rechts: Struktur von 1 ohne Silylsubstituenten; schwarz = P, O, weiß = Li), die durch Lithiierung des entsprechenden primären Silylphosphans bzw. -arsans mit nBuLi in Gegenwart von Li2O erhalten werden. Die Gerüste von 1 und 2 werden als zwei interpenetrierende Schalen von silylierten P- bzw. As-Dianionen und Li-Kationen mit der Formalladung −4 beschrieben, die einen [Li6O]4+-Oktaeder beherbergen.
[(RP)8Li18O] 1, R = iPr2(Mes)Si
[(RAs)12Li26O] 2, R = Me2(iPrMe2,C)Si
Koordinationschemie im Festkörper: Hydrothermalsynthese von Vanadiumoxiden mit Schichtstruktur und intercalierten Metallkomplexen†
- Pages: 1067-1069
- First Published: 3. Mai 1996
Eine neue Klasse von Feststoffen sind die durch Hydrothermalsynthese erhaltenen Verbindungen (L2M)y[VOx] (mit L = zweizähniges Amin, M = Cu oder Zn), die aus gemischtvalenten Vanadiumoxidschichten mit intercalierten Komplexen aufgebaut sind. Ein Ausschnitt aus der Kristallstruktur einer entsprechenden Verbindung mit M = Cu und L = Ethylendiamin ist rechts gezeigt.
[Os10(CO)24{Au(PPh2R)}4]: ein röhrenförmiger Carbonylosmium-Heterodimetallcluster†
- Pages: 1070-1071
- First Published: 3. Mai 1996
Schwächere Os-Os-Bindungen als in konventionellen mehrkernigen Os-Clustern sind die Besonderheit des röhrenförmigen Clusterkerns der Titelverbindungen (R = Me, Ph). Die Bindungslängen sind im Falle von R=Me durch Röntgenstrukturanalyse (Bild rechts, Phosphanliganden an den Au-Zentren weggelassen) abgesichert. Erhalten werden diese Verbindungen durch Reduktion des Dianions [OS10(CO)26]2− und anschließende Addition des Kations [Au(PPh2R)]+.
Reaktionen zwischen einem Triosmiumcluster mit side-on koordiniertem Carbenliganden und Schwefelverbindungen unter Bildung eines Thioketonkomplexes†
- Pages: 1071-1073
- First Published: 3. Mai 1996
Unter Bildung des Thiolkomplexes 2 reagiert der side-on koordinierte Carbenligand des Clusterkomplexes 1 mit H2S/DBU. Bei Abstraktion eines Hydridions aus dem Komplex 2 entsteht in einer reversiblen Reaktion der Thioketonkomplex 3. Als Mechanismus wird vorgeschlagen, daß während der Hydridabstraktion mit [Ph3C] [BF4] zuerst ein Proton von der Thiolgruppe auf den anionischen Cyclohexadienylring übertragen und das Wasserstoffatom schließlich als Hydridion entfernt wird. DBU = 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en.
Na14K6Tl18M (M = Mg, Zn, Cd, Hg) und Na13.5Sm0.5K6Tl18Na: neuartige Phasen vom Mg2Zn11-Strukturtyp mit oktaedrischen und zentriert-ikosaedrischen Clustern†
- Pages: 1073-1076
- First Published: 3. Mai 1996
Die kubischen Zintl-Phasen Na14K6Tl18M (M = Mg, Zn) sind nicht nur Abkömmlinge von Na4K6Tl13, sondern auch isostrukturell mit den intermetallischen Verbindungen Mg2Zn11, Mg2Al5Cu6 und Na2In5Au6. Im Strukturausschnitt sind die isolierten Tl-Oktaeder und -Ikosaeder, deren elektronische Eigenschaften sich durch Variation der Kationen M gut verändern lassen, durch Polyederdarstellungen hervorgehoben.
Charge-Transfer-Wechselwirkungen in farbigen Kristallen aromatischer Carbonsäuren und deren Relevanz für die MALDI-Massenspektrometrie†
- Pages: 1076-1078
- First Published: 3. Mai 1996
Ein altes Thema wird wieder aktuell: Durch „Beimengungen”︁ gefärbte Kristalle aromatischer Carbonsäuren sind zwar aus dem wissenschaftlichen Dialog verschwunden, erneute Bedeutung gewinnen derartige Mischkristalle jedoch als „überlegene”︁ Modellsysteme zur Untersuchung der Wirt-Gast-Wechselwirkungen, die in der MALDI-Massenspektrometrie eine entscheidende Rolle spielen. Die Orientierung absorbierter Farbstoffe läß sich mit Polarisationsspektroskopie bestimmen, und die Rolle der Ladungsübertragung wird anhand der Kristallstruktur von Malachitgrün-Hydrogenphthalat diskutiert.
Eine neuartige ferrimagnetische Heterodimetall-Schichtverbindung†
- Pages: 1079-1080
- First Published: 3. Mai 1996
Durch Verknüpfung von Mangan(II)- und Kupfer(II)-Ionen mit dem Dianion von 2,2-Bis(methylthio)-methylidenmalonsäure lassen sich ferrimagnetische Schichtverbindungen herstellen. Die Schichten sind über Schwefel-Schwefel-Wechselwirkungen zwischen den Methylthio-Seitenarmen der Liganden gestapelt; ein Ausschnitt aus der Kristallstruktur ist rechts gezeigt.
Ein dreikerniges Organoantimon-Kation; Struktur von [Me2Sb–Sb(Me2)–SbMe2]-[Me2SbBr2]†
- Pages: 1081-1082
- First Published: 3. Mai 1996
Synthese von neuartigen difluorierten Prostacyclinen - Erhöhung der Stabilität durch Fluorsubstituenten†
- Pages: 1082-1084
- First Published: 3. Mai 1996
Außerordentlich stabil ist das Difluorprostacyclin 1, das in In-vitro-Tests die ADP-induzierte Aggregation menschlicher Blutplättchen effektiver als alle anderen bekannten Prostacyclin-Derivate inhibiert. Schlüsselschritte in der Synthese von 1 sind die Fluorierung des Corey-Lactons mit (PhSO2)2NF in Gegenwart von MgBr2 und die anschließende Einführung der α-Seitenkette durch eine Wittig-Reaktion.
Synthese und Charakterisierung von Bischlorinen – McMurry-Reaktion von Formylchlorinen†
- Pages: 1085-1087
- First Published: 3. Mai 1996
Die ersten Ethylen-verbrückten Bischlorine (z.B. 1) wurden durch Kupplung von NiII- oder ZnII-Formylchlorinen mit niedervalentem Titan erhalten. Mit O2 in Toluol/Essigsäure unter Rückfluß werden sie partiell zu trans-Chlorin-Porphyrin- Verbindungen oder vollständig unter Isomerisierung zum entsprechenden cis-konfigurierten Bischlorin oxidiert.
Ein doppeltes Calix[4]aren in 1,3-alternate-Konformation†
- Pages: 1088-1090
- First Published: 3. Mai 1996
Oxindigo: Farbvertiefung, starke Fluoreszenz und großer Stokes-Shift durch Donorsubstitution†
- Pages: 1090-1093
- First Published: 3. Mai 1996
Das erste Carboran mit Kuboktaederstruktur†
- Pages: 1093-1095
- First Published: 3. Mai 1996
Als Zwischenstufen der Umlagerung von ikosaedrischen 1,2-Carboranen in entsprechende 1,7-Carborane wurden von Lipscomb Carborane mit kuboktaedrischer Struktur postuliert. Ein solches Carboran, (CSiMe3)4B8H4, wurde nun hergestellt und charakterisiert (Struktur im Kristall siehe rechts). Die Stabilität dieser Verbindung und geringfügige Abweichungen des C4B8-Gerüstes von der Kuboktaedergeometrie können zwanglos mit dem sterischen Anspruch der Silylsubstituenten erklärt werden.
Das Dianion von Tetraphenylgermol ist aromatisch†
- Pages: 1095-1097
- First Published: 3. Mai 1996
Nicht eine, sondern zwei Strukturen bildet Li2([PhC]4Ge) beim Kristallisieren aus Dioxan. In der einen (im Bild links) sind beide Lithiumionen an alle Ringatome η5-koordiniert und befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten des Germolringes. Im zweiten Isomer (rechts)) ist nur ein Lithiumatom an alle Ringatome η5-gebunden, während das zweite an das Germaniumzentrum η5-koordiniert ist.
Ein stabiles Tetraazafulvalen†
- Pages: 1098-1100
- First Published: 3. Mai 1996
Eine richtige Doppelbindung zwischen den beiden Imidazol-2-yliden-Hälften kennzeichnet das bei Raumtemperatur stabile Tetraazafulvalen 1, dessen Dissoziation zu 1′ nicht nachzuweisen ist, obwohl die Bindungsstärke auf nur wenige kcal mol−1 geschätzt wird. Diese stimmt gut mit theoretischen Vorhersagen überein, die von einer sehr großen Singulett-Triplett-Energiedifferenz in Imidazol-2-ylidenen ausgehen. Die Dissoziation nicht- oder unterschiedlich überbrückter Tetraazafulvalene ist somit ein Entropie-getriebener Prozeß.
Metallierte Tetra- und Penta(cyclopentadienyl)-cyclopentadienyle: Synthese durch Pd-katalysierte Mehrfach-Cyclopentadienylierung†
- Pages: 1100-1102
- First Published: 3. Mai 1996
In einem Schritt gelingt die Synthese des Penta(cyclopentadienyl)cyclopentadienyl-Komplexes 1 aus [Mn(η5-C5I5)(CO)3] und CpSnMe3. Mit BuLi konnte 1 glatt zum entsprechenden neuartigen Pentaanion umgesetzt werden. Wegen ihrer Topographie sind diese Verbindungen im Hinblick auf Synthesen von metallierten Semibuckminsterfullerenen und Metallobuckminsterfullerenen interessant.
Bücher
Chemistry of Waste Minimization. Herausgegeben von J. H. Clark. Blackie Academic & Professional, Glasgow, 1995. 554 S., geb. £ 89.00.—ISBN 0-7514-0200-6
- Page: 1103
- First Published: 3. Mai 1996