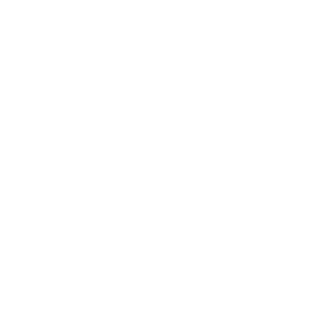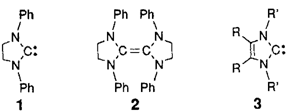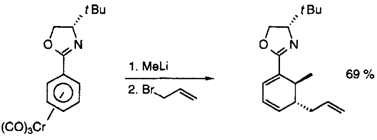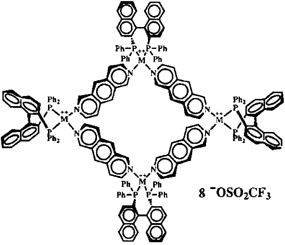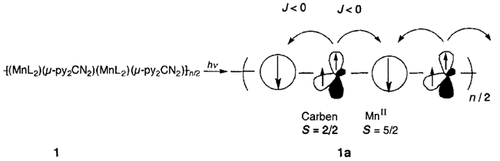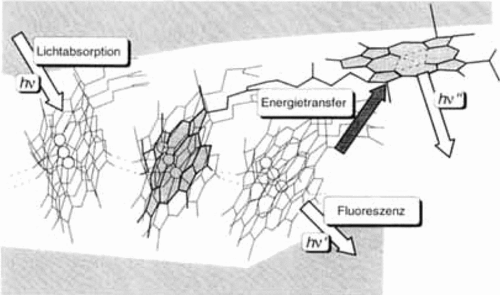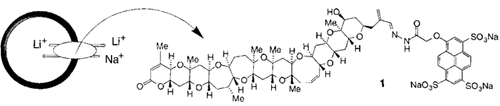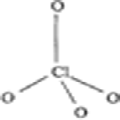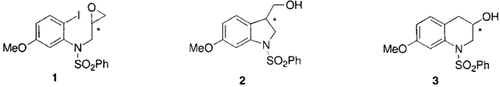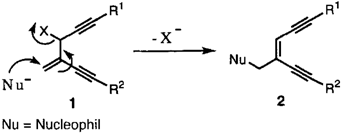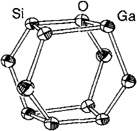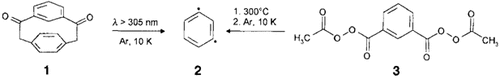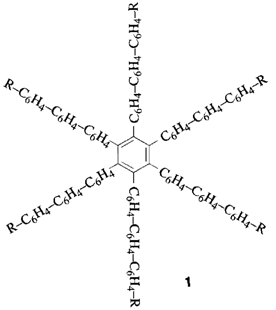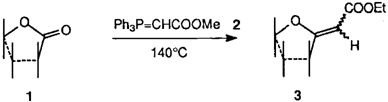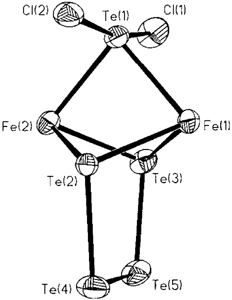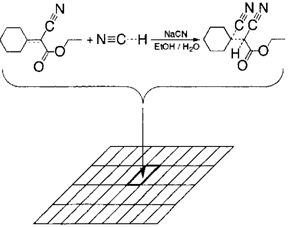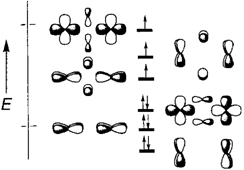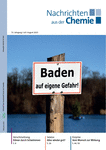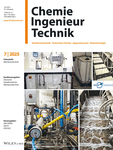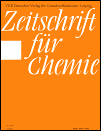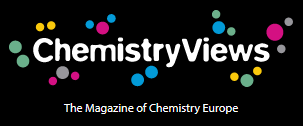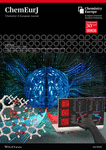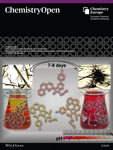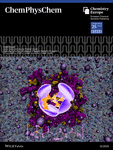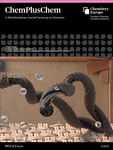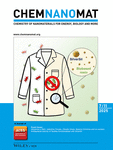Journal list menu
Export Citations
Download PDFs
Titelbild
Impressum
Graphisches Inhaltsverzeichnis
Aufsätze
Anorganische Materialien mit Hilfe von Rastersondenmikroskopen verstehen und manipulieren
- Pages: 748-768
- First Published: 3. April 1996
Warum sich die Sprungtemperaturen von Supraleitern unterscheiden, wie sich Ladungsdichtewellen in Feststoffen aufbauen und wie deren Struktur von Verunreinigungen abhängt, all dies läßt sich mit Hilfe von Rastersondenmikroskopen herausfinden. Daß diese auch zur gezielten Manipulation von Feststoffen eingesetzt werden können – etwa bei der „Synthese”︁ von Nanostrukturen – läßt für die Zukunft eine Reihe neuer Anwendungen erwarten.
Enzyme — Mechanismen, Modellreaktionen und Mimetica
- Pages: 770-790
- First Published: 3. April 1996
Wie man chemische Reaktionen sauber und ökonomisch durchführt – selbstverständlich mit vollständiger Kontrolle des stereochemischen Verlaufs! – kann man von Enzymen, den wohl überragendsten Katalysatoren, lernen und die dabei gewonnenen Erkenntnisse beim Design von künstlichen Enzymen nutzbringend umsetzen. Bei der Bewertung des gegenwärtigen Stands der Entwicklung von Enzymmimetica wird allerdings klar, daß noch vieles unverstanden ist. Der Schlüssel zu hoher Effizienz ist die Integration des Bindungs- und des Katalyseprozesses – die molekulare Erkennung des Übergangszustandes.
Highlights
Nucleophile Carbene: eine unglaubliche Renaissance
- Pages: 791-794
- First Published: 3. April 1996
Die Chemie nucleophiler Carbene geht auf H.-W. Wanzlick zurück. Vielfach untersuchtes Modell war das Imidazolidinyliden 1, das unter anderem aus dem Dimer 2 generiert wurde. Mit der Isolierung der stabilen Carbene 3 durch A. J. Arduengo et al. setzte eine unglaubliche Entwicklung ein: Additionsreaktionen unter Erhöhung von Bindigkeit und Koordination am Carbenkohlenstoffatom prägen die Chemie solcher Moleküle. Kürzlich wurde von Herrmann et al. über die Verwendung solcher Carbene als Liganden bei Pd-Katalysatoren berichtet.
Additionen an funktionalisierte Benzolderivate unter Desaromatisierung
- Pages: 795-796
- First Published: 3. April 1996
Ökonomisch und von schlichter Eleganz ist die Synthese von funktionalisierten Cyclohexadienen durch Desaromatisierung von Benzolderivaten. Moderne Verfahren bedienen sich dazu der Aktivierung des Arens durch Os-, Cr- oder Mn-Komplexe, der Addition nach Lewis-Säure-Komplexierung oder der durch Mikroorganismen katalysierten Dihydroxylierung. Besondere Bedeutung kommt stereoselektiven Varianten [siehe z.B. Gl. (a)] und der Effizienz der C-C-Verknüpfungen zu.
Zuschriften
Gesteuerte Selbstorganisation chiraler, optisch aktiver, makrocyclischer vierkerniger molekularer Quadrate†‡
- Pages: 797-802
- First Published: 3. April 1996
Ausschließlich eines von sechs möglichen Diastereomeren (Formel rechts) bildet sich bei der fast quantitativ verlaufenden Selbstorganisation zu optisch aktiven molekularen Quadraten aus einer Mischung der entsprechenden Triflat(bisphosphan)-metall-Komplexe und Diazaliganden. Dieses Phänomen basiert zu einem Großteil auf der asymmetrischen Induktion der Bisphosphanliganden und der eingeschränkten Rotation um die Bindungen zwischen den Metallzentren und den Stickstoffatomen des Heteroarenliganden. M = Pd, Pt.
Diazodi(4-pyridyl)methan und Diazophenyl-(4-pyridyl)methan als photoreaktive Liganden für Metall-Carben-Heterospinsysteme†
- Pages: 802-804
- First Published: 3. April 1996
Cycloaddition als Methode zur Glycosidierung†
- Pages: 805-807
- First Published: 3. April 1996
„… zu finden sind wirklich neue und andere Strategien zur Glycosidierung, die keine bimolekulare Reaktion zwischen einem entstehenden Oxocarbeniumion und einem sterisch gehinderten Alkohol geringer Nucleophilie erfordern.”︁ Eine der ersten Antworten auf diesen Appell von F. Barresi und O. Hindsgaul an alle Zuckerchemiker liefern die Versuche, die sich mit der unten gezeigten Reaktionssequenz beschreiben lassen.
Das Schellman-Motiv in Dehydrooligopeptiden: Kristall- und Molekülstruktur von Boc-Val-ΔPhe-Leu-Phe-Ala-ΔPhe-Leu-OMe†
- Pages: 807-810
- First Published: 3. April 1996
α,β-Didehydrophenylalanin als Peptidbaustein eignet sich zur Erzeugung von Sekundärstrukturmotiven in Modellverbindungen, die auch in Proteinstrukturen vorkommen. Hier wird eine 310/α-helicale Konformation vorgestellt, die von einem Schellman-Motiv abgeschlossen wird. Sie findet sich in dem kurzen, im Titel genannten Peptid, das zwei Didehydrophenylalaninreste enthält.
Selbstorganisation einer künstlichen Lichtsammel-Antenne: Energieübertragung von einem zinkhaltigen Chlorin auf ein Bacteriochlorin in einem supramolekularen Aggregat†
- Pages: 810-812
- First Published: 3. April 1996
Schnell und effizient ist der Energietransfer zwischen den lichtsammelnden aggregierten Zinkchlorinen und einer aus einem Zinkchlorin- und einem metallfreien Bacteriochlorin-Chromophor bestehenden coaggregierten Verbindung. Bei diesem ersten Beispiel für eine funktionale selbstorganisierte Lichtsammel-Antenne wird die von vielen Donormolekülen absorbierte Lichtenergie intra-supramolekular auf ein Acceptormolekül übertragen (siehe schematische Darstellung unten).
Selektive Kationenwanderung durch Brevetoxin B enthaltende Lipiddoppelschichten†
- Pages: 812-814
- First Published: 3. April 1996
Ein ionenkanalartiges Assoziat bildet Brevetoxin B in Lipiddoppelschichten, wie mit dem fluoreszenzmarkierten Brevetoxin-B-Derivat 1 festgestellt wurde. Es fördert so eine spezifische Kationenwanderung in und aus Lipidvesikeln (siehe schematische Darstellung unten). Die Bioaktivität von Brevetoxin B beruht also wahrscheinlich nicht nur – wie bislang angenommen – auf der Aktivierung von spannungsabhängigen Natriumkanälen.
Stöchiometrieabhängigkeit der Reaktion von Butyllithium mit Pyridin: ein Lithiodihydropyridin mit zusätzlich koordiniertem Pyridin†
- Pages: 815-816
- First Published: 3. April 1996
Chlortetraoxid†
- Pages: 816-818
- First Published: 3. April 1996
Das letzte unbekannte einkernige Chloroxid ist gefunden. ClO4 (im Bild rechts) läßt sich als gelbes Produkt der Vakuum-Thermolyse von Cl2O6 oder Cl2O7 in einer Neon-Matrix isolieren. Aus den IR-Spektren des Radikals konnte geschlossen werden, daß es C3v-Symmetrie aufweist und drei kurze (142 pm) und eine lange (153 pm) Cl-O-Bindung hat.
Selektive Metallierung von Halogenarenen mit Cupraten
- Pages: 818-820
- First Published: 3. April 1996
Regioselektiv und nahezu ohne Verlust an Enantiomerenreinheit wird mit [Li3ZnMe3(SCN)2] das 5-exo-(2) und mit [Li3Cu(CN)Me3] das 6-endo-Cyclisierungsprodukt (3) aus dem Epoxid 1 gebildet. Ohne weitere Reagentien gelingt so durch Halogen-Metall-Austausch mit dem jeweiligen At-Komplex und anschließende intramolekulare Epoxidöffnung durch die Arylcuprateinheit die asymmetrische Synthese von 2 und 3, die Vorstufen der Antibiotica CC-1065 und Duocarmycin sind.
Synthese von cis-Endiinen durch Umlagerung einer allylischen Doppelbindung†
- Pages: 821-822
- First Published: 3. April 1996
Synthese und Struktur von Galliumsiloxankäfigen: Modellsubstanzen für galliumhaltige Silicate†
- Pages: 823-825
- First Published: 3. April 1996
Molekularsiebe aus dem Baukasten?! Die Galliumsiloxane nebenstehend gezeigten Typs (Substituenten an Si- und Ga-Atomen sind weggelassen), die jetzt erstmals synthetisiert und strukturell charakterisiert wurden, erhöhen die Zahl der Moleküle, die potentiell für die gezielte Synthese von zeolithartigen Verbindungen in Frage kommt. Auch das Verständnis von Katalyseprozessen könnte durch das Studium solcher Modellverbindungen verbessert werden.
1, 3-Didehydrobenzol (meta-Benzin)†
- Pages: 825-827
- First Published: 3. April 1996
Sowohl durch Photolyse des Cyclophans 1 als auch durch Gasphasenthermolyse des Diacylperoxids 3 wurde das Didehydrobenzol 2 hergestellt. Durch aufwendige Rechnungen auf CCSD(T)-Niveau konnte das experimentelle IR-Spektrum hervorragend reproduziert werden. Die intensivste Bande bei 547 cm−1 wurde einer für 2 charakteristischen Ring-Deformationsschwingung zugeordnet.
Spontane Bildung von optischer Aktivität in J-Aggregaten mit Davydov-Aufspaltung†‡
- Pages: 827-830
- First Published: 3. April 1996
Durch Kombination zweier Wechselwirkungen – der Selbstassoziation organischer Farbstoffe und der hydrophoben Wechselwirkung langer Alkylketten – wurden erstmalig aus achiralen Verbindungen chirale, supramolekulare Strukturen aufgebaut. Aus der Davydov-Aufspaltung im Absorptionsspektrum der gebildeten, chiralen J-Aggregate und ihrem Circulardichroismus wird auf eine verdrillte Fischgrätenstruktur geschlossen (siehe rechts).
Hexaterphenylyl- und Hexaquaterphenylylbenzol: das Verhalten von Chromophoren und Elektrophoren auf engem Raum†
- Pages: 830-833
- First Published: 3. April 1996
Wittig-Olefinierung von Lactonen
- Pages: 833-834
- First Published: 3. April 1996
Mit von Zuckern abgeleiteten Lactonen wie 1 reagiert das stabilisierte Phosphoran 2 zu Mischungen von (E/Z)-Olefinen wie 3 in guten bis hervorragenden Ausbeuten. Angesichts der bekannt schlechten Reaktivität von Estern in Wittig-Reaktionen eröffnet die hier geschilderte Umsetzung vielversprechende Perspektiven.
Stabile DNA-Schleifen durch Einbau unpolarer und keine Wasserstoffbrücken bildender Nucleosid-Isostere†
- Pages: 834-837
- First Published: 3. April 1996
Die Stabilität von Oligonucleotid-Haarnadelstrukturen hängt sehr von den Bausteinen in der Schleifenregion ab. Wurden die unpolaren Nucleosid-Isostere 1–3 anstelle der natürlichen Nucleoside Thymidin und Desoxyadenosin zwischen zwei Octanucleotiden eingebaut, waren die entsprechenden Doppelhelix-DNAs wesentlich stabiler als die natürlichen Analoga.
Supraleitung in intercaliertem und substituiertem Y2Br2C2
- Pages: 837-839
- First Published: 3. April 1996
Schichtverbindungen des Typs Y2X2C2 (X = Cl, Br, I) sind supraleitend bei Temperaturen zwischen 2.3 und 11.2 K, was an der Tendenz zur paarweisen Lokalisierung von Leitungselektronen in C2-π*-Zuständen an der Fermikante EF liegen könnte. Dies wurde durch eine Veränderung der Valenzelektronenkonzentration (Einlagerung von Natrium oder Einbau von Thorium) überprüft. Während bei Na-haltigen Proben die Sprungtemperatur deutlich ansteigt, fällt sie bei Th-substituierten.
Das erste Beispiel für einen Pt4Ag3-Cluster–Synthese und Kristallstruktur von [Pt2(dppy)4(μ3-S)2Ag3(μ3-S)2Pt2(dppy)4]3+†
- Pages: 839-841
- First Published: 3. April 1996
Ein nahezu gleichschenkliges Dreieck bilden die Silberatome in dem neuartigen, siebenkernigen Heterometallkomplex 1 (die Struktur des Kations ist rechts vereinfacht dargestellt). Im festen Zustand luminesziert 1 bei 560 nm, was auf S→Ag-Charge-Transfer-Übergänge sowie auf Wechselwirkungen im Clusterkern zurückgeführt werden kann. dppy = Diphenylpyridin-2-ylphosphan.
Synthese und Charakterisierung des neuartigen Eisencarbonyl-Tellurchlorid-Clusters [Fe2(CO)6(μ-Cl)(μ-TeCl)2]2[η2,μ2,μ2Te2Cl10] und seine Zersetzung zu [Fe2(CO)6(η2,μ2,μ2-Te4)(μ-TeCl2)]†
- Pages: 841-843
- First Published: 3. April 1996
Ein doppelt verbrückendes (η2, μ2, μ2-Te4)2−-Ion und ein verbrückendes [TeCl2]2+ -Ion mit einer fast linearen Cl-Te-Cl-Anordnung sind die herausragenden Strukturmerkmale des Komplexes 1 (Bild rechts, CO-Liganden an Fe weggelassen), der im gleichen Molekül Tellur sowohl im oxidierten als auch im reduzierten Zustand enthalt. Der Komplex wird im festen Zustand durch schwache Te-Te-Wechselwirkungen zu einer unendlichen Schichtstruktur stabilisiert, ist in Lösung jedoch nicht stabil. 1 ist das Produkt einer komplexen Halogenierung von [ Te2Fe3(CO)9]. [Fe2(CO)6(η2, μ2, μ2 -Te4)(μ-TeCl2)] 1
Organische Reaktionen mit Hilfe neuronaler Netze klassifiziert: Michael-Additionen, Friedel-Crafts-Alkylierungen durch Alkene und verwandte Reaktionen†
- Pages: 844-846
- First Published: 3. April 1996
Eine zweidimensionale Projektion organischer Reaktionen in ein selbstorganisierendes neuronales Netz (rechts schematisch gezeigt) ermöglicht es, Ähnlichkeiten zwischen Reaktionen zu erkennen, Reaktionstypen festzulegen und Spezialreaktionen aufzufinden. Schwerpunktmäßig wird dies hier am Beispiel der Michael-Addition gezeigt.
Elektronenstruktur von Nicht-Häm-Oxoeisen-komplexen in hohen Oxidationsstufen mit der bislang unbekannten [Fe2(μ-O)2]3+-Einheit†
- Pages: 846-849
- First Published: 3. April 1996
Korrekte Geometrie und Elektronenstruktur! Das sind die Ergebnisse von DFT-Rechnungen am [(tpa)Fe(μ-O)2 Fe(tpa)]3+ -Ion (tpa = Tris(2-pyridylmethyl)amin), die experimentell bestätigt werden konnten. Sie liefern unter anderem eine Begründung für den Quartett-Grundzustand (im Bild skizziert) der Verbindung (E = Orbitalenergie).
Berichtigungen
Bücher
Classics in Total Synthesis. Targets, Strategies, Methods. Von K. C. Nicolaou und E. J. Sorensen. VCH, Weinheim, 1996. 798 S., geb./ Broschur 128.00 DM/78.00 DM. - ISBN 3-527-29284-5/3-527-29231-4
- Page: 851
- First Published: 3. April 1996
Organomagnesium methods in organic synthesis. (Reihe: Best Synthetic Methods.) Von B. J. Wakefield. Academic Press, London, 1995. 249 S., geb. 50.00 £. - ISBN 0-12-730945-4
- Pages: 851-852
- First Published: 3. April 1996
Principles and practice of modern chromatographic methods. Von K. Robards, P. R. Haddad und P. E. Jackson. Academic Press, London, 1994. 495 S., geb. 35.00 £. - ISBN 0-12-589570-4
- Pages: 852-853
- First Published: 3. April 1996
Electrochromism. Fundamentals and applications. Von P. M. S. Monk, R. J. Mortimer und D. R. Rosseinsky. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1995. 216 S., geb. 168.00 DM. - ISBN 3-527-29063-X
- Pages: 853-854
- First Published: 3. April 1996
NMR-Spektroskopie für Anwender. Von W.-D. Herzog und M. Messerschmidt. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1995. 194 S., Broschur 58.00 DM. - ISBN 3-527-28690-X
- Pages: 854-855
- First Published: 3. April 1996
NMR - Konzepte und Methoden. Von D. Canet. Springer, Heidelberg, 1994, 245 S., Broschur 48.00 DM. - ISBN 3-540-58204-5
- Pages: 854-855
- First Published: 3. April 1996