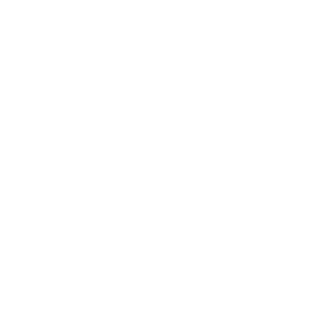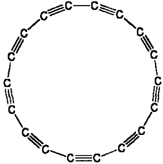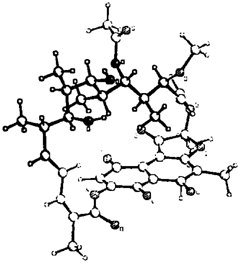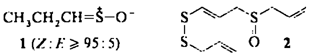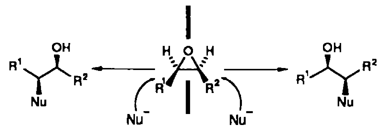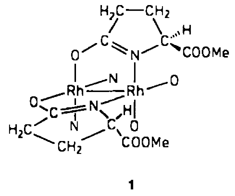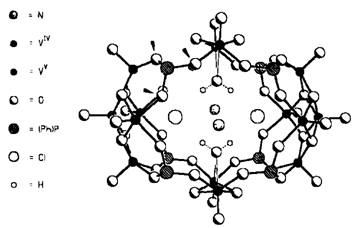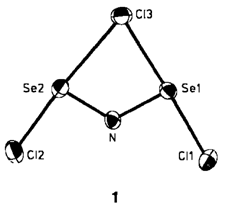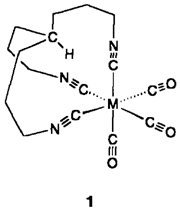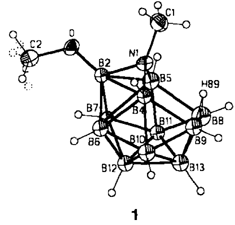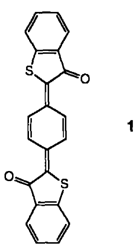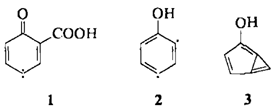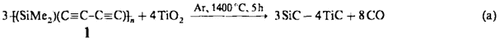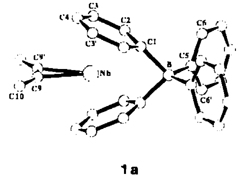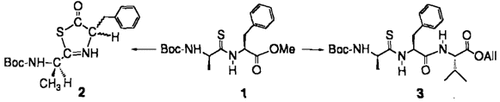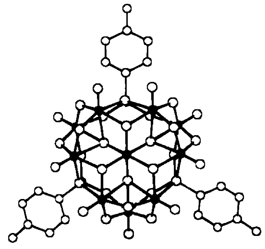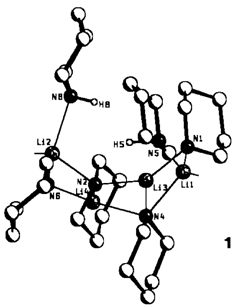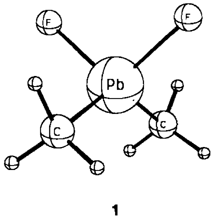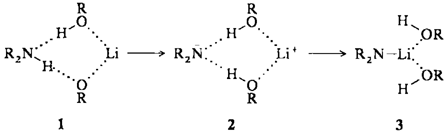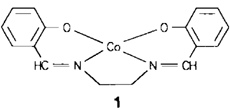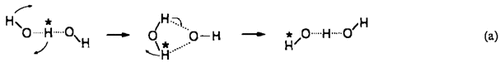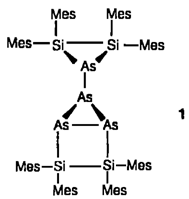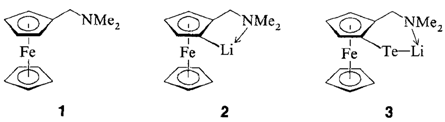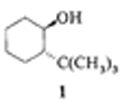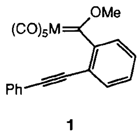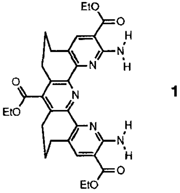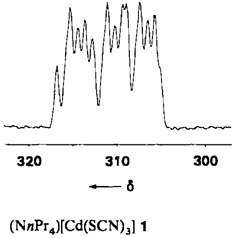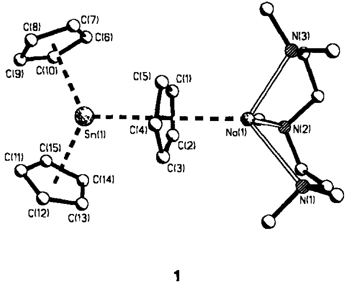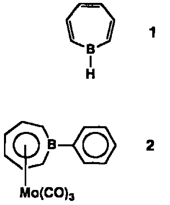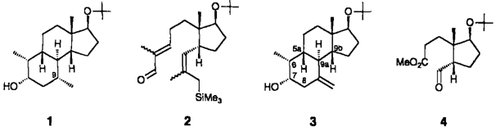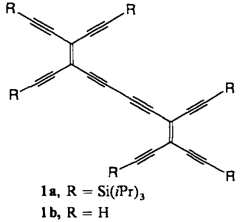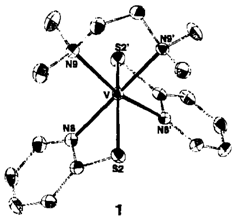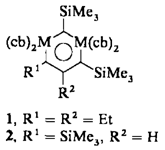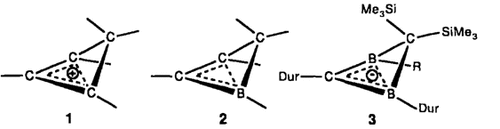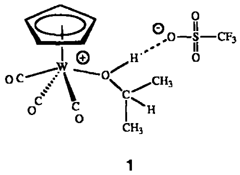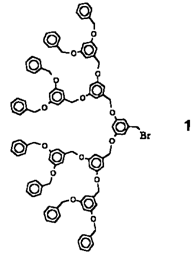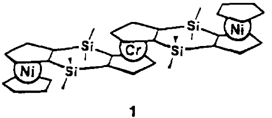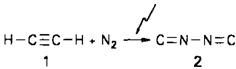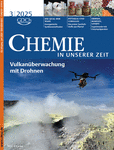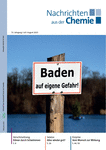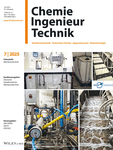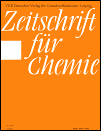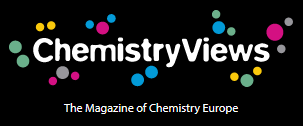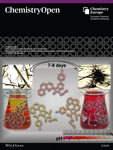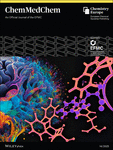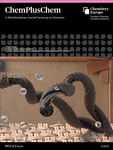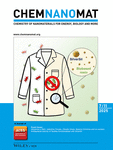Journal list menu
Export Citations
Download PDFs
Titelbild
Impressum
Graphisches Inhaltsverzeichnis
Aufsätze
Strategien zum Aufbau molekularer und polymerer Kohlenstoffallotrope
- Pages: 1123-1146
- First Published: September 1992
Stäbe, Ringe, Kugeln und Netzwerke aus Kohlenstoff sind lohnende Forschungsziele, denkt man an die immense technische Bedeutung von Graphit und Diamant sowie die faszinierenden Eigenschaften von C60 und den höheren Fullerenen. Diesen Zielen ist man mit der Synthese von geschützten Polyinen and Cyclopolyinen, Vorstufen zu Molekülen wie 1 bereits ein deutliches Stück näher gerückt. Verbindungen wie Tetrathinylethen bieten sich als Bausteine neuartiger Kohlenstoffnetze an. Die gezielte Synthese von Fullerenen aus kleinen Bausteinen bleibt eine Herausforderung.
Flexible Moleküle mit definierter Gestalt — Konformationsdesign
- Pages: 1147-1157
- First Published: September 1992
Nur für den Bruchteil einer Sekunde stimmt das Bild, das wir uns gewöhnlich von der Molekülgestalt machen. In der Regel ändern Moleküle ständig ihre Konformation, und zwar sowohl vollständig flexible Moleküle als auch solche, die nur bestimmte Vorzugskonformationen einnehmen. Vorzugskonformationen der Hauptkette können zusätzlich stabilisiert werden, im Antibiotikum Rifamycin S (Bild rechts) beispielsweise durch Wasserstoffbrückenbindungen (Molekülbereich schwarz hervorgehoben). Die Prinzipien, auf denen die definierte Gestalt dieser Moleküle beruht, sind unter anderem für das Design von Wirkstoffen wichtig.
Die Organoschwefelchemie der Gattung Allium und ihre Bedeutung für die organische Chemie des Schwefels
- Pages: 1158-1203
- First Published: September 1992
Knoblauch und Zwiebeln, die wohl bekanntesten Allium-Gewächse, stehen im Mittelpunkt dieser Übersicht über Organoschwefelverbindungen. Sie behandelt die Biosynthese der S-Alk(en)yl-L-cystein-S-oxide, der Aroma– und Geruchsvorstufen, ebenso wie deren erzymatische Umwandlung beim Zerkleinern der Pflanzen die Aufklärung von Strukturen und Reaktionssequenzen sowie die physiologischen Eigenschaften der Pflanzeninhaltsstoffe. Zwei der vielen interessanten Verbindungen seien herausgegriffen : der tränenreizende Faktor der Zwiebel 1 und das Antithrombosemittel Ajoen 2 aus Knoblauch.
Highlights
meso-Epoxide in der asymmetrischen Synthese: enantioselektive öffnung durch Nucleophile in Gegenwart von chiralen Lewis-Säuren
- Pages: 1204-1205
- First Published: September 1992
Das Metallzentrum komplexiert das Epoxid-Sauerstoffatom, und die chirale Ligandenumgebung ermöglicht die Differenzierung der formal enantiotopen Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindungen durch ein Nucleophil. Nach diesem Prinzip funktioniert die von W. A. Nugent entwickelte Methode, nach der mit einer neuen chiralen Lewis-Säure auf Zirconium-Basis eine Rcihe von meso-Epoxiden mit Trialkylsilylaziden zu β-Azidoalkoholen mit sehr guten Enantiomerenüberschüssen umgesetzt werden können. Nu = N3., R1, R2 = CH3 (CH2)4 etc.
„Nicht-koordinierende”︁ Anionen: unterschätzte Liganden
- Pages: 1206-1207
- First Published: September 1992
Wechselwirkungen von Tetraarylboraten mit koordinativ ungesättigten kationischen Metall- komplexfragmenten dürfen nicht vernachlässigt werden. So zeigt sich beispielsweise bei Modellverbindungen für die Ziegler-Natta-Polymerisation, daß derartige Kation-Anion-Wechselwirkungen auch die katalytische Aktivität dieser Systeme beeinflussen. Pampaloni et al. (S. 1230ff.) konnten nun mit dem Nb-Komplex 1 zeigen, daß BPh sogar als zweifach η6-koordinierender Chelatligand fungie-ren kann.
sogar als zweifach η6-koordinierender Chelatligand fungie-ren kann.
Enantioselektive Rhodium(II)-Katalysatoren
- Pages: 1208-1210
- First Published: September 1992
Dimere Rhodium(II)-Verbindungen des Typs [Rh2(OAc)4] sind bewährte Katalysatoren bei Carben-Reaktionen, z.R. beim Aufbau von Cyclopropanen aus Olefinen und Diazoverbindungen. Mit [Rh2 ((5S)-mepy)4] 1 (mepy ist der am N-Atom deprotonierte Methylester der (–)-(S)-Pyrrolidon-5-carbonsäure) steht jetzt ein neuer enantioselektiver Katalysator zur Verfügung, der bei Reaktionen wie der Cyclopropenierung von Acetylenen mit Diazoverbindungen und bei der Bildung von Fünfringen in intramolekularen CH-Insertionen bisher konkurrenzlos ist. (Zwei Liganden in 1 sind nur unvollständig gezeichnet.)
Anorganische Wirt-Gast-Chemie mit neuem Schwung
- Pages: 1210-1213
- First Published: September 1992
Schon 1826 beschrieb Berzelius (NH4)3[(PO4)Mo12O36], dessen Anion aus einer Hülle von zwölf MoO6-Oktaedern besteht; im Zentrum befindet sich ein P-Atom. Man kann das Anion aber auch so beschreiben, daß eine Phosphatgruppe das Zentrum bildet, dessen O-Atome Teil der Hülle sind. Mit dieser Uralt-Chemie im Zusammenhang stehen neuere Ergebnisse der anorganischen supramolekularen Chemie, und zwar so unterschiedliche Befunde wie die Charakterisierung von Cd(CN)2 · Neopentan, bei dem der Wirt Cd(CN)2 eine Raumnetzstruktur bildet, in deren Hohlräumen Neopentanmoleküle geordnet eingelagert sind, und die in diesem Heft von A. Müller et al. beschriebene (siehe S. 1214) Bindung eines NH4Cl-Dimers in einem Riesenanion-Käfig.
Zuschriften
Ein neuartiges„Wirt/Gast”︁-System mit einem nanometergroßen Hohlraum mit Kationen und Anionen: [2 NH , 2 Cl− ⊂ V14O22(OH)4(H2O)2(C6H5PO3)8]6−†‡
, 2 Cl− ⊂ V14O22(OH)4(H2O)2(C6H5PO3)8]6−†‡
- Pages: 1214-1216
- First Published: September 1992
Polytope Wirte für mehrere Kationen und Anionen oder Kationen/Anionen-Aggregate waren bisher unbekannt. Das im Titel genannte Anion (Strukturbild rechts) ist ein Wirt/Gast-System, dessen „Wid”︁ – die Schale – aus elektrophilen und nucleophilen Teilen besteht, in die das Kationen/Anionen-Aggregat (NH4)2Cl2, ein Ausschnitt aus dem NH4Cl-Ionengitter, als „Gast”︁ inkorporiert ist.
Se2NCl3 und [Se2NCl2]+[GaCl4]−, Chloridnitride von dreiwertigem Selen
- Pages: 1216-1218
- First Published: September 1992
An einen Zirkel erinnert die Struktur des planaren, annähernd C2v-symmetrischen Moleküls Se2NCl3 1. Dieses Chloridnitrid ist leicht löslich, stabil und zugleich sehr reaktiv. Das verbrückende Chloratom in 1 läßt sich leicht mit GaCl3, unter Bildung von [Se2NCl2]-[GaCl4] herauslösen, dessen Kation eine U-förmige Struktur hat. Beide Verbindungen liegen im diamagnetischen Singulett-Grund-zustand vor.
Chelatkomplexe tripodaler, aliphatischer Triisocyanidliganden†
- Pages: 1218-1221
- First Published: September 1992
Durch die deutliche Tieffeldverschiebung des NMR-Signals des zentralen Methinprotons am Liganden, das in den entschirmenden Bereich des Anisotropiekegels der drei NC-Bindungen eindringt, und röntgenstrukturanalytisch konnte die in-Konfiguration der Komplexe 1 (M = Cr, W) nachgewiesen werden. Die Synthese von 1 zeigt, daß auch aliphatische Isocyanide mit wenigen Gerüstatomen Chelatkomplexe mit Übergangsmetallen bilden können.
Öffnung eines Aza-closo-dodecaborans zum Aza-nido-dodecaborat†
- Pages: 1221-1222
- First Published: September 1992
als nido-Derivat des hypothetischen Tridecaborats closo-B13H läßt sich das Anion [MeNB11H11(OMe)]− 1 auffassen. 1 kann aus dem ikosaedrisch aufgebauten colso-NB11H12 mit Methyltriflat und Methanol hergestellt werden. Die Reaktion von MeOH mit der Zwischenstufe MeNB11H11 verläuft also nicht unter Deborierung zu einem nido-Derivat, wie es für das mit NB11H12 isoelektronische C2B10H12 bekannt ist.
läßt sich das Anion [MeNB11H11(OMe)]− 1 auffassen. 1 kann aus dem ikosaedrisch aufgebauten colso-NB11H12 mit Methyltriflat und Methanol hergestellt werden. Die Reaktion von MeOH mit der Zwischenstufe MeNB11H11 verläuft also nicht unter Deborierung zu einem nido-Derivat, wie es für das mit NB11H12 isoelektronische C2B10H12 bekannt ist.
Indigoide para-Chinodimethane†‡
- Pages: 1222-1225
- First Published: September 1992
Möglichst langwellig absorbierende indigoide Verbindungen sind ein attraktives Forschungsziel, unter anderem als Materialien für optische Datenspeicher. In dieser Arbeit wird die Synthese para-Chinodimethan-homologer indigoider Verbindungen wie 1 beschrieben, die bemerkenswerterweise deutlich längerwellig. absorbieren als entsprechende vinyloge Verbindungen.
2,4-Didehydrophenol — erster IR-spektroskopischer Nachweis eines meta-Arins†‡
- Pages: 1225-1228
- First Published: September 1992
Durch photochemische Decarboxylierung des Carbens 1 in einer Argon-Matrix bei 10 K ist 2,4-Didehydrophenol 2 zugänglich. Das m-Arin 2 wurde IR– und UV/VIS-spektroskopisch charakterisiert; das experimentelle und das auf GVB/6-31G(d,p)-Niveau berechnete IR-Spektrum stimmen gut überein. Diese Befunde legen für 2 eine diradikalische, monocyclische Struktur nahe; die bicyclische Struktur 3 kann ausgeschlossen werden.
Thermische Umwandlung von Poly[(silylen)-diacetylen]-Metalloxid-Verbundstoffen: ein neuer Weg zu β-SiC-MC-Keramiken†
- Pages: 1228-1230
- First Published: September 1992
Quervernetzung, Bildung eines SiC-Netzwerks und Reduktion der eingeschlossenen TiO2-Partikel, damit läßt sich die dreistufige Reaktion zwischen Poly[ (dimethylsilylen)diacetylen] 1 und TiO2 zu SiC-TiC-Keramiken, die in Gleichung (a) zusammengefaßt ist, beschreiben. Die Reduktion des Metalloxids erfolgt hier bei wesentlich niedrigeren Temperaturen als nur mit Kohlenstoff allein. Diese Methode kann bei einer Vielzahl weiterer Metalloxide und auch bei B2O3 angewendet werden, und darüber hinaus läßt sich durch Variation des Polymers die Zusammensetzung der Keramik verändern.
[Nb {B (η6-C6H5)2(C6H5)2} (η2-H3CC2CH3)]; die erste Verbindung mit verzerrtem Tetraphenylborat als 12-Elektronendonorligand†
- Pages: 1230-1231
- First Published: September 1992
Als sandwichartig-koordinierender Ligand fungiert das „Gegenion”︁ BPh in den Niob(I)-Komplexen 1. Dies belegt die Röntgenstrukturanalyse von 1a. Die BPh
in den Niob(I)-Komplexen 1. Dies belegt die Röntgenstrukturanalyse von 1a. Die BPh -Komplexe 1 sind die ersten, in denen zwei der vier Phenylringe des Tetraalylborats an ein Metallzentrum binden. Derartige Komplexe interessieren unter anderem als Modellverbindungen für katalytische Prozesse.
-Komplexe 1 sind die ersten, in denen zwei der vier Phenylringe des Tetraalylborats an ein Metallzentrum binden. Derartige Komplexe interessieren unter anderem als Modellverbindungen für katalytische Prozesse.
Racemisierungsfreie Kettenverlängerung von Thiodipeptiden mit Proteasen†
- Pages: 1231-1233
- First Published: September 1992
Die C-terminale Verlängerung von Thiopeptiden 1 gelingt bei chemischer Aktivierung nicht – es entstehen vielmehr Thiazolone 2. Mit Proteasen als Katalysatoren dagegen konnte nun 1 racemisierungsfrei zu Oligopeptiden 3 mit Thioamidgruppierungen in definierten Positionen verlängert werden. All = Allyl.
Trennung überlappender Multipletts im zweidimensionalen NMR-Spektrum durch selektive„Injektion”︁ von Magnetisierung†
- Pages: 1233-1236
- First Published: September 1992
Eine „Arme-Leute”︁-Methode nennen die Autoren ihr Verfahren zur Trennung überlappender Kreuzpeakmultipletts in zweidimensionalen NMR-Spektren. Dabei wird einer Soft-COSY-Pulssequenz ein homonuclearer Hartmann-Hahn-Kohärenztransfer vorgeschaltet, der beispielsweise die Selektion des Multipletts des trans-Isomers von 1, R = CO2Et, R′ = Ph, aus den überlappenden Multipletts von cis– und trans-Isomer (siehe rechts) ermöglicht.
(Organoarsonato)polyoxovanadium-Cluster: Eigenschaften und Strukturen des Vv-Clusters [V10 O24 (O3AsC6H4-4-NH2)3]4− und des VIV/Vv-Clusters [H2{V6O10(O3AsC6H5)6}]2−†
- Pages: 1236-1239
- First Published: September 1992
Drei zum Ring verknüpfte {V3O13}-Einheiten, die ein zentrales V-Atom einschließen, bzw. eine Schichtstruktur aus drei {V2As2O4}-Ringen liegen in den Titelverbindungen vor. Diese sind somit weitere Beispiele dafür, welch ungewöhnliche Strukturen bei Polyoxometallaten möglich sind; darüber hinaus belegen sie den starken Einfluß, den schon eine geringfügige Änderung im organischen Liganden auf den Molekülbau haben kann. Rechts ist die Struktur des Vv-Clusters gezeigt. • = V.
[Lithiumpiperidid-Piperidin]4: Kristallstruktur eines oligomeren Lithiumamid-Amin-Komplexes, einer Zwischenstufe bei der Lithiierung von Aminen†
- Pages: 1239-1240
- First Published: September 1992
Ein Modell für die Entstehung von Leiter- strukturen bei Lithiumamiden ist die Kristall- struktur der Titelverbindung 1, dem ersten oligomeren gemischten Komplex eines Li- thiumamids mit einem Amin (Strukturbild rechts, je ein Piperidinligand an Lil und Li2 weggelassen). Diese Festkörperstruktur ist in Einklang mit den Ergebnissen von Modellrechnungen für derartige 1:1-Komplexe sowie von 13C-NMR-Studien in Lösung. Auch Umsetzungen von Lithiumpiperidid mit CO in Gegenwart von Piperidin deuten auf derartige Komplexe als reaktive Zwischenstufen.
Struktur- und Stabilitätstendenzen bei Fluor(methyl)plumbanen†
- Pages: 1240-1242
- First Published: September 1992
Drastische Abweichungen vom idealen Tetraederwinkel und Destabilisierung von Bindungen trotz Bindungsverkürzung – das sind die Ergebnisse von ab-initio-Pseudopotentialrechnungen an der homologen Reihe der Fluor-(methyl)plumbane. So beträgt beispielsweise der C-Pb-C-Winkel in Me2PbF2 1 (berechnete Struktur rechts) fast 135°! Die Einführung von Fluorsubstituenten bei Plumbanen hat also deutlich andere Auswirkungen als bei Alkanen und Silanen.
Ein neuartiger Sechs-Zentren-Deprotonierungs-Lithiierungs-Reaktionsmechanismus, gestützt durch die Kristallstrukturuntersuchung eines Lithiumcarbazolids†
- Pages: 1242-1244
- First Published: September 1992
Die Metallierung eines Amins durch ein Lithiumalkoxid in protischem Medium verläuft möglicherweise über den unten skizzierten zweistufigen Sechs-Zentren-Deprotonierungs-Lithiierungs-Mechanismus. Gestützt wird dieser Reaktionspfad durch die Röntgenstrukturanalyse von [Li(tBuOH)2(thf)2][cb] (Hcb =Carbazol), die ein zwischen dem Carbazol-N-Atom und dem O-Atom eines tBuOH-Moleküls fehlgeordnetes Proton ergibt, was diese Verbindung zum Model1 für den Vorläuferkomplex 1 und den Produktkomplex 2 der Deprotonierung macht. Die anschließende Umlagerung von 2 in 3 könnte dagegen auch schrittweise erfolgen.
Wechselwirkungen zwischen acyclischen und cyclischen Peralkylammoniumverbindungen und DNA†
- Pages: 1244-1246
- First Published: September 1992
Mit additiven Inkrementen von 5 ± 1 kJmol−1 pro Salzbrücke läßt sich die ionische Bindung von Polyaminen an Kalbsthymus-DNA beschreiben, ein Wert, der im Bereich derer zahlreicher anorganischer und organischer Ionenpaare liegt. Peralkylierte Polyamine haben nahezu die gleiche Affinität gegenüber DNA wie protonierte, was den geringen Beitrag der H-Brücken zur Bindung verdeutlicht; relativ starre Azoniacyclophane haben zum Teil eine hohe Affinität, ohne daß die Areneinheiten intercalieren.
Die elektrochemische Oxidation von [CoII(salen)] in Lösungsmittelgemischen — ein Beispiel für ein Leiterschema mit gekoppelten Elektronentransfer-und Lösungsmittelaustauschreaktionen†‡
- Pages: 1246-1248
- First Published: September 1992
Die Metallierung eines Amins durch ein Lithiumalkoxid in protischem Medium verläuft möglicherweise über den unten skizzierten zweistufigen Sechs-Zentren-Deprotonierungs-Lithiierungs-Mechanismus. Gestützt wird dieser Reaktionspfad durch die Röntgenstrukturanalyse von [Li(tBuOH)2(thf)2][cb] (Hcb =Carbazol), die ein zwischen dem Carbazol-N-Atom und dem O-Atom eines tBuOH-Moleküls fehlgeordnetes Proton ergibt, was diese Verbindung zum Model1 für den Vorläuferkomplex 1 und den Produktkomplex 2 der Deprotonierung macht. Die anschließende Umlagerung von 2 in 3 könnte dagegen auch schrittweise erfolgen.
Dynamischer Protonenaustausch im Hydrogendihydroxid-Ion H3O des Hydroxosodalithhydrats [Na4(H3O2)]2[SiAlO4]6: 1H-MAS-NMR-spektroskopischer Nachweis†
des Hydroxosodalithhydrats [Na4(H3O2)]2[SiAlO4]6: 1H-MAS-NMR-spektroskopischer Nachweis†
- Pages: 1248-1250
- First Published: September 1992
Nur ca. 40 kJmol−1 beträgt die Aktivierungsenergie für den dynamischen Austausch zwischen dem zentralen und den terminalen H-Atomen im H3O O-Ion. Dies ergaben Festkörper-NMR-spektroskopische Untersuchungen der Titel-verbindung, in der die H3O
O-Ion. Dies ergaben Festkörper-NMR-spektroskopische Untersuchungen der Titel-verbindung, in der die H3O -Ionen in Sodalithkäfigen isoliert vorliegen. Da die Spaltung von H3O
-Ionen in Sodalithkäfigen isoliert vorliegen. Da die Spaltung von H3O in H2O und OH− eine Energie von ca. 100 kJmol-− 1 erfordert, ist ein Mechanismus gemäß (a) für den Austausch wahrscheinlicher.
in H2O und OH− eine Energie von ca. 100 kJmol-− 1 erfordert, ist ein Mechanismus gemäß (a) für den Austausch wahrscheinlicher.
Reaktion von Tetramesityldisilen mit As4: Synthese und Struktur eines neuartigen tricyclischen Arsen-Silicium-Ringsystems†‡
- Pages: 1251-1252
- First Published: September 1992
Eine As2Si2- einen AsSi2- und einen As3 Ring vereinigt die tricyclische Verbindung 1, die aus Mes2Si = SiMes2 (Mes = 2,4,6-Trimethylphenyl) und As4 zugänglich ist. Als zweites Produkt entsteht ein Diarsadisilabicyclo[1.1.0]butan-Derivat mit Schmetterlingsstruktur, das auch beim Erhitzen von 1 gebildet werden.
Chelatstabilisierung eines monomeren Lithiumtellurolats†
- Pages: 1252-1253
- First Published: September 1992
Isolierbare, wohl definierte Alkalimetalltellurolate – von Interesse für die organische Synthese wie für die Herstellung von Übergangsmetalltelluriden – sind nur mit sperrigen organischen Resten bekannt. Durch Lithiierung und Chalcogenierung konnte jetzt aus 1 in quantitativer Ausbeute über die Zwischenstufe 2 das Tellurolat 3 gewonnen werden. Folgereaktionen zeigen die Nützlichkeit derartiger Tellurolate.
trans-2-tert-Butylcyclohexanol, ein einfaches, selektivitätsoptimiertes Cyclohexanol-Auxiliar†
- Pages: 1254-1255
- First Published: September 1992
Ein preiswertes, dem I-Phenylmenthol vergleichbares Auxiliar ist trans-2-tert-Butylcy-clohexanol 1, das unter Verwendung des Isoinversionsprinzips und der Struktur-Selektivitäts-Beziehung der Cyclohexanol-Auxiliare strukturminimiert und Induktionspotential-optimiert wurde. Die Herstellung bei der Enantiomere von 1 ist durch enzymatische Verseifung aus einem technischen Produkt im präparativen Maßstab einfach möglich.
Photoschaltbare Assoziation eines Azobenzol-Bipyridinium-Paars mit Eosin: photostimulierte„Ein/Aus”︁-Gastbindung†
- Pages: 1255-1257
- First Published: September 1992
Die reversible photoinduzierte cis-tvans-Isomerisierung der Azobenzoleinheit in 1 kann zusammen mit den deutlich unterschiedlichen Assoziationskonstanten des cis-und des trans-Isomers für die Bindung von 1 an Eosin Y 2 (K = 38000 bzw. 3000 M−1) dazu genutzt werden, einen molekularen Schalter zu konstruieren, bei dem Bildung und Zerfall des Komplexes aus 1 und 2 lichtgesteuert sind. Derartige photoschaltbare Funktionseinheiten haben Bedeutung für die Infor- mationsspeicherung und Signalverarbeitung auf molekularer Ebene.
Alkin(carben)-Komplexe: Stabilisierung einer Zwischenstufe der Carbenanellierung†
- Pages: 1257-1259
- First Published: September 1992
Die Verknüpfung von Alkin- und Carbenligand läßt sich unterdrücken, wenn die beiden Li- ganden wie in 1, M = Mo, W, durch eine starre C2-Brücke verbunden sind. Die Chromverbindung 1, M = Cr, ist reaktiver als ihre höheren Homologen: Sie geht – möglicherweise über eine Zweikern-Zwischenstufe – eine zweifache Alkininsertion in die Metall-Carben-Bindung ein, an die sich eine „Carbendimerisierung”︁ zum Chrysengerüst anschließt.
Ein organischer Festkörper mit α-Helix-artigen Säulen aus verdrillten monomeren Terpyridin-Derivaten†
- Pages: 1259-1261
- First Published: September 1992
Durch Wasserstoffbrückenbindungen Ordnung schaffen – und zwar eine, die produktiv zur Herstellung neuer molekularer Materialien genutzt werden kann, das gelang mit dem durch zwei Trimethylenbrücken in seiner konformativen Beweglichkeit eingeschränkten und mit CO2Et-Gruppen funktionalisierten Terpyridin 1. Es bildet im Festkörper eine α-Helixstruktur, bei der in definierten Abständen eine CO2-Et-Gruppe nach außen ragt.
Pheromone mariner Braunalgen; ein neuer Zweig des Eicosanoidstoffwechsels†
- Pages: 1261-1263
- First Published: September 1992
Indirekte 113Cd, 14N-Kopplungen zur Strukturuntersuchung von Thiocyanato-Cadmium-Komplexen im Festkörper†
- Pages: 1263-1265
- First Published: September 1992
Die Zahl der über das N-Atom koordinierten Thiocyanatoliganden ist nur eine aus einer ganzen Fülle von Informationen, die dem 113Cd-Festkörper-NMR-Spektrum von 1 entnom- men werden können. So scheint beispielsweise auch die Aufspaltung der gut aufgelösten Multiplettsignale (Bild rechts), die von direkten und indirekten 113Cd,14N-Kopplungen herrührt, ein direktes Maß für die Cd-N-Ab- stände zu sein. Lösungs-NMR-Spektren von Metallthiocyanaten liefern dagegen nur sehr wenige Strukturinformationen.
[(η5-Cp)2Sn(μ-η5-Cp)Na·PMDETA], eine Verbindung mit einem trigonal-planaren,„schaufelradförmigen”︁ Triorganostannat-Ion†
- Pages: 1265-1267
- First Published: September 1992
Ein Organozinn(II)-Anion mit drei η5-gebundenen Cp-Liganden und einem trigonal-planar umgebenen Sn-Atom liegt in der Titelverbindung 1 (Strukturbild rechts) vor, die aus CpNa,[Cp2Sn] und PMDETA im Molverhältnis 1:1:1 erhältlich ist. Dieses [Cp3Sn]−-Ionist über eine π-η5-Cp-Brückean das Na+-Ion gebunden. Aufgrund intermolekularer C(H)… Na-Wechselwirkungen liegt 1 als polymeres Netzwerk vor. PMDETA= (Me2NCH3CH2)2,NMe.
Aromatische Borheterocyclen: Erzeugung von 1H-Borepin und Struktur von Tricarbonyl(1-phenylborepin)molybdän†‡
- Pages: 1267-1269
- First Published: September 1992
Ein siebengliedriges aromatisches Ringsystem enthält nach NMR-spektroskopischen Befunden 1H-Borepin 1, die langgesuchte Stammverbindung der Borepine. 1 kann durch C1-H-Austausch aus dem entsprechenden Chlorborepin und Tributylstannan erzeugt werden. Der Borepinring kann in Übergangsmetallkomplexen als η7-koordinierender Ligand fungieren, wie die Strukturdaten von 2 nahelegen.
Die Tandem-Sakurai-Carbonyl-En-Reaktion: eine neue hochstereoselektive sequentielle Transformation und ihre Anwendung bei der Synthese von Steroidderivaten†‡
- Pages: 1269-1270
- First Published: September 1992
In wenigen Schritten gelingt die Synthese des BCD-Teils rnethylsubstituierter Steroide wie 1 aus dem Aldehyd 4. Zentraler Schritt der Synthese ist die im Titel genannte Tandem-Reaktion von 2 nach 3, die – mit unterschiedlicher Stereoselektivität – durch Me3SiOTf oder EtAlCl2 als Mediatoren ermöglicht wird.
Neue, von Tetraethinylethen abgeleitete, kreuzkonjugierte Verbindungen†
- Pages: 1270-1273
- First Published: September 1992
Die oxidative Kupplung eines Tetraethinylethen-Derivates mit einer einzigen freien Ethinyl-Funktion lieferte das Silyl-geschützte Derivat 1a, das durch Röntgenstrukturanalyse charakterisiert und zum ersten C20H6-Isomer 1b protodesilyliert wurde. Die ausgedehnte π-Elektronen-Delokalisation in dem neuen kreuzkonjugierten System wurde durch UV/VIS-Spektroskopie nachgewiesen.
Die selektive Oxidation von Methan zu CO und H2 an Ni/MgO bei niedrigen Temperaturen
- Pages: 1273-1274
- First Published: September 1992
Sehr aktiv, selektiv und produktiv ist ein Ni/MgO-Katalysator bei der Methankonvertierung, der bei relativ niedrigen Temperaturen (300–700°C) H2 und CO im Molverhältnis 2:1 liefert. Durch die hohe Aktivität des Katalysators ist es möglich, bei hohen Raumgeschwindigkeiten (kurze Verweilzeiten) und damit im kinetisch kontrollierten Bereich zu arbeiten.
Pyridin-2-thiolatokomplexe von VII, VIII und VIV mit ungewöhnlichen Strukturmerkmalen†
- Pages: 1275-1277
- First Published: September 1992
Einer der sehr seltenen Thiolatovanadium(II)-Komplexe, [V(tmeda)(pyt)2] 1, entstand bei der Umsetzung von Natriumpyridin-2-thiolat [Na(pyt)] mit [VCl2(tmeda)2]. Durch den kleinen Bißwinkel der pyt−-Liganden ist das Vanadiumzentrum in 1 verzerrt oktaedrisch umgeben. Eine ungewöhnliche μ2-η2:η2-Koordination dieses Liganden konnte in den zweikernigen Komplexen [Na(thf)2V(pyt)4] und [V2O2(pyt)4] 2 beobachtet werden, wobei die pyt−-Brücke in 2 unsymmetrisch ist.
1,3-Dimetallabenzol-Derivate von Niob und Tantal†
- Pages: 1277-1278
- First Published: September 1992
Homodiboriranide, die einfachsten negativ geladenen Homoarene†
- Pages: 1278-1280
- First Published: September 1992
Entschirmung des trikoordinierten C-Atoms, eine Ringinversionsbarriere von ca. 8 kcalmol− (für die Stammverbindung von 1 hatten Olah et al. 8.4 kcalmol−1 ermittelt), ein kurzer B-B-Abstand und eine Faltung wie in 1 und 2 (Substituenten hier nicht spezifiziert) belegen die Homoaromatizität von 3. Sehr ähnliche Daten wurden für die Stammverbindung C2B2H durch ab-initio-Rechnungen erhalten. R = Ph, 2,3,5,6-Me4C6H (Dur).
durch ab-initio-Rechnungen erhalten. R = Ph, 2,3,5,6-Me4C6H (Dur).
Hydridübertragung durch Hydridokomplexe, ionische Hydrierung von Aldehyden und Ketonen sowie Struktur eines Alkoholkomplexes†
- Pages: 1280-1282
- First Published: September 1992
Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt bei der Hydrierung von Aldehyden und Ketonen durch Hydridokomplexe und Säuren scheint die H−-Übertragung vom Komplex auf die protonierte Carbonylverbindung zu sein. Der entstehende Alkohol ist dabei zunächst als Komplexligand gebunden, wie durch die Röntgenstrukturanalyse des Alkoholkomplexes 1 gezeigt werden konnte.
Neuartige Polyethercopolymere mit einer linearen Zentraleinheit und dendritischen Endgruppen†
- Pages: 1282-1285
- First Published: September 1992
Aus hifunktionellen Polyethylenglycolen und dendritischen aromatischen Polyethern 1 mit Bromsubstituenten am Zentrum des Makromoleküls entstehen in einer quantitativ verlaufenden Reaktion Blockcopolymere. Diese bilden in Lösungsmitteln, in denen sich beide Blöcke sehr schlecht oder sich ein Block selektiv gut löst, Micellen und verändern in Abhängigkeit von der Löslichkeit ihre Größe und Form.
Stufenweise Stapelung von drei paramagnetischen Metalloceneinheiten: [CpNiCp(SiMe2)2CpCrCp(SiMe2)2CpNiCp]†
- Pages: 1285-1287
- First Published: September 1992
Für molekulare magnetische Materialien ist 1 der Prototyp eines Stapels, in dem verschiedene paramagnetische Bausteine stufenweise kovalent verknüpft sind. Die Verknüpfung führt zu Antiferromagnetismus. 1 ist als aber Bruchstück eines Polymers aufzufassen, hat den Vorzug, daß es einheitlich zusammengesetzt ist und sich auch in Lösung, z.B. mit Cyclovoltammetrie und NMR-Spektroskopie, untersuchen läß
Matrixisolierung von Diisocyan CNNC†
- Pages: 1287-1289
- First Published: September 1992
Schon vor vier Jahren glaubte man, Diisocyan 2 isoliert zu haben. Die Substanz erwies sich aber dann als das Isomer Cyanisocyan. Durch Mikrowellenentladung in einem Gemisch aus Acetylen 1 und Stickstoff gelang nun die Erzeugung von 2. Dabei werden beide Molekülarten in die Einzelatome gespalten und diese rekombinieren unter anderem zu 2.
Buchbesprechungen
Inorganic biochemistry of Iron Metabolism. (Reihe: Ellis Horwood Series in Inorganic Chemistry.) Von R. R. Crichton. Ellis Horwood, New York, 1991. 263 S., geb. $85.95. — ISBN 0-13-728742-9
- Page: 1290
- First Published: September 1992
Chirality — from weak bosons to the α-Helix. Herausgegeben von R. Janoschek. Springer, Berlin, 1991. XI, 246 S., geb. DM 168.00 — ISBN 3-540-53920-4
- Pages: 1290-1291
- First Published: September 1992
Grundlagen der Festkörperchemie. Von A. R. West. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1992. XII, 455 S., Broschur DM 58.00 — ISBN 3-527-28103-7
- Pages: 1291-1292
- First Published: September 1992