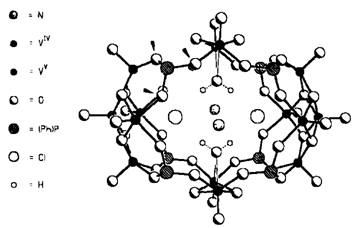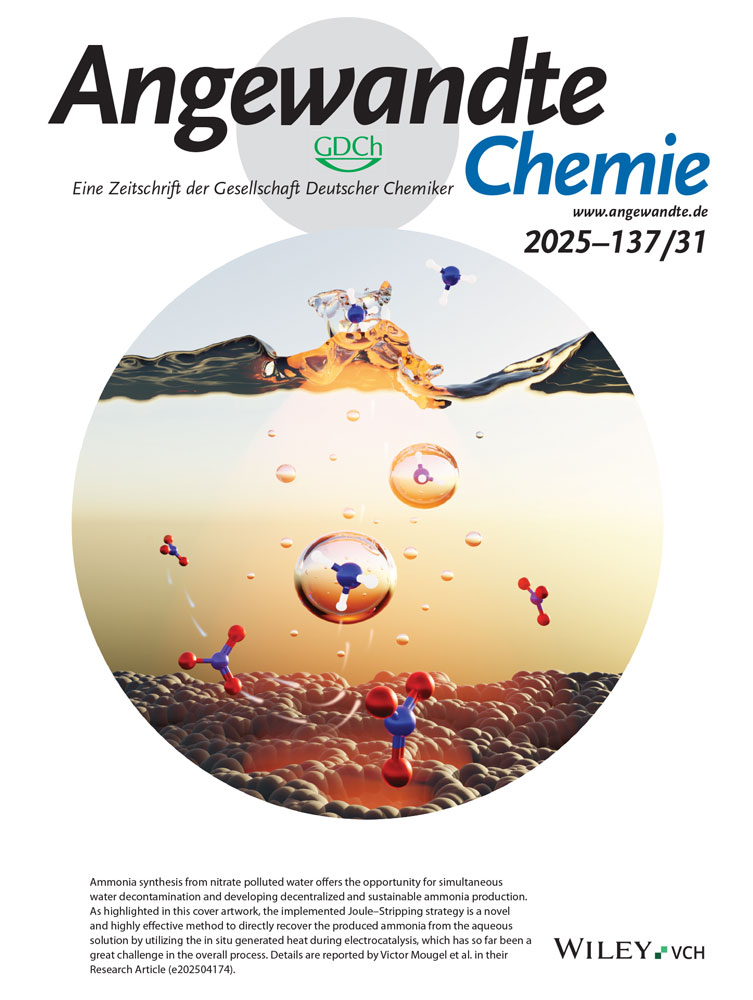Ein neuartiges„Wirt/Gast”︁-System mit einem nanometergroßen Hohlraum mit Kationen und Anionen: [2 NH , 2 Cl− ⊂ V14O22(OH)4(H2O)2(C6H5PO3)8]6−†‡
, 2 Cl− ⊂ V14O22(OH)4(H2O)2(C6H5PO3)8]6−†‡
Corresponding Author
Prof. Dr. Achim Müller
Fakultät für Chemie der Universität, Lehrstuhl für Anorganische Chemie I, Postfach 8640, W-4800 Bielefeld 1
Fakultät für Chemie der Universität, Lehrstuhl für Anorganische Chemie I, Postfach 8640, W-4800 Bielefeld 1Search for more papers by this authorKai Hovemeier Dipl.-Chem.
Fakultät für Chemie der Universität, Lehrstuhl für Anorganische Chemie I, Postfach 8640, W-4800 Bielefeld 1
Search for more papers by this authorRalf Rohlfing Dipl.-Chem.
Fakultät für Chemie der Universität, Lehrstuhl für Anorganische Chemie I, Postfach 8640, W-4800 Bielefeld 1
Search for more papers by this authorCorresponding Author
Prof. Dr. Achim Müller
Fakultät für Chemie der Universität, Lehrstuhl für Anorganische Chemie I, Postfach 8640, W-4800 Bielefeld 1
Fakultät für Chemie der Universität, Lehrstuhl für Anorganische Chemie I, Postfach 8640, W-4800 Bielefeld 1Search for more papers by this authorKai Hovemeier Dipl.-Chem.
Fakultät für Chemie der Universität, Lehrstuhl für Anorganische Chemie I, Postfach 8640, W-4800 Bielefeld 1
Search for more papers by this authorRalf Rohlfing Dipl.-Chem.
Fakultät für Chemie der Universität, Lehrstuhl für Anorganische Chemie I, Postfach 8640, W-4800 Bielefeld 1
Search for more papers by this authorWir danken Herrn Dr. H Bögge für Diskussionsbeiträge im Zusammenhang mit der Röntgenstrukturanalyse.
Professor Wolfgang Beck zum 60. Geburtstag gewidmet
Abstract
Polytope Wirte für mehrere Kationen und Anionen oder Kationen/Anionen-Aggregate waren bisher unbekannt. Das im Titel genannte Anion (Strukturbild rechts) ist ein Wirt/Gast-System, dessen „Wid”︁ – die Schale – aus elektrophilen und nucleophilen Teilen besteht, in die das Kationen/Anionen-Aggregat (NH4)2Cl2, ein Ausschnitt aus dem NH4Cl-Ionengitter, als „Gast”︁ inkorporiert ist.
References
- 1(a)
J.-M. Lehn,
Angew. Chem.
1988,
100,
91;
Angew. Chm. Int. Ed. Engl.
1988,
27,
89;
Angew. Chm. Int. Ed. Engl.
1990,
102,
1347
bzw.
10.1002/ange.19901021117 Google ScholarAngew. Chm. Int. Ed. Engl. 1990, 29, 1304; (b) F. Vögtle, Supramolekulare Chemie, Teubner, Stuttgart, 1989; zur metallunterstützten Organisation beim Aufbau makrocyclischer Wirte vgl. auch10.1007/978-3-663-11771-1 Google Scholar(c) Y. Kobuke, Y. Sumida, M. Hayashi, H. Ogoshi, Angew. Chem. 1991, 103, 1513; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1991, 30, 1496.
- 2
Kürzlich konnte durch Einbau eines Lewis-sauren Zentrums in einen Kronenether erstmals ein Kation una ein Anion komplexiert werden:
M. T. Reetz,
C. M. Niemeyer,
K. Harms,
Angew. Chem.
1991,
103,
1515;
10.1002/ange.19911031123 Google ScholarAngew. Chem. Int. Ed. Engl. 1991, 30, 1472; vgl. zu anorganischen Lewis-sauren Wirtverbindungen auch: X. Yang, C. B. Knobler, M. F. Hawthorne, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1991, 103, 1519 bzw. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1991, 30, 1507.
- 3 Die Bezeichnung Wirt/Gast System soll die Struktur des Anions von 1 widerspiegeln.
- 4 Charakterisierung von 1: IR (KBr, einige charakteristische Banden): v[cm−1] = 1652 (s, δ, H2O und ν, CO), 1466 (m, δas, CH3), 1418 (vw, δas, NH4+), 1387 (m, δs Ch3), 1095 (vs, νas, PO3), 1017 (s, ä, VV=O), 996 (vs, ä, VIV=O). Charakteristische Banden im Raman-Spektrum (Festkörper rotierender Probenpreßling/Λe = 488.0 nm): v[cm−1] = 1026 (vw, äs, PO3), 996 (m, ν, VIV=O); (Λe = 514.5 nm): v[cm−1] = 1025 (w, äs PO3), 993 (m, ä, VIV=O). UV/VIS/NIR (in DMF): v = 37500 (π(CC) → π*(CC)), 31800, 25100 (π(O) → d(V)-CT), 16300 (d(V) → d(V)), 14400 (Intervalence-Charge-Transfer). Magnetismus (Raumtemperatur): μeff/Anion = 6.12 μB üeff/VIV = 1.77 μB. Die Bindungsvalenzsumme ∑ exp (−(R-Ro)/B) (R = V-O-Abstand [pm], Ro = 179 pm, B = 31.9 pm) beträgt für die beiden VV-Zentren 4.94 und für die zwölf VIV-Zentren zwischen 4.04 und 4.18 (nach I. D. Brown in Structure and Bonding in Crystals Vol. II (Hrsg.: M. D. O'Keeffe, A. Nawrotsky), Academic Press, New York, 1981, S. 1).
- 5 1: Korrekte Elementaranalyse. Kristallstrukturanalyse P1, a = 1405.9(4), b = 1473.0(5), c = 1713.1(5) pm, α = 69.32(2), β = 67.37(2), γ = 83.17(3)°, V = 3062.9(16) × 106 pm3, Z = 1, ρber = 1.711 gcm−3; Lösung mit direkten Methoden, R = 0.050 für 11203 unabhängige Reflexe (Fo > 4σ(Fo)). Das gemessene Pulverdiffraktogramm stimmt mit dem aus den Einkristalldaten berechneten überein. Aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegenüber Verwitterung wurden die Kristalle aus der Mutterlauge in Siliconöl eingebettet und die Messung im verschlossenen Kapillarröhrchen bei − 78°C durchgeführt. Weitere Einzelheiten zur Kristallstrukturuntersuchung können beim Fachinformationszentrum Karlsruhe, Gesellschaft für wissenschaftlich-technische Information mbH, W-7514 Eggenstein-Leopoldshafen 2, unter Angabe der Hinterlegungsnummer CSD-56243, der Autoren und des Zeitschriftenzitats angefordert werden.
- 6(a) A. Müller, M. Penk, R. Rohlfing, E. Krickemeyer, J. Döring, Angew. Chem. 1990, 102, 927; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1990, 29, 926; (b) M. T. Pope, A. Müller, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1991, 103, 56 bzw. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1991, 30, 34; vgl. auch (c) W. G. Klemperer, T. A. Marquart, O. M. Yaghi, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1992, 104, 51 bzw. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1992, 31, 49.
- 7 D. D. Heinrich, K. Folting, W. E. Streib, J. C. Huffman, G. Christou, J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1989, 1411.
- 8 Der C6H5PO2-3-Ligand wurde bereits bei Polyoxometallat-Synthesen benutzt, vgl. beispielsweise: W. S. Kwak, M. T. Pope, P. R. Sethuraman, Inorg. Synth. 1990, 27, 123.
- 9 Vgl. a) A. Müller, Nature 1991, 352, 115; (b) A. Müller, E. Krickemeyer, M. Penk, R. Rohlfing, A. Armatage, H. Bögge, Angew. Chem. 1991, 103, 1720; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1991, 30, 1674; (c) M. T. Pope, Nature 1992, 355, 27.
- 10 Durch Kondensation von RPO3-Gruppen konnte man die Generierung eines nucleophilen Coronanden erwarten. Der Grund für das dazu elektronisch inverse Wirt-Verhalten der V/O-Schalen-Systeme liegt an einer (äußerst) schwachen Attraktion der zentralen Anionen durch die Lewissauren VIV/V-Zentren (bei allerdings gleichzeitig sehr schwacher Repulsion durch die O-Atome der Schale). Extended-Hückel-Self-Consistent-Charge- and Configuration(EH-SCCC)-Rechnungen für die Anionen der folgenden Verbindungen (PhCH2NEt3)2[V5O9Cl(tca)4] · MeCN [7], (Me4N)6[V15O36Cl] · 4 H2O (A. Müller, E. Krickemeyer, M. Penk, H.-J. Walberg, H. Bögge, Angew. Chem. 1987, 99, 1060; Angew. Chem. Int. Ed. 1987, 26, 1045) und K9[H4V18O42Cl] · 16 H2O [6a] bestätigen das Bild der attraktiven Wechselwirkungen zwischenelektrophilen V-Zentren und Cl−-Ionen z.B. anhand der signifikant reduzierten negativen Ladungsdichte auf den Cl−-Ionen, wobei bei den größeren Systemen die Wechselwirkung pro V-Cl-Vektor extrem schwach ist (entsprechend dem großen Abstand; A. Müller, D. Sölter, unveröffentlicht).
- 11 Ein Modell für die Geschmackserkennung von Alkalimetallsalzen (Anionen-Paradoxon) ist kürzlich publiziert worden: Q. Ye, G. L. Heck, J. A. DeSimone, Science 1991, 254, 724.
- 12 Der Begriff System bezieht sich hier auch auf eine Menge von Elementen, zwischen denen Wechselwirkungen bestehen; der Begriff Organisation steht hier auch für das Herstellen einer Struktur oder eines geordneten Systems von Elementen (Atomen) oder Subsystemen („Gast/Wirt”︁).
- 13 Anmerkung bei der Korrektur (28. Juli 1992): Aus einer gerade erschienenen Publikation (H. W. Roesky, M. Sotoodeh, M. Noltemeyer, Angew. Chem. 1992, 104, 869; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1992, 31, 864) wird deutlich, daß ein Ion (z. B. Na+), das nach klassischer Auffassung vorwiegend in die Bildung von Ionengittern involviert ist, durch Templatsteuerung in molekularen diskreten Systemen Umgebungen sogar aus sehr harten „Teilchen”︁ (z. B. F−) generieren kann, wie sie topologisch vergleichbar in präorganisierten Wirten - z. B. Kronenethern - vorkommen.
Citing Literature
This is the
German version
of Angewandte Chemie.
Note for articles published since 1962:
Do not cite this version alone.
Take me to the International Edition version with citable page numbers, DOI, and citation export.
We apologize for the inconvenience.