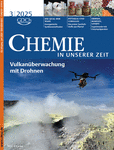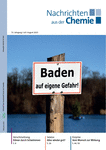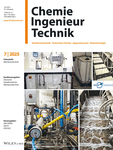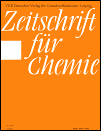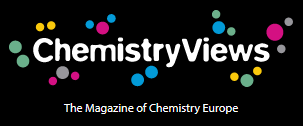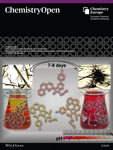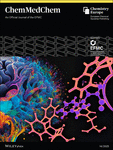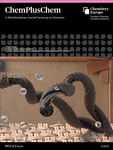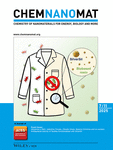Journal list menu
Export Citations
Download PDFs
Ras – ein molekularer Schalter bei der Tumorentstehung
- Pages: 4360-4383
- First Published: 30 November 2000
Durch die Hydrolyse seines fest gebundenen Cofaktors GTP [Gl. (1)] wird das Ras-Protein, ein GTP-bindendes Protein, das als molekularer Schalter fungiert, ausgeschaltet. Wenn diese Reaktion nicht mehr abläuft, wird es zum Onkogen, das an der Bildung von Tumoren beteiligt ist. Dies macht es zu einem attraktiven Target für Antitumorwirkstoffe.
Nematische Flüssigkristalle für Aktiv-Matrix-Displays: Design und Synthese
- Pages: 4384-4405
- First Published: 30 November 2000
Die führende Technologie bei Flachbildschirmen für nahezu alle Anwendungsbereiche sind seit kurzem so genannte Aktiv-Matrix-Flüssigkristall-Displays. Diese Entwicklung führt oft zu extremen Anforderungen an die flüssigkristallinen Substanzen bezüglich ihrer elektrooptischen und viskoelastischen Eigenschaften, ihrer Zuverlässigkeit während des Produktionsprozesses und der Lebensdauer des Displays. Das rationale Design moderner, hochgradig fluorierter Flüssigkristalle (siehe Bild), die diesen Anforderungen genügen, beruht stark auf dem Molecular Modeling.
Ein Eldorado für die homogene Katalyse?
- Pages: 4407-4409
- First Published: 30 November 2000
Der Lockruf des Goldes ertönt nicht nur in den Büchern Jack Londons, auch in den Labors der Katalyseforschung kann es zu einem Goldrausch kommen. Mit hoher katalytischer Aktivität ermöglichen Goldsalze Dominokupplungsreaktionen unter C-Heteroatom- und C-C-Verknüpfung. So sind furylsubstituierte Produkte 2 präparativ einstufig aus jeweils drei Einheiten Allenylketon 1 herstellbar.
Molekulares Gold – mehrkernige Gold(I)-Komplexe
- Pages: 4410-4412
- First Published: 30 November 2000
Die Königin der Metalle bleibt unter ihresgleichen: Aurophilie ist ein Thema von großem Interesse für die Chemie mehrkerniger Gold(I)-Verbindungen. Neuere Arbeiten über Chalkogenid-, Amid- und Mischmetallkomplexe mit Gold(I) führen zu neuen Perspektiven und Strategien zum Aufbau mehrkerniger Gold(I)-Cluster.
Fulleren-Einzelmoleküle und der Welle-Teilchen-Dualismus
- Pages: 4412-4414
- First Published: 30 November 2000
Die wellenartige Natur von Fullerenen konnte durch Untersuchungen der Zeilinger-Arbeitsgruppe in Wien nachgewiesen werden. Ihre Ergebnisse zeigen, dass der Welle-Teilchen-Dualismus auch für Teilchen mit einer molekularen Masse größer als 1000 Da gilt. Es werden sowohl die durchgeführten Experimente als auch die Konsequenzen der Ergebnisse für die Frage, was ein Teilchen ist, diskutiert.
Reexamination of the Evidence for Solvent-Induced Intramolecular Electrophilic Catalysis by a cis Vicinal Hydroxyl Group in Ribonucleoside Phosphorylation Reactions
- Pages: 4415-4417
- First Published: 30 November 2000
Die vicinale Hydroxygruppe beschleunigt durch Bildung der reaktiven, diastereomeren 2′,3′-Nucleosid-Phosphodichloridate 2 a/b die zweite Stufe der Reaktionssequenz, die zu den 2′- und 3′-Dialkylphosphaten 3 und 4 führt. Es gibt – entgegen einem kürzlich vorgeschlagenen Mechanismus – keinen Hinweis auf eine elektrophile Katalyse bei acyclischen Phosphodichloridaten.
New Mesotextured Hybrid Materials Made from Assemblies of Dendrimers and Titanium(IV)-Oxo-Organo Clusters
- Pages: 4419-4424
- First Published: 30 November 2000
„Trockene“ Synthesebedingungen werden bei der Herstellung maßgeschneiderter mesostrukturierter Hybridmaterialien, die aus Dendrimeren (siehe Bild) und [Ti16O16(OEt)32]-Clustern bestehen, benötigt. Sie verhindern die Bildung einer kontinuierlichen anorganischen Phase. Die Form der organischen Einheiten erzwingt eine lokale Symmetrie, die eine weit reichende Ordnung in der Textur zur Folge hat. (R=CH2OH, CH2CH=CHCOOH.)
Functionalized Fullerene as an Artificial Vector for Transfection
- Pages: 4424-4427
- First Published: 30 November 2000
DNA-Erkennung durch Fullerene: Duplex-DNA wird durch ein zweifach funktionalisiertes Fulleren (siehe Bild) gebunden; dies ermöglicht die Exprimierung der DNA in Säugerzellen. Das molekulare Design stützt sich auf das Zusammenspiel des hydrophoben Fullerenkerns und der beiden räumlich getrennten kationischen Reste. Nach der Komplexbildung mit dem Fulleren wird Plasmid-DNA (modifiziert mit einem Gen für ein fluoreszierendes Reporterprotein) durch Phagocytose von Kulturzellen aufgenommen und in bis zu 15 % dieser Zellen exprimiert.
Ternary Complexes Between DNA, Polyamine, and Cucurbituril: A Modular Approach to DNA-Binding Molecules
- Pages: 4427-4430
- First Published: 30 November 2000
Ein bifunktioneller Linker stellt die Verbindung her: Schematisch dargestellt ist ein Konzept, nach dem Cucurbit[6]uril C, das sonst nicht an DNA bindet, über einen Linker (B) an einen DNA-Doppelstrang (A) gebunden werden kann. Zu diesem Zweck wurde der Linker mit einer Acridin-Einheit für die Bindung von DNA und einer Spermin-Einheit für die Bindung von Cucurbituril ausgestattet.
Complexation of Antimony(III) by Trypanothione
- Pages: 4430-4432
- First Published: 30 November 2000
Antimon und Antileishmaniose: Die Wirksamkeit von antimonhaltigen Verbindungen gegen Leishmaniose beruht möglicherweise auf einem 1:1-Komplex aus Sb und Trypanothion, einem für das Wachstum und Überleben von einzelligen Parasiten der Familie der Trypanosomatidae, z. B. Leishmania, essentiellen Gluthathion-Spermidin-Konjugat. Die massenspektrometrischen und 2D-NMR-spektrokopischen Daten dieses Komplexes legen eine Struktur nahe, in der das SbIII-Atom mit den S-Atomen der Cysteinreste und einem O-Atom aus einem Wassermolekül (OW) koordiniert ist (siehe Bild).
Supramolecular Modification of the Periphery of Dendrimers Resulting in Rigidity and Functionality
- Pages: 4432-4435
- First Published: 30 November 2000
Die Anknüpfung von 32 Pinzetten an der Peripherie eines Poly(propylenimin)-Dendrimers der fünften Generation, die Glycinylharnstoff-modifizierte Moleküle selektiv binden, stellt ein neues Konzept zur Funktionalisierung von Dendrimeren dar (siehe schematische Darstellung). Zukünftige Anwendungen dieses Konzepts, z. B. in der Katalyse oder beim Wirkstofftransport, sind möglich.
Charge-Transfer Diamondoid Lattices: An Unprecedentedly Huge and Highly Catenating Diamondoid Network Arising from a Tetraphenol as a Tetrahedral Node and Benzoquinone as a Linear Spacer
- Pages: 4436-4438
- First Published: 30 November 2000
Tetrakis[4-(3-hydroxyphenyl)phenyl]methan 1 und Benzochinon organisieren sich mit Hilfe von Wasserstoffbrückenbindungen zum größten bekannten diamantartigen Gitter (2, 76 Å lang). Die ausgeprägteste jemals beschriebene gegenseitige Durchdringung der Netze (11fach) ergibt eine Phenol-Chinon-Charge-Transfer-Stapelung. Ein Ausschnitt des Gitters 2 ist schematisch wiedergegeben; die vierfach koordinierten Einheiten entsprechen 1, die linearen Blöcke Benzochinon und die gestrichelten Linien Wasserstoffbrückenbindungen.
Catalyst Screening Using an Array of Thermistors
- Pages: 4438-4441
- First Published: 30 November 2000
Eine attraktive Alternative zur IR-Thermographie für das Screening kombinatorischer Katalysatorbibliotheken: Mithilfe einer Anordnung von 96 Thermistoren wurden die Temperaturänderungen registriert, die bei (bio)chemischen Reaktionen auftreten (siehe schematische Darstellung). Diese Methode ist empfindlicher als die IR-Thermographie, und es lassen sich zuverlässig Temperaturänderungen von nur 100 μK nachweisen.
[Cu(2-pyrazinecarboxylato)2HgI2]⋅HgI2: An Open Noninterpenetrating CuII–HgII Mixed-Metal Cuboidal Framework Encapsulating Nearly Linear HgI2 Guest Molecules
- Pages: 4441-4443
- First Published: 30 November 2000
Einschluss eines freien anorganischen Moleküls: Neutrale, fast lineare HgI2-Gastmoleküle werden in den quadratischen Kanälen von [Cu(2-Pyrazincarboxylato)2HgI2]⋅HgI2 eingeschlossen, einem durch Hydrothermalsynthese erhaltenen CuII-HgII-Koordinationspolymer mit einer einzigartigen, cuboiden offenen Gerüststruktur. Das Bild zeigt einen Gerüstausschnitt, der ein HgI2-Molekül umgibt.
Synthesis and Structure of a Monomeric Aluminum(I) Compound [{HC(CMeNAr)2}Al] (Ar=2,6–iPr2C6H3): A Stable Aluminum Analogue of a Carbene
- Pages: 4444-4446
- First Published: 30 November 2000
Ein „Aluminiumcarben“: [{HC(CMeNAr)2}Al] zeigt ein planares heterocyclisches Al-N-C-C-C-N-Sechsringsystem mit einem zweifach koordinierten Aluminiumatom mit freiem Elektronenpaar (siehe Bild), wodurch die Verbindung den Charakter einer Lewis-Base erhält. Hergestellt wird das Monomer durch Reduktion des entsprechenden Aluminium(III)-diiodids.
Alumoxane Hydride and Aluminum Chalcogenide Hydride Compounds with Pyrazolato Ligands
- Pages: 4446-4449
- First Published: 30 November 2000
Zwei fünffach koordinierte Aluminiumatome enthält der planare Al2O2-Kern in 1, der zudem ungewöhnlich kurze Al-O-Bindungen aufweist. 1 wurde aus einem Aluminiumdihydrid-Komplex und Dioxan synthetisiert. Aus dem Edukt können durch Reaktionen mit S, Se und Te weitere chalkogenverbrückte Aluminiumhydride entstehen.
Stereochemical Assignment of the C21–C38 Portion of the Desertomycin/Oasomycin Class of Natural Products by Using Universal NMR Databases: Prediction
- Pages: 4449-4451
- First Published: 30 November 2000
Prognostizierbare Konfiguration: Durch die stereoselektive Synthese des gemeinsamen C21–C38-Abbauprodukts von Oasomycin A und B wurde die relative Konfiguration dieses Ringabschnitts der Naturstoffe bestätigt, die vorhergesagt worden war auf der Grundlage einer vergleichenden Studie der chemischen Verschiebungen des C21–C38-Abschnitts der Naturstoffe und der Diastereomere des Abbauprodukts.
Stereochemical Assignment of the C21–C38 Portion of the Desertomycin/Oasomycin Class of Natural Products by Using Universal NMR Databases: Proof
- Pages: 4452-4454
- First Published: 30 November 2000
Prognostizierbare Konfiguration: Durch die stereoselektive Synthese des gemeinsamen C21–C38-Abbauprodukts von Oasomycin A und B wurde die relative Konfiguration dieses Ringabschnitts der Naturstoffe bestätigt, die vorhergesagt worden war auf der Grundlage einer vergleichenden Studie der chemischen Verschiebungen des C21–C38-Abschnitts der Naturstoffe und der Diastereomere des Abbauprodukts.
Tuning the Regiospecificity of Cleavage in FeIII Catecholate Complexes: Tridentate Facial versus Meridional Ligands
- Pages: 4454-4457
- First Published: 30 November 2000
Der Koordinationsmodus bestimmt die Regiospezifität: Ein facialer dreizähniger Ligand ermöglicht es bei Eisen-Brenzcatechinat-Komplexen (siehe Schema), dass O2 in Nachbarschaft zum Brenzcatechin-Dianion an das Eisenzentrum koordiniert und es dann so angreifen kann, dass eine Spaltung der C2-C3-Bindung erfolgt („Extradiol-Spaltung“). Meridionale dreizähnige Liganden haben dagegen eine Spaltung der C1-C2-Bindung („Intradiol-Spaltung“) zur Folge oder aber die 1,2-Chinon-Bildung.
An Unusually Shallow Distance-Dependence for Triplet-Energy Transfer
- Pages: 4457-4460
- First Published: 30 November 2000
Weit reichende Wechselwirkungen über 50 Å ermöglichen Elektronentransfer in konformativ eingeschränkten Ru/Os-Polypyridin-Komplexen (siehe Bild). Die Dynamik des intramolekularen Elektronenaustauschs deutet darauf hin, dass die verbindenden 1,4-Diethinyl-2,5-dialkoxybenzol-Einheiten unabhängig voneinander Superaustausch vermitteln können. Selbst bei einer Verknüpfung von fünf dieser Einheiten gibt es keinen Hinweis auf signifikante Population eines Triplettzustands im Bereich der Verknüpfungseinheiten.
The Distinct Effect of the o-Carboranyl Fragment: Its Influence on the I−I Distance in R3PI2 Complexes
- Pages: 4460-4462
- First Published: 30 November 2000
Die kürzeste I-I-Bindung in der R3PI2-Chemie ist entdeckt! Durch Verwendung geeigneter Substituenten am elektronenziehenden o-Carboranyl-Fragment kann die I-I-Bindung kontinuierlich bis zur Rekordlänge verkürzt werden. Die Verbindung (1-PiPr2-2-Me-1,2-C2B10H10)⋅I2 wird unter bindungstheoretischen Gesichtspunkten diskutiert und kann als molekularer Charge-Transfer-Komplex aufgefasst werden, dessen Struktur an ein Steuerrad mit Spake erinnert (siehe Bild).
Remote Enantioselection Transmitted by an Achiral Peptide Nucleic Acid Backbone
- Pages: 4462-4465
- First Published: 30 November 2000
Der Einbau von nur zwei D-Nucleotiden in PNA-Monomeren am N-Terminus eines Stranges einer decameren PNA-Doppelhelix führt zur Bildung von fast vollständig homochiralen, rechtsgängigen Doppelsträngen (siehe Schema). Das chirale dimere Zentrum induziert eine enantioselektive Ligation. Möglicherweise könnte hiermit das Problem der „Kreuz-Inhibierung“ gelöst werden und eine Erklärung für den evolutionären Übergang von präbiotischem achiralem Material zu biologischem homochiralem genetischem Material gefunden werden.
ZnBr2-Catalyzed Insertions of Carbonyl Compounds into Silacyclopropanes: Regiochemical Reversal Dependent on Metal Salt
- Pages: 4465-4469
- First Published: 30 November 2000
Überraschende Regiokontrolle durch einen Katalysator: Bei der durch Kupfer- oder Zinksalze katalysierten Insertion verschiedener Carbonylverbindungen in Silacyclopropane wurden 1,2- bzw. 1,3-Regioisomere mit >99:1 Regioselektivität gebildet (siehe Schema). Die Katalyse durch ZnBr2 führt zu bislang auf anderem Wege nicht zugänglichen Produkten. Der Einfluss von Zusätzen wie H2O, Menthol und Di-tert-butylpyridin auf die Regioselektivität der Insertion wird beschrieben.
A Linker Scaffold to Present Dimers of Pharmacophores Prepared by Solid-Phase Syntheses
- Pages: 4469-4471
- First Published: 30 November 2000
Die Nachahmung oder Blockierung von Protein-Protein-Kontakten erfordert kleine Linkermoleküle, die Pharmakophore so präsentieren, dass diese isolierte Stellen auf der Proteinoberfläche verbinden können. Hier wird die Herstellung eines solchen Linkers beschrieben. Die orthogonalen Schutzgruppen am Linker erlauben es, ihn unterschiedlich zu funktionalisieren. Die anschließende Abspaltung vom Harz gelingt mit Reagentien, die in biologischen Tests nicht stören.
First Generation Light-Harvesting Dendrimers with a [Ru(bpy)3]2+ Core and Aryl Ether Ligands Functionalized with Coumarin 450
- Pages: 4471-4475
- First Published: 30 November 2000
Eine neue Klasse lichtsammelnder Dendrimere auf der Basis organisch/anorganischer Hybridverbindungen mit interessanten photophysikalischen Eigenschaften wird beschrieben. Der anorganische Kern zeigt sensibilisierte Emission mit Abklingzeiten im Mikrosekundenbereich, was viel versprechend für Fluoreszenzanwendungen ist.
Highly Regio- and Enantioselective Reduction of 3,5-Dioxocarboxylates
- Pages: 4476-4478
- First Published: 30 November 2000
Alkoholdehydrogenase aus Lactobacillus brevis (LBADH) katalysiert hochselektiv die Reduktion von 3,5-Dioxocarboxylaten in Position C-5 (siehe Schema). In Anlehnung an die natürlichen Transformationen des Polyketidstoffwechsels wurde ein chemoenzymatischer Zugang zu nahezu enantiomerenreinen 3,5-Dihydroxycarboxylaten entwickelt. Der entscheidende enzymatische Schritt kann in einem präparativ attraktiven Maßstab durchgeführt werden.
Revision of the Absolute Configuration of Salicylihalamide A through Asymmetric Total Synthesis
- Pages: 4478-4480
- First Published: 30 November 2000
Eine E-selektive Ringschluss-Metathese war der Schlüsselschritt beim Aufbau des Makrocyclus von (+)-Salicylihalamid A 1. Die Synthese führte zu einer Revision der Zuordnung der absoluten Konfiguration des natürlichen (−)-Salicylihalamids A 2, einer strukturell einzigartigen Substanz, deren Antitumorwirkung möglicherweise auf einem neuartigen Mechanismus beruht.
Clean and Efficient Catalytic Reduction of Perchlorate
- Pages: 4480-4483
- First Published: 30 November 2000
Perchlorat auf der schwarzen Liste: Die Umweltschutzbehörde der USA hat Perchlorat kürzlich als einen Wasserschadstoff anerkannt. Seine Entfernung aus dem Trinkwasser ist aufgrund seiner guten Löslichkeit und kinetischen Inertheit leider sehr schwierig. Abhilfe ist jedoch in Aussicht: Mithilfe organischer Sulfide als Sauerstoffacceptoren katalysieren Oxorhenium(V)-Oxazolin-Komplexe die Reduktion von Perchlorat zu Chlorid; diese Reaktion verläuft außergewöhnlich schnell, und es wird keine Desaktivierung des Katalysators beobachtet [Gl. (1)].
The First Entry to Complex Bakkanes: A Highly Effective Retroaldol–Aldol-Based Approach to (−)-Bakkenolides III, B, C, and H
- Pages: 4484-4486
- First Published: 30 November 2000
Eine neuartige SmI2-vermittelte chemoselektive zweifache Reduktion eines Epoxyketons und eine thermodynamisch gesteuerte Retroaldol-Aldolreaktion ermöglichten die Synthese von enantiomerenreinem (−)-Bakkenolid III 1. Diese Verbindung diente als Plattform für den Zugang zu ausgewählten bioaktiven C1,C9-Diacyloxybakkenoliden.
A Tandem Sulfur Transfer/Reduction/Michael Addition Mediated by Benzyltriethylammonium Tetrathiomolybdate
- Pages: 4486-4489
- First Published: 30 November 2000
Mit einer Domino-Reaktionssequenz, bei der man die Redoxchemie von [BnNEt3]2MoS4 nutzt, gelingt die Bildung und Spaltung von Disulfiden (siehe Schema). Diese Strategie führte zur Entwicklung einer effektiven Eintopfreaktion mit der Sequenz Schwefeltransfer/Reduktion/Michael-Addition.
Transition Metal Complexes as Photosensitizers for Near-Infrared Lanthanide Luminescence
- Pages: 4489-4491
- First Published: 30 November 2000
Sensibilisierte Nah-Infrarot-Lumineszenz (NIR-Lum.) wurde bei Lanthanoiden (Ln) erstmals beobachtet (siehe Schema; Exc.=Anregung). Ermöglicht wurde dies durch Energietransfer (ET) von Ferrocen- oder Tris(bipyridin)ruthenium-funktionalisierten lichtsammelnden Einheiten. Dank der Luminszenz des Triplettzustands des Ru-Donors ließ sich der Sensibilisierungsvorgang detailliert untersuchen.
A Novel Iron-Based Catalyst for the Biphasic Oxidation of Benzene to Phenol with Hydrogen Peroxide
- Pages: 4491-4493
- First Published: 30 November 2000
Drastisch weniger mehrfach oxygenierte Arene entstehen als Nebenprodukte bei der eisenkatalysierten Oxidation von Benzol zu Phenol mit H2O2 in einem MeCN/H2O-Zweiphasensystem. Mit 5-Carboxy-2-methylpyrazin-N-oxid als Eisenligand konnte dabei Benzol zu 8.6 % umgesetzt werden, wobei die Selektivität der Reaktion bezogen auf Benzol und H2O2 bei 97 bzw. 88 % lag.
Cyclodextrin Bilayer Vesicles
- Pages: 4494-4496
- First Published: 30 November 2000
Ausschließlich aus nichtionischen Cyclodextrin-Amphiphilen bestehen die schematisch dargestellten Doppelschichtvesikel in Wasser. Die amphiphilen Komponenten wurden durch Hydroxyethylierung von Heptakis(6-alkylsulfanyl)-β-Cyclodextrinen erhalten. Solche Vesikel vereinen die Eigenschaften von Liposomen und makrocyclischen Wirtmolekülen, und sie schaffen neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Carrier- und Wirkstofftransportsystemen.
Selective Enhancement of the One-Electron Oxidation of Guanine by Base Pairing with Cytosine
- Pages: 4497-4499
- First Published: 30 November 2000
Das Oxidationspotential des Guanins wird durch eine selektive Wasserstoffbrückenbindung zu einem Cytosinrest um 100 mV verringert. Dies konnte bei Untersuchungen des Effekts der Basenpaarung zwischen Guanin und anderen Nucleosiden auf die Geschwindigkeitskonstante des Elektronentransfers von Guanin zu dem angeregten Elektronenacceptormolekül N,N′-Dibutylnaphthaldiimid (NDI, siehe Schema) gezeigt werden. Ausschließlich für das G:C-Basenpaar wurde eine Steigerung des Elektronentranfers beobachtet.
Synthese der ersten Mitglieder der fundamentalen Kohlenwasserstoffklasse der Dendralene
- Pages: 4501-4503
- First Published: 30 November 2000
Eine vernachlässigte Gruppe hochungesättigter Kohlenwasserstoffe – als solche wurden die Dendralene vor 16 Jahren in einem Aufsatz in der Angewandten Chemie bezeichnet. Die Vernachlässigung soll nun ein Ende haben! Die bislang unbekannten [5]-, [6]- (siehe Schema) und [8]Dendralene wurden durch Thermolyse maskierter Sulfolen-Derivate erhalten, die durch Stille-Kupplungen aufgebaut wurden. Dank dieser Methode sind auch das [3]- und das [4]Dendralen besser zugänglich, deren vollständige spektroskopische Daten hier erstmals präsentiert werden.
Chemo-, regio- und stereoselektive Cyclisierung von 1,3-Bis(trimethylsilyloxy)-1,3-butadienen mit funktionalisierten Epoxiden
- Pages: 4503-4506
- First Published: 30 November 2000
Sehr gute Chemo-, Regio- und Stereoselektivitäten wurden bei der Cyclisierung von 1,3-Bis(trimethylsilyloxy)-1,3-butadienen – elektroneutralen Äquivalenten von 1,3-Dicarbonyldianionen – mit funktionalisierten Epoxiden erzielt [Gl. (1); R1, R2, R5=H, Me; R3=OMe, OEt, Ph, CH2OMe; R4=H, Me, Cl, Br, OBn, CO2Et, CH2CO2Et]. Diese Reaktion eröffnet einen bequemen Zugang zu einer großen Bandbreite funktionalisierter 2-Alkylidentetrahydrofurane, die von pharmakologischer Relevanz und nützliche Bausteine zur Synthese von Naturstoffen (z. B. Methylnonactat) sind.
Verwundungsaktivierte chemische Verteidigung in einzelligen planktonischen Algen
- Pages: 4506-4508
- First Published: 30 November 2000
Die schnelle oxidative Spaltung von C20-Fettsäuren zu α,β,γ,δ-ungesättigten Aldehyden tritt unmittelbar nach der Verwundung von einzelligen Algen (Diatomeen) des Phytoplanktons auf (siehe Schema). Durch diese verwundungsaktivierte chemische Verteidigung werden hohe lokale Konzentrationen der Metaboliten im Zielorganismus erreicht.
Kombinatorische Festphasensynthese von multivalenten cyclischen Neoglycopeptiden
- Pages: 4508-4512
- First Published: 30 November 2000
Konformativ eingeschränkt und multivalent sind cyclische Neoglycopeptide wie 1, deren konvergente Festphasensynthese auf effiziente Weise durch Umsetzung eines aktivierten Carbonats mit immobilisierten Cyclopeptiden, welche freie Aminoseitengruppen tragen, gelingt. Die so erhältlichen Bibliotheken aus Glycoclustern eignen sich für das Screening auf Lectinbindungseigenschaften.
„Remote Stereocontrol“ in der Organokupferchemie: hoch enantioselektive Synthese von Vinylallenen durch 1,5-Substitution von Eninacetaten
- Pages: 4512-4514
- First Published: 30 November 2000
Eines der seltenen Beispiele für „remote stereocontrol“ in der Organokupferchemie konnte durch die hoch enantioselektive 1,5-Substitution chiraler Eninacetate 1 realisiert werden. Die für Diels-Alder-Reaktionen interessanten Vinylallene 2 wurden mit 91–99 % ee erhalten.
Achtgliedrige Carbocyclen durch eine der Dötz-Reaktion analoge Umsetzung
- Pages: 4514-4516
- First Published: 30 November 2000
Die geometrischen Einschränkungen der Cyclobuteneinheit im Ausgangskomplex, einem Fischer-Dienylcarbenkomplex, sind vermutlich die Ursache für die erstaunliche Bildung von achtgliedrigen Carbocyclen bei der Umsetzung dieser Komplexe mit Alkinen [Gl. (1)]. Im Unterschied zur Dötz-Reaktion findet hier keine Sechs-, sondern eine Acht-Elektronen-Cyclisierung statt.
Identifizierung eines neuen Sexualpheromons aus Sicherungsfäden der tropischen Jagdspinne Cupiennius salei
- Pages: 4517-4518
- First Published: 30 November 2000
Das Werbungsverhalten induzierende Pheromon von weiblichen Cupiennius-salei-Spinnen wurde durch NMR-Untersuchungen und Synthese als der asymmetrische Citronensäuredimethylester 1 identifiziert. Nur das (S)-Enantiomer ist biologisch aktiv. Diese Identifizierung erlaubte zum ersten Mal die Charakterisierung eines Pheromonsensillums bei Spinnen.
Selektive Trimerisierung von α-Olefinen mit Triazacyclohexan-Komplexen des Chroms als Katalysatoren
- Pages: 4519-4521
- First Published: 30 November 2000
Olefintrimere können selektiv aus α-Olefinen mit n-Alkyl-substituierten Triazacyclohexan-CrCl3-Komplexen als Katalysatoren in Gegenwart von Methylalumoxan (MAO) synthetisiert werden.
Analyse des Pheromonbindeprotein-Pheromon-Komplexes des Seidenspinners durch Elektrospray-Ionisierungs-Massenspektrometrie
- Pages: 4521-4523
- First Published: 30 November 2000
Nichtdenaturierende Bedingungen waren die Voraussetzung dafür, dass ein Komplex aus dem Sexualpheromon Bombykol 1 und dem Pheromonbindeprotein (PBP) des Seidenspinners Bombyx mori mit Elektrospray-Ionisierungs-Massenspektrometrie (ESI-MS) untersucht werden konnte. Es konnten Informationen über die Spezifität der Bindung zum Pheromon 1 und anderen Liganden gewonnen werden.
Das Hexaazidogermanat(IV)-Ion – Synthesen, Strukturen und Reaktionen
- Pages: 4524-4527
- First Published: 30 November 2000
Ideale S2-Symmetrie weist das [Ge(N3)6]2−-Ion 1 im Kristall seines [N(PPh3)2]-Salzes auf, während Dichtefunktionalrechnungen eine S6-symmetrische Minimumstruktur von 1 voraussagen. Kleine interionische Na-N-Abstände führen zu einer Symmetrieerniedrigung des Anions auf C1 in einkristallinem [Na2(thf)3(Et2O)][Ge(N3)6], dem Produkt der Umsetzung von GeCl4 mit NaN3. Mit Lewis-Basen reagiert 1 zu Derivaten des lange gesuchten Tetraazids Ge(N3)4 (2; L L=2,2′-Bipyridin, 1,10-Phenanthrolin).
L=2,2′-Bipyridin, 1,10-Phenanthrolin).
Eine neue Klasse leicht zugänglicher, Carbonat-analoger μ3-Liganden und ein Koordinationsoligomer von Proteingröße und „Doughnut-Form“
- Pages: 4527-4530
- First Published: 30 November 2000
Auf Guanidin aufbauende Liganden wurden sehr einfach zugänglich. Diese Liganden können grundsätzlich vielfältig verändert werden und in anionischer Form gleichzeitig drei Metallzentren in geringem Abstand voneinander chelatartig binden (siehe Bild). Ein Oligomer aus 24 Cd-Zentren, 12 Liganden des gezeigten Typs und 6 dazu isomeren Liganden wurde ebenfalls charakterisiert; es bildet einen Ring mit einem Durchmesser von >30 Å.
Katalytische enantioselektive Fluorierung von β-Ketoestern
- Pages: 4530-4533
- First Published: 30 November 2000
Isolierte und kristallisierte [Ti(TADDOLato)]-Komplexe dienen als Katalysatoren für die erste katalytische enantioselektive (bis zu 90 % ee) C-F-Verknüpfung: die Fluorierung von β-Ketoestern mit dem N-Fluortriethylendiammmonium-Salz F-TEDA [Gl. (1)]. TADDOL=2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-Tetraaryl-1,3-dioxolan-4,5-dimethanol.
Oktaedrisches SeO66− und quadratisch-pyramidales SeO54−, zwei neue Oxoselenatanionen
- Pages: 4533-4535
- First Published: 30 November 2000
Unter Hochdruck wurde gearbeitet, um das neue Oxoselenat Na4SeO5 zu erhalten, während ein weiteres Oxoselenat, Na6Se2O9, auch unter Normaldruck zugänglich ist. Beide bereichern die bis jetzt bekannten Oxoselenat(VI)-Ionen SeO42− (Tetraeder) und SeO54− (trigonale Bipyramide) um zwei weitere Anionenpolyeder, nämlich um ein quadratisch-pyramidales Pentaoxoselenat und um oktaedrisches SeO66− (siehe Bild).
Totalsynthese von (+)-Ratjadon
- Pages: 4535-4538
- First Published: 30 November 2000
Die Verknüpfungen dreier Fragmente durch eine Wittig-Reaktion und eine anschließende selektive Heck-Reaktion bilden die Schlüsselschritte der ersten Totalsynthese des cytotoxisch sowie antibiotisch wirksamen Polyketids Ratjadon. Mit dieser Synthese wurde die absolute Konfiguration des Naturstoffs aufgeklärt. Auf diesem Weg sollten sich auch gezielt Strukturanaloga herstellen lassen, mit denen die von Ratjadon beeinflussten biologisch aktiven Zentren untersucht werden können.
Ein durch Doxycyclin reguliertes allosterisches Ribozym
- Pages: 4538-4542
- First Published: 30 November 2000
Niedrige Konzentrationen des Antibiotikums Doxycyclin genügen, um die Aktivität eines allosterischen Hammerhead-Ribozyms zu steuern (schematisch gezeigt). Dieses wurde durch allosterische Selektion einer RNA-Bibliothek erhalten, die an die Helix II des Ribozyms fusioniert war. Solche molekularen Schalter könnten zur Steuerung der Genexpression transgener Organismen mittels beliebiger kleiner organischer Moleküle eingesetzt werden.
Homoleptische Phosphaniminato-Komplexe von Seltenerdelementen als Initiatoren für die ringöffnende Polymerisation von Lactonen
- Pages: 4542-4544
- First Published: 30 November 2000
Als Cyclopentadienid-Äquivalente sind die ersten homoleptischen Phosphaniminato-Komplexe von Seltenerdelementen mit der sehr kleinen Koordinationszahl 4, wie die gezeigte Ytterbiumverbindung, vorzügliche Initiatoren für die ringöffnende Polymerisation von Lactonen.
Ein kombinatorisches Testverfahren für Trägerkatalysatoren für die heterogene Olefinpolymerisation
- Pages: 4544-4547
- First Published: 30 November 2000
In einem einzigen Experiment lassen sich in einem kombinatorischen Verfahren mehrere trägergebundene Zirconocenkatalysatoren für die Olefinpolymerisation erproben. Die von einem fluoreszenzmarkierten Katalysator produzierten Polyethenteilchen lassen sich anhand ihrer Farbe leicht trennen und charakterisieren (siehe fluoreszenzmikroskopische Aufnahme).
Maßgeschneiderte Alken-Oligomerisierung mit Zeolith H-ZSM-57
- Pages: 4547-4550
- First Published: 30 November 2000
Die einzigartige Porenstruktur von saurem Zeolith ZSM-57 erzwingt die kreuzweise Anordnung leichter Alkene und damit deren selektive Dimerisierung zu C6- bis C12-Oligomeren (siehe Bild). Die in anderen sauren Zeolithen stattfindende Übertragung des allylischen Wasserstoffatoms und Desaktivierungen sind in ZSM-57 so wirksam unterdrückt.
Tribochemische Aktivierung von Eisenoxid für die Reduktion von NO mit CO: Wie Gitterbaufehler die katalytische Aktivität beeinflussen können
- Pages: 4551-4554
- First Published: 30 November 2000
Rost statt Platin? Durch tribochemische Aktivierung kann massives gewöhnliches Eisenoxid in einen effizienten und stabilen Katalysator verwandelt werden. Gitterbaufehler, die an der Oberfläche den NO-Zerfall katalysieren, verhindern im Volumen die Beweglichkeit der Eisenionen und stabiliseren so den Katalysator gegenüber der Reduktion durch CO.



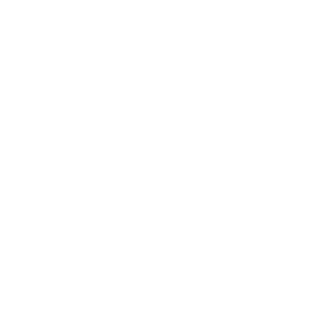
112:23<>1.0.co;2-b.cover.gif)