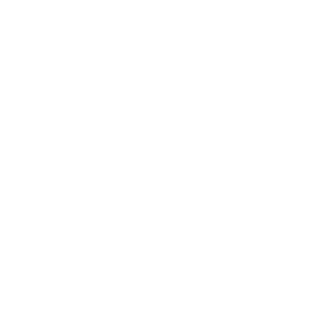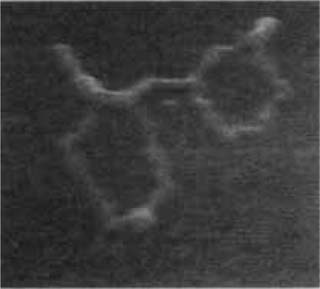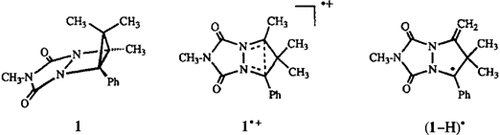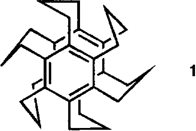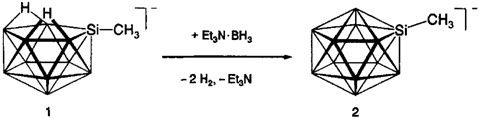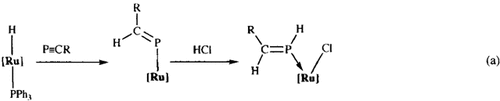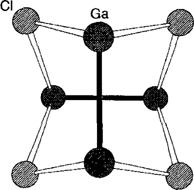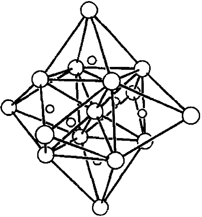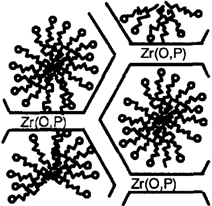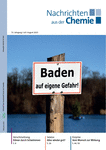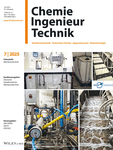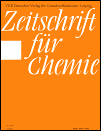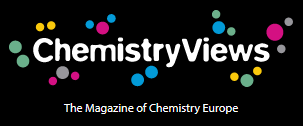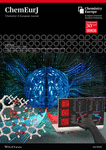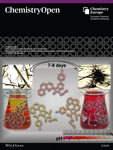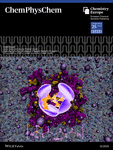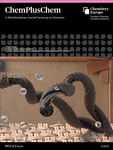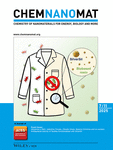Journal list menu
Export Citations
Download PDFs
Titelbild
Impressum
Graphisches Inhaltsverzeichnis
Editorial
Aufsätze
Die Schenck-En-Reaktion: eine diastereoselektive Oxyfunktionalisierung mit Singulettsauerstoff für präparative Anwendungen†‡
- Pages: 519-538
- First Published: 1. März 1996
Die Zähmung des widerspenstigen Singulettsauerstoffs gelingt durch mehrere Faktoren: Sterische, stereo-elektronische, elektronische und konformative Effekte unterschiedlicher funktioneller Gruppen X spielen eine bedeutende Rolle bei der Festlegung der Angriffsrichtung des Singulettsauerstoffmoleküls auf Alkene [Gl. (a)]. Diese Schenck-Reaktion, eine leider viel zu wenig beachtete En-Reaktion, liefert so diastereoselektiv oxyfunktionalisierte Verbindungen, was ihre Nützlichkeit für die organische Synthese unterstreicht.
Elektronendomänen und das VSEPR-Modell der Molekülgeometrie
- Pages: 539-560
- First Published: 1. März 1996
Leichter anzuwenden als das ursprüngliche Modell und durch die Analyse der Elektronendichteverteilung mit Hilfe des Laplace-Operators gestützt ist die hier vorgestellte neue Form des VSEPR-Modells. Sie basiert auf der Definition von Elektronendomänen und eignet sich als Grundlage für das qualitative Verständnis der Strukturen einer Vielzahl von Molekülen, einschließlich der von Metallverbindungen. Analysen des Laplace-Operators der Valenz- und Rumpfelektronendichten liefern häufig auch plausible Erklärungen dafür, warum manche Moleküle nicht die nach dem VSEPR-Modell zu erwartende Struktur haben.
Highlights
Löcher in chemisch variabler Umgebung: mesoporöse Metalloxide
- Pages: 561-564
- First Published: 1. März 1996
Die gezielte Synthese von Festkörperstrukturen ist zumindest bei mesoporösen Verbindungen ein Stück nähergerückt. Paßt man die Kopfgruppen der als Template verwendeten Tenside der jeweiligen anorganischen Komponente an und nutzt man die Koordinationschemie von Metallalkoxiden als Oxidvorläuferverbindungen, so können nicht nur unterschiedliche Strukturen gebildet werden, es wird auch eine Palette von mesoporösen Metalloxiden (Al-, Ti-, Nb- und Zr-Oxiden) zugänglich, die bis vor kurzem noch undenkbar schien.
Die „magische”︁ Diarylhydroxymethylgruppe
- Pages: 565-568
- First Published: 1. März 1996
Zur Steigerung der Stereoselektivität vieler neuerer Methoden der asymmetrischen Synthese kann die Diarylhydroxymethylgruppe – meist in deprotonierter Form als Ligand in Metallkomplexen – wesentlich beitragen. Dabei werden offenbar die beiden geminalen Arylreste unter dem Einfluß eines permanenten stereogenen Zentrums X* im Übergangszustand der Reaktion konformativ fixiert (siehe z.B. die schematische Darstellung eines entsprechenden Metallkatalysators rechts).
Zuschriften
„Einfangen”︁ und Abbilden molekularer Dynamik durch Kombination von Rasterkraftmikroskopie und topologischen Einschränkungen†
- Pages: 569-570
- First Published: 1. März 1996
Ablösung und Bewegung eines einzelnen DNA-Moleküls, das an einem Substrat adsorbiert und „fossilisiert”︁ ist, können mit der im Titel erwähnten Methode sichtbar gemacht werden. Im Bild rechts ist eine entsprechende rasterkraftmikroskopische Aufnahme von an Muskovit adsorbierten DNA-Molekülen gezeigt.
„Programmierte”︁ Selbstorganisation von Kupfer(II)-L- und -D-Arginin-Komplexen mit aromatischen Dicarboxylaten unter Bildung von chiralen Doppelhelices†
- Pages: 570-572
- First Published: 1. März 1996
Das Dianion macht's möglich Durch Selbstorganisation entstandene Komplexe vom Typ [Cu(Arg)2](L) · nH2O (L = aromatisches Dicarboxylat, n = 5, 6) weisen im Festkörper Doppelhelix-Strukturen aus unendlichen [Cu(Arg)2]2+-L2−-Strängen auf (schematische Darstellung unten). Dabei fungieren die Dianionen als über Guanidinium-Carboxylat-Salzpaare gebundene Brückenliganden zwischen den Komplexkationen und übertragen darüber hinaus die Chiralitäts-Information der Aminosäure in den Drehsinn der Helix.
Synthese von kovalent an Oxidoberflächen gebundenen, polaren Selbstorganisationssystemen aus molekularen Pyramiden und deren NLO-Eigenschaften†
- Pages: 572-575
- First Published: 1. März 1996
Bemerkenswert gute SHG-Aktivitäten (SHG = Second Harmonic Generation) lassen sich erzielen, wenn Übermoleküle auf Calixarenbasis, die auf Silicium- oder Siliciumoxidoberflächen eine Monoschicht bilden, als Frequenzverdoppler verwendet werden. Günstig für eine gleichmäßige Dipolorientierung ist die starre, pyramidenartige Struktur des aus vier Azastilbazol-Einheiten bestehenden Chromophors (Bild rechts).
Diastereoselektive chelatkontrollierte Radikalcyclisierung eines chiralen, von Oxazolidinon abgeleiteten 2-Alkenamids und Modellierung des Übergangszustands dieser Reaktion†
- Pages: 575-578
- First Published: 1. März 1996
Die Radikalcyclisierung von 1 ergibt 2 und 3 in guten Ausbeuten, aber mit nur mäßiger Diastereoselektivität (2:3 = 45:55). Erst der Zusatz von MgBr2 · Et2O steigerte das Verhältnis auf 82:18. Anhand der Modellierung des Übergangszustands unter Verwendung eines speziell entwickelten „Radikalkraftfelds”︁ lassen sich die beobachteten Diastereoselektivitäten – die vermutlich auf attraktiven, van-der-Waals-artigen aromatischen Wechselwirkungen basieren – stereochemisch begründen.
Methyltrioxorhenium(VII)-katalysierte Epoxidierung von Alkenen mit Harnstoff-Wasserstoffperoxid†
- Pages: 578-581
- First Published: 1. März 1996
In hohen Ausbeuten und ohne säurekatalysierte Folgereaktionen gelingt die Synthese von Epoxiden bei Verwendung des Harnstoff-Wasserstoffperoxid-Adduktes (UHP) als Sauerstoffdonor bei Methyltrioxorhenium(VII)-katalysierten Oxidationen von Alkenen (siehe unten); bei chiralen, 1,3-gespannten Allylalkoholen als stereochemischer Sonde wurden hohe threo-Diastereoselektivitäten erreicht, die erstmals einen detaillierten mechanistischen Einblick in den Sauerstofftransfer ermöglichen.
Pyridinium-Ionen in Nachbarschaft zu Oxiranringen: nützliche Zwischenstufen zur stereospezifischen Synthese von β-Hydroxyketonen†‡
- Pages: 581-582
- First Published: 1. März 1996
α,β-Epoxytriflate wie das Epoxytriflatpyranosid 1 lassen sich in einer Eintopfreaktion nach Umsetzung mil Pyridin unter Öffnung des Epoxyrings zu N-Vinylpyridiniumderivaten (z.B. 2) umlagern, welche nach Reduktion mit NaBH4 und saurer Hydrolyse β-Hydroxyketone liefern. Mit dem allgemein anwendbaren Verfahren lassen sich z.B. leicht zugängliche Epoxypyranosen in hoher Ausbeute in Desoxyketozucker wie 3 überführen.
Bildung eines heterocyclischen 1,3-Cyclopentandiyl-Radikalkations durch chemisch induzierten Elektronentransfer und Pulsradiolyse†
- Pages: 582-584
- First Published: 1. März 1996
Durch eine unerwartete Deprotonierung stabilisiert sich das durch Oxidation mit (4-BrC6H4)3N⋅+SbCl6− aus dem Heterotricyclus 1 gebildete 1,3-Radikalkation 1⋅+ unter Bildung von (1 − H)⋅. Das Proton wird dabei vermutlich zunächst auf eine der beiden Carbonylgruppen des Triazolidindionrings übertragen. Die bei carbocyclischen Analoga übliche 1,2-Alkylwanderung wird bei 1⋅+ also nicht festgestellt.
Ein „molekulares Schaufelrad”︁: [3.3.3.3.3.3](1, 2, 3, 4, 5, 6)Cyclophan†
- Pages: 585-586
- First Published: 1. März 1996
Sechs Trimethylenbrücken verklammern die Benzolringe der „Schaufelrad”︁-Verbindung 1, die ausgehend von [35](l,2,3,4,5)Cyclophan synthetisiert wurde. Als Schlüsselschritt für die Einführung der letzten Trimethylenbrücke diente eine intramolekulare Aldolkondensation. Die NMR-spektroskopischen Daten sprechen für eine hochsymmetrische und dynamische Struktur von 1.
Phosphaalkin-Hydrometallierung: Synthese von [RuCl(P=ChtBu)(Co)(PPh3)2]†
- Pages: 587-589
- First Published: 1. März 1996
Sibyllimycin, 5, 6, 7, 8-Tetrahydro-3-methyl-8-oxo-4-azaindolizidin, ein neuartiger Metabolit aus Thermoactinomyces sp.†
- Pages: 589-591
- First Published: 1. März 1996
Der erste Naturstoff dieses Strukturtyps ist das Azaindolizidin 1, das von einem Isolat thermophiler Actinomyceten aus einer 60 °C heißen Quelle Afrikas bei der Fermentation produziert wird. Seine Struktur wurde aus NMR-Daten abgeleitet und durch Synthese aus Methylimidazol und 4-Brom-buttersäurenitril bewiesen.
Neue Cobaltkatalysatoren für Hydroformylierungen im Zweiphasensystem†
- Pages: 591-593
- First Published: 1. März 1996
Nicht Wasser, sondern Polyethylenglykol ist das Lösungsmittel für den Cobaltkomplex 1 (R = CH2CH2(OCH2CH2)nOH, n = 9), einen effektiven Katalysator für die Hydroformylierung von 1-Hexen. 1 löst sich nicht in unpolaren Solventien, so daß die Reaktion, die mil hoher Chemoselektivität verlauft, im Zweiphasensystem Polyethylenglykol/Hexen durchgeführt werden kann.
Synthese und Struktur eines Digallans mit Tris(trimethylsilyl)silyl- und Chlorsubstituenten†
- Pages: 593-595
- First Published: 1. März 1996
Na14Ba14CaN6 – ein nanodisperses System von Salz in Metall†
- Pages: 595-597
- First Published: 1. März 1996
Ein poröses Zirconiumoxophosphat sehr hoher Oberfläche durch eine tensidunterstützte Synthese†
- Pages: 597-600
- First Published: 1. März 1996
Analog zur Synthese von MCM–41 kann aus Zirconiumsulfat, das in Lösung mit Alkyltrimethylammoniumverbindungen versetzt wird, ein mesostrukturiertes Produkt (schematisch im Bild rechts) hergestellt werden. Nach Stabilisierung mit Phosphorsäure ist dieses Material calcinierbar, ohne daß die Struktur kollabiert. Das resultierende Zirconiumoxophosphat hat eine spezifische Oberfläche von bis zu 400 m2 g−1.
Bis(lithiomethyl)sulfid, ein unerwartet stabiler 1, 3-dilithiierter Synthesebaustein†
- Pages: 600-601
- First Published: 1. März 1996
Obwohl sehr nützlich, sind aufgrund fehlender Synthesemethoden nur wenige 1,3-dilithiierte Organoelementverbindungen bekannt. Jetzt gelang die Herstellung von Bis(lithiomethyl)sulfid 2 durch doppelten Metall-Lithium-Austausch (Transmetallierung) aus 1 und 3. Bei Raumtemperatur ist 2 ein farbloses, metastabiles Pulver.
Berichtigungen
Bücher
Stereochemistry of Organic Compounds. Von E. L. Eliel und S. H. Wilen. Wiley, Chichester, 1994. 1267 S. geb. 80.00 S/Broschur 29.95 £. – ISBN 0-471-01670-5/0-471-05446-1
- Pages: 603-604
- First Published: 1. März 1996
PCR. Grundlagen und Anwendungen der Polymerase-Kettenreaktion. Herausgegeben von H. G. Gassen, G. E. Sachse und A. Schulte. G. Fischer, Stuttgart, 1994. 123 S., Spiralbindung, 38.00 DM. - ISBN 3-437-20509-9 PCR im medizinischen und biologischen Labor. Handbuch für den Praktiker. Herausgegeben von M. Wink und H. Wehrle. GIT Verlag, Darmstadt, 1994. 295 S., Broschur 64.00 DM. - ISBN 3-928865-13-7 PCR, Von C. R. Newton und A. Graham. Spektrum, Heidelberg, 1994. 206 S., Broschur 39.80 DM. - ISBN 3-86025-236-4
- Pages: 604-605
- First Published: 1. März 1996
Biosensoren. Von E. A. H. Hall. Springer, Berlin, 1995. 417 S., Broschur 49.80 DM. - ISBN 3-540-57478-6
- Pages: 605-606
- First Published: 1. März 1996
Forschung mit Röntgenstrahlen. Bilanz eines Jahrhunderts (1895–1995). Herausgegeben von F. H. W. Heuck und E. Macherauch. Springer, Berlin, 1995. 682 S., geb. 98.00 DM. - ISBN 3-540-57718-1
- Page: 606
- First Published: 1. März 1996
Analytische Chemie. Von M. Otto. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1995. 668 S., Broschur 68.00 DM. - ISBN 3-527-28691-8
- Pages: 606-607
- First Published: 1. März 1996