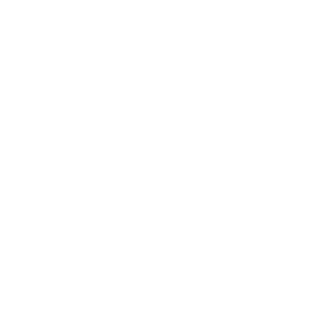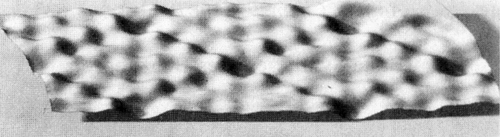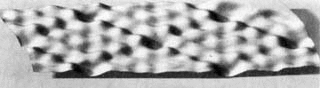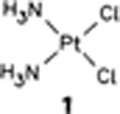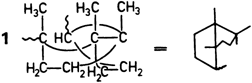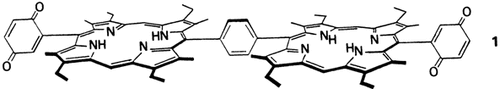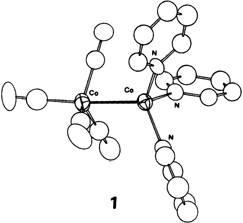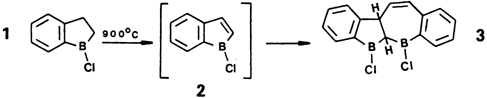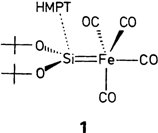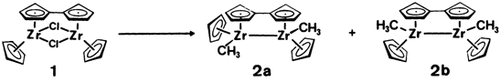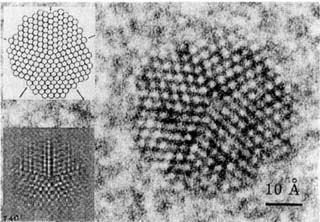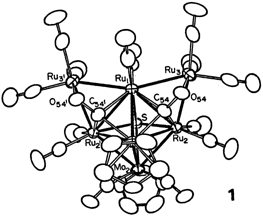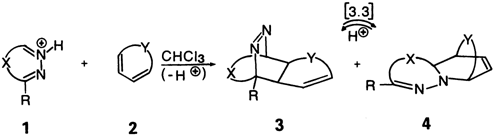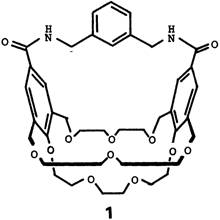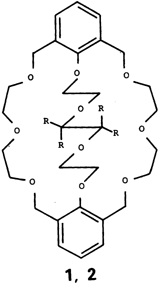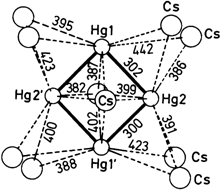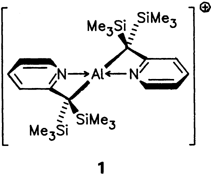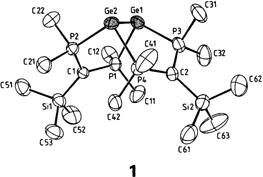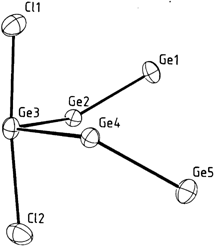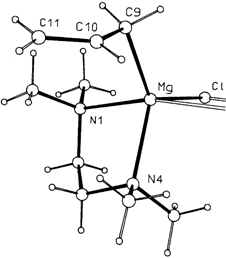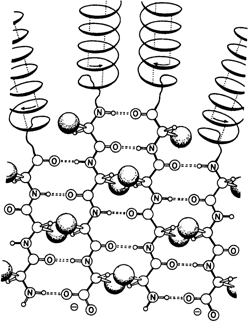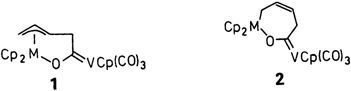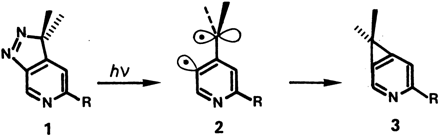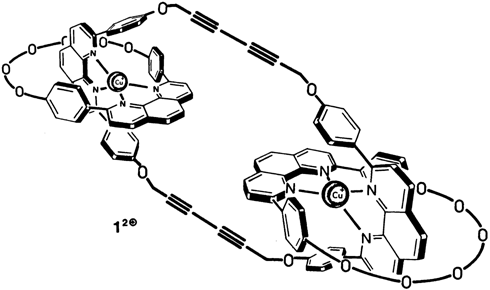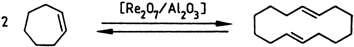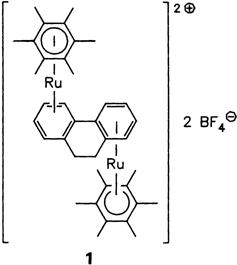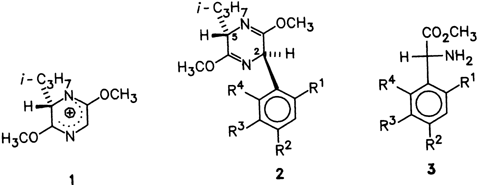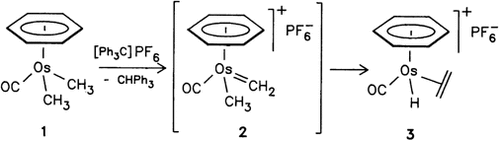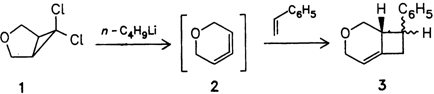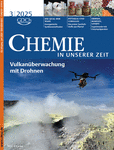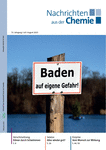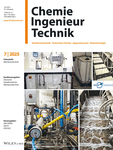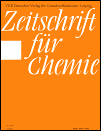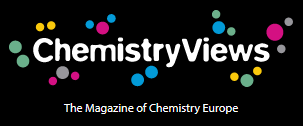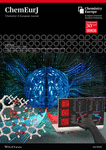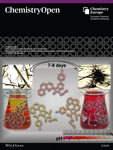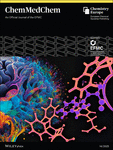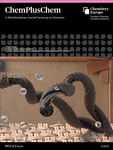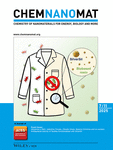Journal list menu
Export Citations
Download PDFs
Titelbild
Impressum
Graphisches Inhaltsverzeichnis
Aufsätze
Das Entstehen des Elektronenmikroskops und der Elektronenmikroskopie (Nobel-Vortrag)†
- Pages: 611-621
- First Published: Juli 1987
Die Vorträge der Empfänger des letztjährigen Nobel-Preises für Physik sind für Chemiker von großem Interesse, da sowohl Elektronen- als auch Rastertunnelmikroskopie zur Untersuchung von Oberflächen dienen. Die drei Laureaten zeichnen ein farbiges Bild der Entwicklungsgeschichte ihrer Methoden; dabei kommt der menschliche Aspekt – „einige Freuden und viele Enttäuschungen”︁ (Ruska) – nicht zu kurz. Ein erster Höhepunkt der Rastertunnelmikroskopie war die Aufklärung der 7 × 7-Rekonstruktion von Si(111), siehe Bild.
Geburt und Kindheit der Rastertunnelmikroskopie (Nobel-Vortrag)†
- Pages: 622-631
- First Published: Juli 1987
Die Vorträge der Empfänger des letztjährigen Nobel-Preises für Physik sind für Chemiker von großem Interesse, da sowohl Elektronen- als auch Rastertunnelmikroskopie zur Untersuchung von Oberflächen dienen. Die drei Laureaten zeichnen ein farbiges Bild der Entwicklungsgeschichte ihrer Methoden; dabei kommt der menschliche Aspekt – „einige Freuden und viele Enttäuschungen”︁ (Ruska) – nicht zu kurz. Ein erster Höhepunkt der Rastertunnelmikroskopie war die Aufklärung der 7 × 7-Rekonstruktion von Si(111), siehe Bild.
Neue Cisplatin-Analoga — auf dem Weg zu besseren Cancerostatica
- Pages: 632-641
- First Published: Juli 1987
Der klinische Erfolg von Cisplatin 1 bei der Chemotherapie von Tumoren ermutigte zur Suche nach Analoga mit geringerer Toxizität, besserem therapeutischem Index und höherer Wirksamkeit. Bisher erwiesen sich jedoch nur sehr wenige der „traditionellen”︁ Analoga bei klinischen Tests als vielversprechend. Die Verwendung von Trägermolekülen oder Chemotherapeutica als Liganden und/oder von Komplexen mit mehreren Pt-Atomen könnte möglicher-weise zu besseren Ergebnissen führen.
Bestimmung des Kohlenstoffgerüsts organischer Verbindungen durch Doppelquanten-Kohärenz-13C-NMR-Spektroskopie, die INADEQUATE-Pulsfolge
- Pages: 642-659
- First Published: Juli 1987
Kopplungen zwischen 13C-Kernen geben NMR-spektroskopisch direkte Hinweise auf die Verknüpfungen im Kohlenstoffgerüst, waren jedoch bisher aufgrund der geringen natürlichen Häufigkeit von 13C nur schwer zu beobachten. Durch eine spezielle Pulsfolge lassen sich diese Kopplungen jetzt besser sichtbar machen. Beispielsweise konnte durch zweidimensionale INADEQUATE-13C-NMR-Spektroskopie die Konstitution des tricyclischen Ketons 1 (CO-Gruppe weggelassen) bestimmt werden.
Biologische Sonnenenergienutzung durch photosynthetische Wasserspaltung
- Pages: 660-678
- First Published: Juli 1987
Die Spaltung von Wasser durch Sonnenlicht in Sauerstoff und metabolisch gebundenen Wasserstoff bei der Photosynthese ist von zentraler Bedeutung für höher organisierte Lebewesen. Der so bereitgestellte Sauerstoff ist ein Reagens, das einen energetisch äußerst effizienten Nährstoffumsatz bewirkt. In den letzten Jahren sind beträchtliche Fortschritte im Verständnis der Organisation der photosynthetischen Wasserspaltung erzielt worden. Das gilt besonders für den Teilschritt der Wasseroxidation zu O2.
Zuschriften
Synthese von 1,3- und 1,4-phenylenverknüpften bischinonsubstituierten Porphyrin-Dimeren†
- Pages: 679-680
- First Published: Juli 1987
Alle bisher synthetisierten Modellverbindungen für das photosynthetische Reaktionszentrum (RC) variierten den Abstand zwischen Donor- und Acceptoreinheit. Da aber, wie die Strukturbestimmung des RCs ergab, auch die Orientierung der Makrocyclen zueinander wichtig ist, wurden erstmals Modelle mit verschiedenen fixierten Winkeln zwischen den Porphyrineinheiten synthetisiert: das lineare 1 und ein giebelartiges Analogon. Lösungen beider Verbindungen in Toluol zeigen bei 418 nm-Anregung keine Fluoreszenz.
Stark polarisierende Co2+-Ionen aus [Co2(CO)8] und Pyridin in Kohlenwasserstoffen: Synthese und Struktur von [{Co3(CO)10}2{Co(py)4}] und [(CO)4CoCo(py)3][Co(CO)4]†
- Pages: 681-682
- First Published: Juli 1987
Um einen Neutralkomplex bzw. um ein homonucleares Ionenpaar handelt es sich bei den beiden Titelverbindungen. Der karminrote Co7-Komplex besteht aus einem oktaedrisch koordinierten Co2+-Zentralion, das von vier Pyridin-Liganden und zwei [Co3(CO)10]−-Clustern umgeben ist. Das Kation des smaragdgrünen Co3-Komplexes hat die Struktur 1.
Erste Synthese eines Benzoborols†
- Pages: 682-683
- First Published: Juli 1987
Die Blitzvakuumpyrolyse von 1-Chlor-1-boraindan 1 führt unter Dehydrierung zum 1-Benzoborol 2. Das hochreaktive, antiaromatische System dimerisiert regiospezifisch bereits bei tiefen Temperaturen zum Diboradibenzotetrahydroazulen 3. Abfangreaktionen mit 2-Butin, DCl und CH3OD ergeben Produkte, die ebenfalls für das intermediäre Auftreten von 2 sprechen.
Synthese und Struktur von [(OC)4FeSi(OtBu)2·HMPT], einem donorstabilisierten Silandiyl(„Silylen”︁)-Komplex†
- Pages: 683-684
- First Published: Juli 1987
Der erste stabile Silandiyl-Komplex 1 ist sowohl in Lösung als auch im Kristall monomer. 1 hat eine polare SiFe-Bindung und wird durch Adduktbildung mit Hexamethylphosphorsäuretriamid (HMPT) stabilisiert. Erwartungsgemäß besetzt der Silandiyl-Ligand eine apicale Position am trigonal-bipyramidal koordinierten Eisenatom.
FCu[AuF4], ein ungewöhnliches Kupfer(II)-fluoroaurat(III)†
- Page: 685
- First Published: Juli 1987
Ungewöhnlich in Zusammensetzung, Struktur und magnetischen Eigenschaften ist die Titelverbindung, ein ternäres Fluorid zweier Münzmetalle. Art und Ausmaß der Jahn-Teller-Verzerrung für Cu2+ sind unerwartet, die Koordinationszahl für Cu2+ ist 2 + 2 + 2 = 6; Gold dagegen weist die für Au3+ -Verbindungen übliche planar-quadratische Koordination auf. Die Verbindung ist antiferromagnetisch; die eindimensionale, magnetische Wechselwirkung findet längs der linearen Cu-F-Ketten parallel [001] statt.
Ag[MF6]2 (M = Nb, Ta), ternäre Fluoride des zweiwertigen Silbers†
- Pages: 685-686
- First Published: Juli 1987
Durch Hochdruckfluorierung (p ⋍ 3 kbar) von Ag2O/Ta2O3-Gemengen wurden leuchtendblaue Einkristalle von Ag[TaF6]2 erhalten. Die Kristallstruktur ist überraschend einfach: Jeweils drei voneinander isolierte, merklich elongierte AgF6-Oktaeder werden über TaF6-Oktaeder cis-ständig ober- und unterhalb der (100)-Ebene miteinander verknüpft. Das magnetische Verhalten – Paramagnetismus – ist verständlich, fehlen doch F−-Brücken, über die magnetische Wechselwirkungen erfolgen könnten.
⋍ 3 kbar) von Ag2O/Ta2O3-Gemengen wurden leuchtendblaue Einkristalle von Ag[TaF6]2 erhalten. Die Kristallstruktur ist überraschend einfach: Jeweils drei voneinander isolierte, merklich elongierte AgF6-Oktaeder werden über TaF6-Oktaeder cis-ständig ober- und unterhalb der (100)-Ebene miteinander verknüpft. Das magnetische Verhalten – Paramagnetismus – ist verständlich, fehlen doch F−-Brücken, über die magnetische Wechselwirkungen erfolgen könnten.
Zweikernige Fulvalen-Komplexe von drei- und vierwertigem Zirconium†
- Pages: 687-688
- First Published: Juli 1987
Morphologie und Nanostruktur von kolloidalem Gold und Silber†
- Pages: 688-691
- First Published: Juli 1987
Kolloidchemisch synthetisierte gigantische Gold- und Silbercluster sowie -mikropartikel wurden durch hochauflösende Elektronenmikroskopie untersucht. Bei den Goldproben wurden deka- und ikosaedrische, mehrfach verzwillingte sowie dreieckige, abgeflachte Partikel charakterisiert. In den Silberproben fanden sich extrem kleine Partikel (<40 Å, Bild rechts, groß), deren Struktur mit einer pentagonalen Packung der Atome erklärt wird. Die Einschübe zeigen ein Strukturmodell (links oben) und ein computersimuliertes Bild (links unten).
Ein Ru5Mo2-Heterometallcluster mit zwei vierfach-überbrückenden Carbonylliganden†
- Pages: 691-692
- First Published: Juli 1987
Ein für die Cluster-Oberflächen-Analogie wichtiger Koordinationstyp konnte im Komplex 1 gleich zweimal realisiert werden: Die beiden μ4-CO-Liganden in 1 sind so angeordnet, daß die C-Atome jeweils ein Ru2Mo-Dreieck überbrücken und die O-Atome zusätzlich an ein weiteres Ru-Atom gebunden sind; der CO-Abstand ist mit 1.25(1) Å groß.
Neue Leitstrukturen durch Diels-Alder-Reaktionen von Streptazolin mit Naphthochinonen†
- Pages: 692-693
- First Published: Juli 1987
Auffällige antibiotische und cytotoxische Eigenschaften haben die aus dem chiralen Dien Streptazolin 1 (R3 = H) und Naphthochinonen 2 in guten Ausbeuten erhaltenen Produkte 3 und Derivate davon. Die geringe endo/exo-Selektivität und Diastereoseitenselektivität der Cycloaddition sind ausnahmsweise von Vorteil; sie machen eine Vielzahl von Isomeren für das Naturstoffscreening zugänglich (R1, R2 = H, OH, OAc; R3 = H, Ac, SiMe2tBu).
Protonengesteuerte Gleichgewichtseinstellung zwischen [4+ + 2]- und [4 + 2+]-Cycloaddukten, ein charakteristisches Beispiel für die Sonderstellung der Diels-Alder-Reaktion zwischen zwei 1,3-Dienen†
- Pages: 694-695
- First Published: Juli 1987
[4 + 2]-Cycloaddukte aus zwei verschiedenen 1,3-Dienen können das Ergebnis einer Diels-Alder-Reaktion oder einer nachfolgenden Cope-Umlagerung sein. Diese Zweideutigkeit zeigt sich besonders stark in den mobilen Gleich-gewichten zwischen 1-H⊕, 2, 3 und 4-H⊕. Die Umlagerung 3 + H⊕ → 4-H⊕, eine neue Diaza-Cope-Umlagerung, verläuft rascher als die Cycloreversion zu 1-H⊕ und 2.
Azo-Cope-Umlagerungen mit nicht stabilisierten Azoverbindungen†
- Pages: 695-697
- First Published: Juli 1987
Die [4 + 2]-Cycloaddition der cyclischen Azine 1 mit den 1,3-Dienen 2 führt säurekatalysiert zu einem Gemisch der Azoverbindungen 3 und der Hydrazone 4. Durch säurekatalysierte [3.3]-Umlagerung sind 3 und 4 ineinander umwandelbar. Die Strukturabhängigkeit dieser neuen Cope-Umlagerung entspricht den Energiedifferenzen von 3 und 4, die durch Kraftfeldrechnungen ermittelt wurden.
Koordination eines makropolycyclischen Kronenetherbisamid-Rezeptors in der zweiten Koordinationssphäre von Tetraamminplatin(II)†
- Pages: 697-698
- First Published: Juli 1987
Daß zwei Rezeptormoleküle in der zweiten Koordinationssphäre an einen Metallkomplex binden, wurde beim Makropolycyclus 1 beobachtet. [Pt(NH3)4][PF6]2 bildet mit zwei Molekülen 1 diskrete Addukte, wobei H-Brücken zwischen Carbonyl-O- und Ether-O-Atomen einerseits sowie NH3 andererseits entscheidend sind. Cisplatin bildet keine Addukte mit 1.
Makrobicyclische Polyether als Liganden der zweiten Koordinationssphäre für Tetraamminplatin(II)†
- Pages: 698-701
- First Published: Juli 1987
T-Anordnung zweier Benzolringe trägt – neben H-Brücken – wesentlich zur Stabilisierung eines 2:1-Addukts des molekularen Rezeptors 2 mit [Pt(NH3)4]2⊕ im Festkörper bei (Röntgen-Strukturanalyse); in [D6]Aceton liegt lediglich ein 1:1-Addukt vor (1H-NMR). 1 bildet mit dem gleichen Kation in Lösung und im Festkörper nur 1:1-Addukte. Kleine Änderungen am Liganden können dessen Bindungseigenschaften also drastisch verändern (1, RH; 2, RMe).
Quadratische Hg4-Cluster in der Verbindung CsHg
- Pages: 701-702
- First Published: Juli 1987
Zwischen den Extrema (Cs⊕)4(Hg4)4⊖ und (Cs⊕)4(Hg4)°4e⊖ liegt der Bindungszustand in CsHg, das isolierte, quadratisch-planare Hg4-Cluster enthält. Die Temperaturabhängigkeit des spezifischen elektrischen Widerstands dieser goldbronzenen, extrem luftempfindlichen Verbindung weist sie als Metall aus, so daß die Formulierung mit freien Elektronen als treffender anzusehen ist. Das Bild rechts zeigt einen Ausschnitt aus der Kristallstruktur von CsHg (Abstände in pm).
Alkylaluminium-Kationen: Synthese und Struktur von 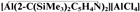 †
†
- Pages: 702-703
- First Published: Juli 1987
Eine verzerrt tetraedrische Umgebung, eine für terminale AlC-Bindungen typische Bindungslänge und auffallend geringe AlN-Abstände charakterisieren das Kation 1, das aus dem entsprechenden Chlorid bei Zugabe von AlCl3 entsteht. Die AlN-Abstände zeigen, daß zur Stabilisierung eines Dialkylaluminium-Ions Lewis-Säure-Base-Wechselwirkungen erforderlich sind.
Redox-Disproportionierung von GeII-Verbindungen: Synthese und Struktur von [(Me3Si)C(PMe2)2]2GeCl2 und [μ-{(Me3Si)C(PMe2)2}]2Ge2†
- Pages: 703-705
- First Published: Juli 1987
Eine längere GeGe-Bindung als in Polygermanen findet man im „Bisgermandiyl”︁ 1, das damit keineswegs mit Degermenen R2GeGeR2 vergleichbar ist. Die sehr stabile Ge1-Verbindung 1 mit freien Elektronenpaaren an den Ge-Zentren entsteht bei der Umsetzung von GeCl2 mit dem Phosphinomethanid [(Me3Si)(Me2P)2C]⊖ im Unterschuß.
[{μ-[(Me3Si)C(PMe2)2]}2Ge2]2GeCl2, ein Germandiyldonor-Germandiylacceptor-Komplex mit gemischtvalenter Ge5-Kette†
- Pages: 705-706
- First Published: Juli 1987
Ein GeI-GeI-GeII-GeI-GeI-Polygerman ist die Titelverbindung, die in Lösung bei Raumtemperatur fast vollständig dissoziiert ist; im Festkörper liegt eine beinahe lineare GeCl2-Einheit vor, die von zwei Liganden 1 äquatorial umgeben ist. Die Struktur der resultierenden gewinkelten Ge5-Kette mit den beiden Cl-Atomen zeigt das Bild rechts.
Kristallstruktur der η1-Allyl-Grignard-Verbindung Bis(allylmagnesiumchlorid-TMEDA)†
- Pages: 706-707
- First Published: Juli 1987
Ein gutes Modell für die Struktur von Allyl-Grignard-Verbindungen in Lösung ist die Struktur der Titelverbindung (TMEDA = Tetramethylethylendiamin) im Kristall. Dort liegen Dimere vor – eine Hälfte zeigt das Bild rechts-, die über MgClMgCl-Vierringe verknüpft sind. Der C9-Mg-Abstand beträgt 217.9(3) pm und liegt im Bereich anderer C-Mg-Abstände in Alkyl-Grignard-Verbindungen. Die C-C-Abstände in der Allylgruppe sind verschieden: C9-C10 = 144.2(4) und C10-C11 = 133.5(4) pm.
Präzipitate mit β-Faltblattstruktur durch Mischen wäßriger Lösungen von helicalem Poly(D-lysin) und Poly(L-lysin)†
- Pages: 707-708
- First Published: Juli 1987
Die spontane Umwandlung von löslichen Polypeptid-Helices in unlösliche Blattstrukturen beim Vereinen der beiden enantiomeren Helices (schematisch im Bild rechts) impliziert, daß metastabile Überstrukturen in Lösung nur dann langlebig sind, wenn sie aus chiralen Untereinheiten aufgebaut sind. Beim Vereinen von über Wochen stabilen, klaren Lösungen der Titelverbindungen fällt sofort und praktisch quantitativ das Racemat aus. Offensichtlich verhindert die aufgrund der Kurvatur der Helices extrem große Oberfläche(nenergie) die Kristallisation, während im Racemat Kristallebenen ohne Kurvatur gebildet werden können.
Carbenvanadium-Komplexe durch Reaktion von (Dien)metallocenen mit [CpV(CO)4]†
- Pages: 708-710
- First Published: Juli 1987
Synthese und Struktur eines Cyclopropapyridins†
- Pages: 710-711
- First Published: Juli 1987
Molekülstruktur eines [3]-Catenats: Faltung des verketteten Systems durch Wechselwirkung zwischen den beiden Kupferkomplex-Untereinheiten†
- Pages: 711-714
- First Published: Juli 1987
Anders als die Formel suggeriert, hat 12⊕ in Lösung und im Festkörper eine globuläre „Tertiärstruktur”︁; dies ergaben NMR-Studien und eine Röntgen-Strukturanalyse. Zur Stabilität der Tertiärstruktur des Cu2-[3]-Catenats tragen wahrscheinlich π-π-Wechselwirkungen zwischen aromatischen Untereinheiten (Stapelanordnung) bei.
Makrocyclische Diene durch metathetische Dimerisierung von Cyclohepten und Cycloocten an Re2O7/AI2O3†
- Pages: 714-715
- First Published: Juli 1987
In einer präparativ einfachen katalytischen Reaktion unter Anwendung des Verdünnungsprinzips in einer Soxhlet-ähnlichen Umlaufapparatur kann die Metathese von Cycloolefinen, die normalerweise zu ungesättigten Polymeren führt, zu Makrocyclen gelenkt werden. Cyclohepten wird z. B. glatt in 1,8-Cyclotetradecadien (Selektivität: 80%! Ausbeute: 68%) überführt.
Elektronendelokalisierung in Rutheniumkomplexen polycyclischer Arene†
- Pages: 715-717
- First Published: Juli 1987
Ein sehr schneller intramolekularer Zwei-elektronen-Transfer zwischen Ru° und RuII oder eine Spezies mit zwei RuI-Zentren ist die Erklärung für die ungewöhnlichen Eigenschaften des Kations von 1. 1H- und 13C-NMR-Spektren sind hochsymmetrisch, und die Weiterreduktion zum Ru2°-Neutral-komplex findet erst bei −1.177±0.010 V (vs. SCE) statt. Das Phenanthren-Analogon zu 1 – eine Doppelbindung mehr – verhält sich völlig anders; es enthält eindeutig ein RuII- und ein Ru°-Zentrum.
Optisch aktive α-Arylglycinester durch asymmetrische Friedel-Crafts-Alkylierung mit dem chiralen Kation des Bislactimethers von cyclo-(L-Val-Gly)†
- Pages: 717-719
- First Published: Juli 1987
Das chirale, nichtracemische Glycinkation-Äquivalent 1 ermöglichte die Synthese der bisher unbekannten (R)-α-Arylglycin-methylester 3. Die Friedel-Crafts-Addukte 2 konnten ohne Epimerisierung oder Racemisierung mit 2 Äquivalenten 0.1 N HCl hydrolysiert werden. α-Arylglycine interessieren vor allem als pharmakophore Bausteine von Medikamenten (R1-R4H, OEt, OMe).
Hydridabspaltung aus [C6H6Os(CO)(CH3)2]: Wandert eine metallgebundene Methylgruppe bevorzugt zu einem CO- oder zu einem CH2-Liganden?†
- Pages: 719-720
- First Published: Juli 1987
Zum CH2-Liganden! ist die Antwort auf die Titelfrage – eine indirekte Bestätigung der bereits von Fischer und Tropsch geäußerten Vorstellung über den Wachstumsschritt der nach ihnen benannten Synthese. Gefunden wurde die Reaktion am Os-Komplex 1, aus dem sich ein H⊖-Ion abspalten läßt. Aus der vermuteten Zwischenstufe 2 entsteht durch CH3-Wanderung und β-H-Verschiebung der Ethen-Komplex 3.
Freisetzung und Abfangreaktionen von 1-Oxa-3,4-cyclohexadien†
- Pages: 720-721
- First Published: Juli 1987
Das wohl gespannteste monocyclische Allen dürfte die Titelverbindung 2 sein. Sie wird aus 1 durch Umsetzung mit n-Butyllithium erzeugt und kann mit einer Reihe von Alkenen abgefangen werden. So entstehen mit Styrol die diastereomeren [2 + 2]-Addukte 3. Mit 1,3-Dienen reagiert 2 zu [2 + 2]- und [2 + 4]-Addukten, und in Abwesenheit reaktiverer Partner entsteht aus 2 durch n-BuLi-Addition 3-n-Butyl-2,4-pentadien-1-ol.
Neue Bücher
Der Kongreß: Vorbereitung und Durchführung wissenschaftlicher Tagungen. Von V. Neuhoff und mit einem Geleitwort von E. Pestel. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim 1986. XIII, 233 S., geb. DM 58.00. — ISBN 3-527-26560-0
- Pages: 722-723
- First Published: Juli 1987
Isolierung und Charakterisierung von Naturstoffen. Von E. Stahl und W. Schild. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1986. X, 180 S., br. DM 39.80. — ISBN 3-437-30511-5
- Page: 723
- First Published: Juli 1987
Stereoselective Synthesis. 'Von Mihály Nógrádi, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim 1987. XIV, 356 S., geb. DM 168.00. — ISBN 3-527-26467-1
- Pages: 723-724
- First Published: Juli 1987
Inorganic solid fluorides. Chemistry and physics. Herausgegeben von P. Hagenmüller. Academic Press, New York 1985. XV, 628 S., geb. $ 99.00. — ISBN 0-12-313380-X
- Pages: 724-725
- First Published: Juli 1987
Chemie der Hauptgruppenelemente – Stand und Erwartung (Leopoldina-Symposium, 9.—12. Oktober 1985 in Halle, Saale). Wiss. Vorbereitung: G. Fritz, R. Hoppe und K. Issleib. Wiss. Verlagsgesellschaft, Stuttgart 1985. VI, 397 S. (Nova Acta Leopoldina, Neue Folge, Nr. 264), kart. DM 36.00. — ISSN 0369–5034
- Page: 725
- First Published: Juli 1987
Computer aided chemical thermodynamics of gases and liquids—theory, models, programs. Von P. Benedek und F. Olti. Wiley, Chichester 1985. XXVII, 731 S., geb. £ 86.95. — ISBN 0-471-87825-1
- Pages: 725-726
- First Published: Juli 1987
Analytical methods in human toxicology, part 2. Herausgegeben von A. S. Curry. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim 1986. X, 354 S., geb. DM 170.00. — ISBN 3-527-26285-7
- Page: 726
- First Published: Juli 1987