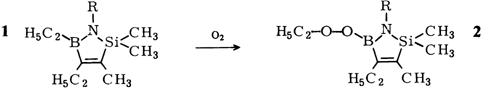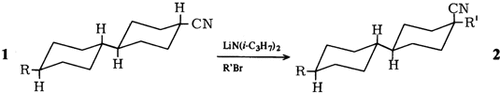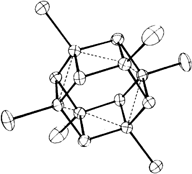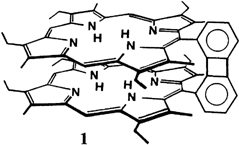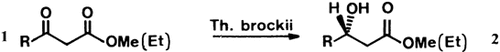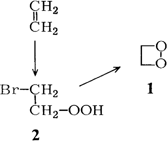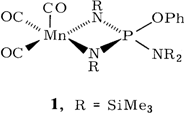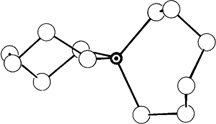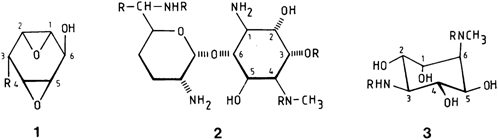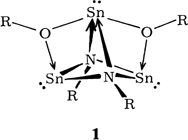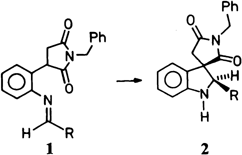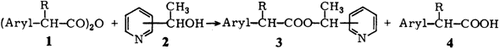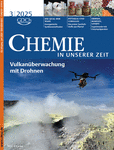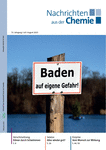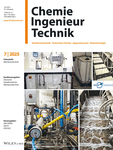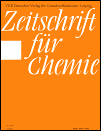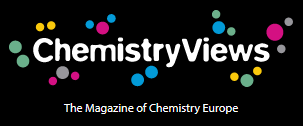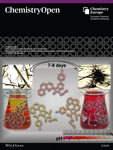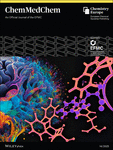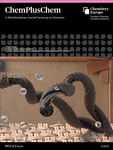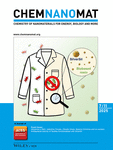Journal list menu
Export Citations
Download PDFs
Titelbild
Impressum
Graphisches Inhaltsverzeichnis
Aufsätze
Metall-Kohlenstoff- und Metall-Metall-Mehrfachbindungen als Liganden in der Übergangsmetallchemie: Die Isolobal-Beziehung
- Pages: 85-96
- First Published: Februar 1984
Als äußerst fruchtbar für die Organometallchemie hat sich das von Roald Hoffmann entwickelte isolobale Modell erwiesen („lobe”︁ = Orbitallappen). Es ermöglicht einerseits das Verständnis vieler kompliziert erscheinender Reaktionen und andererseits die planmäßige Synthese neuer Verbindungen. Ein Beispiel ist die schrittweise Addition von [Pt(cod)2] an 1, M = Pt, zum Pt3 W2-Komplex 2.
Photochemisches Lochbrennen und optische Relaxationsspektroskopie in Polymeren und Gläsern
- Pages: 96-123
- First Published: Februar 1984
Eine spezielle Art der Sättigungsspektroskopie im optischen Bereich ist das photochemische Lochbrennen. Die Löcher – genauer gesagt Einkerbungen – brennt man mit Laserlicht in Absorptionsbanden von Farbstoffmolekülen, die in einer Matrix in Spuren enthalten sind. Diese Löcher sind hochempfindliche Sensoren, die Informationen über das Gast- und das Wirtsystem geben. Potentielle Anwendungen sind z. B. die Spektroskopie von Biomolekülen und die Datenspeicherung.
Wege zu funktionalen Vesikelmembranen ohne Proteine
- Pages: 124-137
- First Published: Februar 1984
Die passende Anordnung von Reaktionspartnern ist Voraussetzung für vektoriell ablaufende Umsetzungen. In natürlichen Membranen werden die Reaktionszentren durch Komplexe mit Proteinen fixiert. In synthetischen Vesikelmembranen gelingt dies unter anderem durch Ausrichtung von Bola-Amphiphilen (zwei Kopfgruppen) wie 1. Vesikeln aus Verbindungen mit chiralen Kopfgruppen wie 2 können Enantiomere unterscheiden.
Zuschriften
Trifluorethylidinschwefeltrifluorid, F3CCSF3†
- Page: 138
- First Published: Februar 1984
Schrittweiser Zusammenbau eines Clusters mit vier verschiedenen Metallatomen†
- Pages: 138-139
- First Published: Februar 1984
Eine „cluster-zentrierte”︁ Acetylen-Vinyliden-Umlagerung†
- Pages: 139-140
- First Published: Februar 1984
Die Isomerisierung tBuCCH → tBuHCC gelang am Cluster Co2Ru(CO)9. Edukt und Produkt wurden durch Röntgen-Strukturanalyse charakterisiert. Plausibel erscheint die primäre Wanderung des acetylenischen H-Atoms zum Metall unter Bildung eines Acetylidkomplexes, der in einem zweiten Schritt zum Vinylidenkomplex tautomerisiert. – Derartige Reaktionen interessieren unter anderem als Modelle für katalytische Prozesse an Festkörperoberflächen.
Enantioselektive und enantiokonvergente Synthese von Bausteinen zur Totalsynthese cyclopentanoider Naturstoffe†
- Pages: 140-141
- First Published: Februar 1984
Stereoselektive Synthese von (E)-4-Hydroxy-2-alkensäureestern aus Aldehyden und dem d3-Baustein Lithiopropiolsäure-ethylester†
- Pages: 142-143
- First Published: Februar 1984
Für die in Naturstoffen weitverbreitete (E)-4-Hydroxy-2-alkensäureester-Teilstruktur 1 wurde eine stereoselektive Synthese ausgearbeitet. Dazu wird aus einem Aldehyd und der Li-Verbindung 2 ein 4-funktionalisierter 2-Alkinsäureester aufgebaut, den man E-stereoselektiv zu 1 reduziert. Der Anwendungsbereich kann am Aldehyd 3 demonstriert werden.
Asymmetrische Totalsynthese der Makrolide Brefeldin A und 7-epi-Brefeldin A†
- Pages: 143-145
- First Published: Februar 1984
Cyclische Carbonsäure-Organobor-Verbindungen mit BHB-Brückenbindung†
- Pages: 145-146
- First Published: Februar 1984
Thermisch stabile Ethylperoxybor-Gruppierung durch regioselektive Autoxidation†
- Pages: 146-147
- First Published: Februar 1984
Synthese neuartiger amorpher metallischer Spingläser M2SnTe4 (M Cr, Mn, Fe, Co): Solvensinduzierte Metall-Isolator-Umwandlungen†
- Pages: 147-148
- First Published: Februar 1984
Die Fällung amorpher metallischer Spingläser aus Lösungen ist eine neue, verallgemeinerungsfähige Methode. Hauptgruppenmetall-Polyanionen wie SnTe werden dabei durch Übergangsmetall-Kationen oxidiert. Das am besten untersuchte Beispiel ist Fe2SnTe4. Es bildet sich sofort beim Zusammengeben methanolischer Lösungen von wasserfreiem FeBr2 und K4SnTe4 bei – 20°C als schwarzer Niederschlag. Der spezifische elektrische Widerstand von Preßlingen ist gering. In Gegenwart starker Donorliganden werden selektiv die FeTe-Bindungen gespalten. Festes [Fe(en)2]2SnTe4 (orange) ist ein Isolator.
werden dabei durch Übergangsmetall-Kationen oxidiert. Das am besten untersuchte Beispiel ist Fe2SnTe4. Es bildet sich sofort beim Zusammengeben methanolischer Lösungen von wasserfreiem FeBr2 und K4SnTe4 bei – 20°C als schwarzer Niederschlag. Der spezifische elektrische Widerstand von Preßlingen ist gering. In Gegenwart starker Donorliganden werden selektiv die FeTe-Bindungen gespalten. Festes [Fe(en)2]2SnTe4 (orange) ist ein Isolator.
(Ph4As)2[Cl5W(μ-N4)WCl5], ein μ-Isotetrazenido(4–)-Komplex von Wolfram(VI)
- Page: 149
- First Published: Februar 1984
13C-NMR-INADEQUATE-Spektrum mit Breitbandentkopplung durch Supercyclen
- Pages: 149-150
- First Published: Februar 1984
Die Aussagekraft von 13C-13C-Kopplungskonstanten konnte bisher kaum genutzt werden, weil sie in Molekülen mit natürlichem 13C-Gehalt nur sehr schwierig zu messen waren. Anwendung der „Incredible Natural Abundance Double Quantum Transfer Experiment”︁-Methode verbesserte die Situation. Die Kombination dieser Methode mit einer effektiven Pulsfolge für die Protonenentkopplung ermöglicht jetzt Routinemessungen von J(13C,13C).
Flüssigkristalline 4-Bicyclohexylcarbonitrile mit außergewöhnlichen physikalischen Eigenschaften
- Page: 151
- First Published: Februar 1984
Aliphatische Polyether, Grundbausteine von natürlichen Huminstoffen: Nachweis durch Festkörper-13C-NMR-Spektroskopie†
- Pages: 151-153
- First Published: Februar 1984
Die Struktur der Huminstoffe wurde lange Zeit kontrovers diskutiert. Speziell ihr hoher Sauerstoffgehalt war bisher nicht zu erklären. Untersuchungen in Lösung halfen nicht weiter. Die CP-MAS-13C-NMR-Spektroskopie ermöglichte nun bei den Feststoffen eine genaue Zuordnung der Strukturelemente. Aliphatische Teilstrukturen bilden demnach das Grundgerüst der Huminstoffe; unter den sauerstoffhaltigen Gruppen dominieren aliphatische Ether. – Diese Befunde sind auch für das Verständnis der Genese fossiler Brennstoffe von Bedeutung.
Ein neuer Weg zu Eisen-Schwefel-Clustern: Synthese und Struktur von [(C2H5)4N]2Fe6S6I6†
- Pages: 153-154
- First Published: Februar 1984
Ein Biphenylenylendiporphyrin: Zwei cofacial angeordnete Porphyrine mit Biphenylenbrücke†
- Pages: 154-155
- First Published: Februar 1984
Präparative mikrobiologische Reduktion von β-Oxoestern mit Thermoanaerobium brockii
- Pages: 155-156
- First Published: Februar 1984
Ganze Zellen thermophiler Bakterien wurden erstmals bei organischen Synthesen im Laboratoriumsmaßstab eingesetzt. Die asymmetrische Reduktion einiger β-Oxoester 1 zu den Hydroxyestern 2 gelang mit guten chemischen und optischen Ausbeuten. Beispiele: RCH3 (Ethylester), C2H5 (Ethylester), ClCH2 (Methylester): ee = 80, 84 bzw. 89%.
1,2-Dioxetan: Synthese, Charakterisierung, Stabilität und Chemilumineszenz†
- Pages: 156-157
- First Published: Februar 1984
Synthese und Struktur eines fünffach koordinierten Mangan(I)-Komplexes†
- Pages: 157-158
- First Published: Februar 1984
Isolierung einer schwefelreichen binären Quecksilber-Spezies aus einer sulfidhaltigen Lösung: [Hg(S6)2]2⊖, ein Komplex mit S -Liganden
-Liganden
- Pages: 158-159
- First Published: Februar 1984
Als anorganische Spiroverbindung kann das Ion [S6HgS6]2⊖ angesehen werden. Es ist der erste homoleptische Komplex mit zweizähnigen S -Liganden. Die Bildung solcher Ionen in alkalischen sulfidhaltigen Lösungen ist von allgemeinem chemischem (mögliche Bildung ungewöhnlicher Thiometallate), aber auch von analytischem sowie mineralogischem Interesse.
-Liganden. Die Bildung solcher Ionen in alkalischen sulfidhaltigen Lösungen ist von allgemeinem chemischem (mögliche Bildung ungewöhnlicher Thiometallate), aber auch von analytischem sowie mineralogischem Interesse.
Neue Cluster von Cobalt und Nickel mit Organophosphorliganden†
- Pages: 160-162
- First Published: Februar 1984
Einen überraschend einfachen Zugang zur Herstellung von Übergangsmetallclustern bietet die Umsetzung von MCl2 (M = Co, Ni) mit PhP(SiMe3)2 und PPh3. Dabei lassen sich [Co4(μ3-PPh)4(PPh3)4] bzw. [Ni8(X)4(μ4-PPh)6(PPh3)4] (X = Cl und CO) isolieren. Der paramagnetische Komplex mit X = Cl enthält 116 Valenzelektronen und kann als gemischtvalenter Cluster von Ni0 und Ni1+ angesehen werden.
Totalsynthese eines Fortimicin-Aglycons†
- Pages: 162-163
- First Published: Februar 1984
Sn3(NtBu)2(OtBu)2, ein Molekül mit neuartigem, siebenatomigem, polycyclischem Gerüst†
- Pages: 163-164
- First Published: Februar 1984
Hochenantioselektive Synthese eines 2,3-Dihydroindols mit Hilfe von N-Methylephedrin
- Pages: 165-166
- First Published: Februar 1984
Optisch aktive α-Arylcarbonsäuren durch kinetische Enantiomerentrennung: Pyrethroidsäuren†
- Pages: 166-167
- First Published: Februar 1984
Mit den chiralen Hilfsstoffen 1-m- und 1-p-Pyridylethanol 2 gelingt es, racemische α-Arylcarbonsäuren (als Anhydride 1) in die Enantiomere zu spalten: Im Ester 3 ist das eine, in der Säure 4 das andere Enantiomer angereichert. Interessante Beispiele sind 2-Aryl-3-methylbuttersäuren (Pyrethroidsäuren).
Neue Bücher
Handbuch der photometrischen Analyse organischer Verbindungen. Von B. Kakáč und Z. J. Vejdêelek. Verlag Chemie, Weinheim. Band 1 (1974): VII, 718 S., geb.; Band 2 (1974): VI, 598 S., geb.; zusammen DM 360.00; 1. Ergänzungsband (1977): XXV, 464 S., geb. DM 138.00; 2. Ergänzungsband (1983): XXXI, 506 S., geb. DM 198.00
- Pages: 167-168
- First Published: Februar 1984
The Formtion of the German Chemical Community (1720–1795). Von K. Hufbauer. University of California Press, Berkeley 1982. VIII, 312 S., Paperback, $ 19.45
- Pages: 168-169
- First Published: Februar 1984
Grundlagen der Organischen Stereochemie. Von B. Testa. Verlag Chemie, Weinheim 1983. 213 S., Paperback, DM 44.00
- Page: 169
- First Published: Februar 1984
Electron and Ion Microscopy and Microanalysis. Von L. E. Murr. Marcel Dekker, Basel 1982. XIV, 793 S., geb. SFr. 185.00
- Pages: 169-170
- First Published: Februar 1984



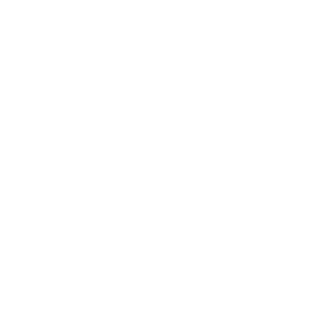

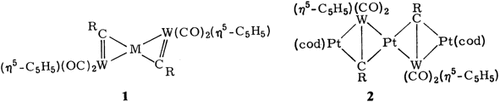
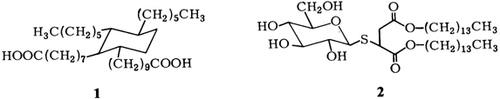
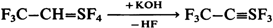
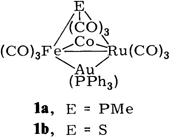
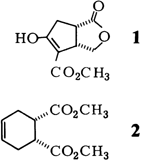
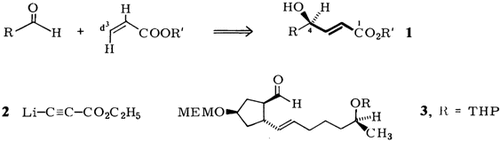
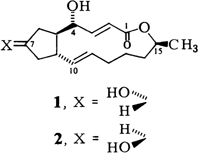
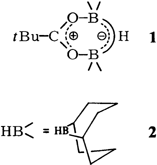
 -Gruppe wie 2 entstehen durch Autoxidation der entsprechenden
-Gruppe wie 2 entstehen durch Autoxidation der entsprechenden  -Verbindungen 1. Je nach Elementkombination und Oxidationsmittel lassen sich die Heterocyclen auch zu
-Verbindungen 1. Je nach Elementkombination und Oxidationsmittel lassen sich die Heterocyclen auch zu  -Spezies oder zu Sechsringen mit zusätzlichem Ring-O-Atom umsetzen.
-Spezies oder zu Sechsringen mit zusätzlichem Ring-O-Atom umsetzen.