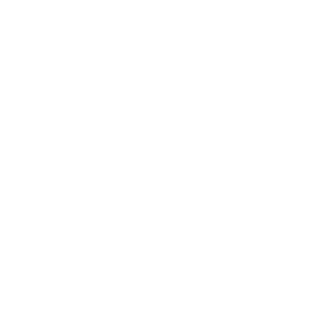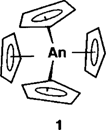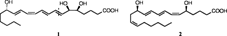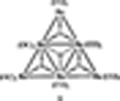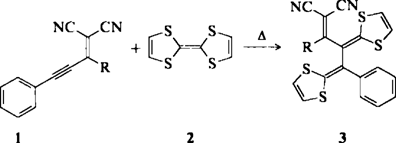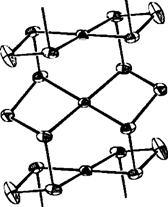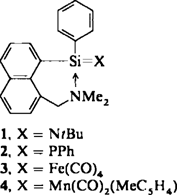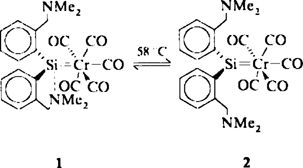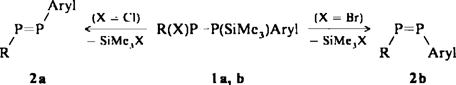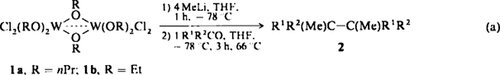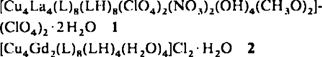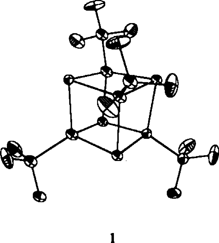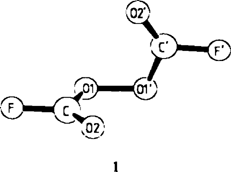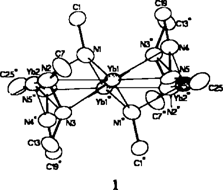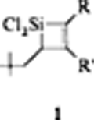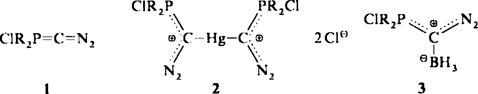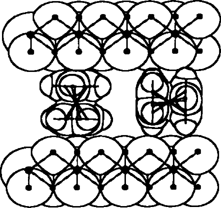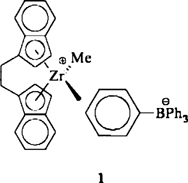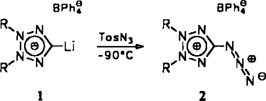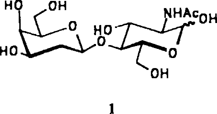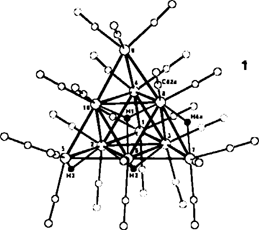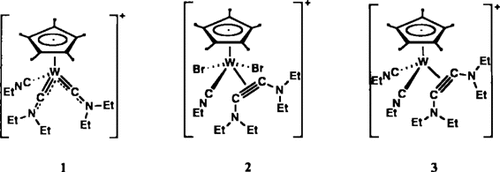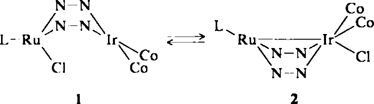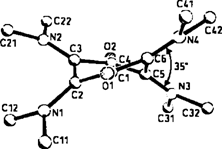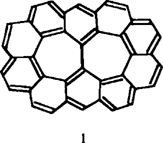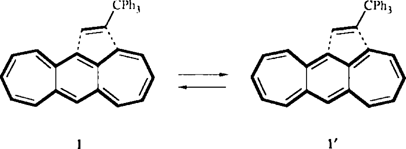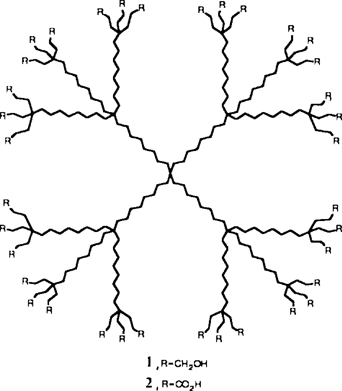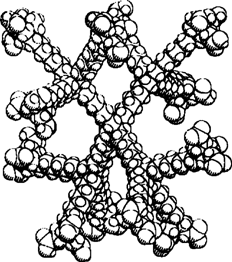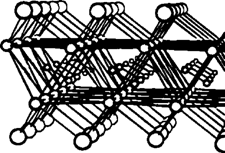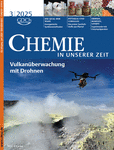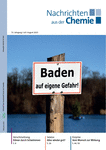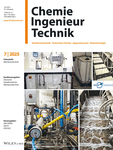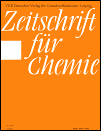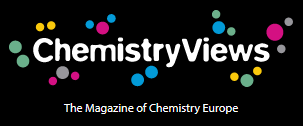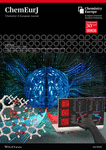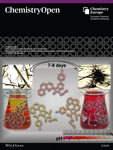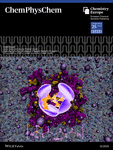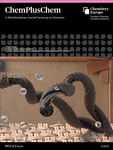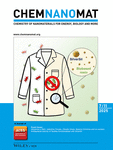Journal list menu
Export Citations
Download PDFs
Titelbild
Impressum
Graphisches Inhaltsverzeichnis
Aufsätze
Lantibiotica - ribosomal synthetisierte Polypeptidwirkstoffe mit Sulfidbrücken und α,β-Didehydroaminosäuren†
- Pages: 1067-1084
- First Published: September 1991
Trotz der Unterschiede in der Sequenz und der Sekundärstruktur verläuft die Biosynthese von Lantibiotica nach einem einheitlichen Prinzip, das aber von den Synthesemechanismen der meisten Peptidantibiotica abweicht. Die Lantibiotica entstehen aus ribosomal synthetisierten Vorläuferproteinen, bestehend aus einer Leadersequenz und einem Prolantibioticum. Die Einsatzgebiete dieser Antibiotica sind wie ihre Strukturen sehr vielfältig; Nahrungsmittelkonservierung, Aknetherapie und Enzyminhibierung zählen unter anderem dazu.
Cyclopentadienylkomplexe der Actinoide: Bindungsverhältnisse und Elektronenstruktur
- Pages: 1085-1103
- First Published: September 1991
Organoactinoidkomplexe sind recht selten und aufgrund der Handhabbarkeit oftmals auf die Metalle Th und U beschränkt. Dennoch können Parallelen und Unterschiede zwischen den zahlreichen d- und den f-Element-Komplexen herausgearbeitet werden, in dieser Übersicht vor allem in bezug auf die Bindungsverhältnisse, die mit modernen Rechenverfahren untersucht werden. Ein besonders ästhetischer Organoactinoidkomplex, der keine Analoga bei den Übergangsmetallen hat, ist [Cp4An] 1 (An = Actinoid).
Aggregate organischer Moleküle mit Kollektiveigenschaften
- Pages: 1104-1118
- First Published: September 1991
Künstliche selbstorganisierende Systeme sind das Forschungsgebiet des Autors, doch nicht losgelöst von der Frage nach ihrem praktischen Nutzen. Ob für das kontrollierte Freisetzen von Krebstherapeutica, den Fäulnisschutz bei Schiffsanstrichen, die Zerstörung von chemischen Kampfstoffen oder die Synthese poröser Polymere mit stark funktionalisierter Oberfläche, immer sind bei ihm die Grundlage Molekülaggregate wie Micellen, Vesikel oder „water pools”︁. Um solche Aggregate mit bestimmten Eigenschaften möglichst gezielt herstellen zu können, gilt sein großes Interesse auch der Frage, welche Parameter wie die Struktur und die Eigenschaften dieser Aggregate beeinflussen. Einen stimulierenden Einblick in seine Arbeiten gibt Menger in diesem „persönlichen schriftlichen Vortrag”︁.
Lipoxine und verwandte Eicosanoide: Biosynthese, biologische Eigenschaften und chemische Synthese
- Pages: 1119-1136
- First Published: September 1991
Pd0/CuI und Pd0/TlI ermöglichten die effiziente Synthese von natürlichen und nichtnatürlichen acyclischen Eicosanoiden, darunter der neuen Klasse der Lipoxine, z.B. 1, und von Leukotrien B4 2. Da der labile (Z)-Olefinteil erst im Endstadium der Synthese unter neutralen Bedingungen entsteht, wurde das (E/Z)-Diensystem dieser Eicosanoide ohne Schwierigkeiten zugänglich. Außer der chemischen Synthese werden in dieser Übersicht auch das biologische Vorkommen und die biologische Bedeutung von Eicosanoiden besprochen.
Highlights
Atome und reaktive Moleküle im Karzer
- Pages: 1137-1139
- First Published: September 1991
Die beiden spektakulärsten Wirt-Gast-Komplexe der letzten Zeit werden hier referiert: 1. Cram et al. gelang die Synthese von unsubstituiertem Cyclobutadien in einem Hemicarceranden bei Raumtemperatur. Dies vereint den Wunsch des Chemikers nach meßbaren Mengen höchstreaktiver Moleküle mit dem, das Molekül möglichst ungestört durch chemische Stabilisierung untersuchen zu können. 2. Schwarz et al. konnten massenspektrometrisch Komplexe aus C -und C
-und C -Fulleren und Helium erzeugen, in denen sich aufgrund mehrerer Befunde ein Heliumatom im Inneren des Käfigs befinden muß. Dieser Erfolg könnte auf die endohedrale Chemie der Fullerene einen enorm stimulierenden Einfluß haben.
-Fulleren und Helium erzeugen, in denen sich aufgrund mehrerer Befunde ein Heliumatom im Inneren des Käfigs befinden muß. Dieser Erfolg könnte auf die endohedrale Chemie der Fullerene einen enorm stimulierenden Einfluß haben.
Gezielte Kupplung von C1-Liganden: metallorganische Modellreaktionen
- Pages: 1139-1140
- First Published: September 1991
Mit der gezielten Synthese von thermisch beständigen, einkernigen Bis(carbin)-Komplexen und der anschließenden C-C-Kupplung der beiden Carbinliganden zu einem Alkinliganden konnten Filippou et al. den Mechanismus von C1 + C1- Kupplungsreaktionen anhand von Wolframkomplexen lückenlos belegen. Dieser Mechanismus könnte auch bei den C-C-Verknüpfungsreaktionen von Carbonyl- mit Carbonyl- und von Carbonyl- mit Isocyanidliganden zu entsprechenden Alkinliganden eine Rolle spielen (siehe auch Zuschrift auf S. 1188ff.).
Neues aus dem Reich der Metall-Metall-Mehrfachbindungen: [(η5-C5Me5)2Co2], der erste metallorganische Mehrfachbindungskomplex ohne Brückenliganden
- Pages: 1140-1141
- First Published: September 1991
Doppelbindung ja oder nein, das ist die Frage bei dem von J. J. Schneider et al. hergestellten Komplex [Cp*CoCoCp*]. Der Co-Co-Abstand und die Elektronenzahl sprechen für eine Doppelbindung, das 1H-NMR-Spektrum und die mangelnde Reaktivität gegenüber C2H4 und CO eher dagegen. Dennoch wurde mit diesem unverbrückten Komplex die Voraussetzung für die Synthese weiterer derartiger Verbindungen und damit für das Studium der Eigenschaften dieser Mehrfachbindungssysteme geschaffen (siehe auch Zuschrift auf S. 1145ff.).
Neue Bausteine zum Aufbau organischer Metalle
- Pages: 1142-1144
- First Published: September 1991
Einzelne Moleküle nach einem Baukastensystem so zu kombinieren, daß die resultierenden Kristalle besondere elektrische, optische oder magnetische Eigenschaften aufweisen, ist der Wunschtraum so manches Chemikers. Doch schon das gezielte Züchten von Kristallen mit vorherbestimmter Struktur ist zur Zeit noch unmöglich. Um hohe Leitfähigkeiten in Charge-Transfer-Komplexen zu erreichen, müssen beispielsweise die Donor- und Acceptormoleküle in getrennten Stapeln mit gleichförmigen Stapelabständen kristallisieren. Hünig et al. haben wertvolle Acceptormoleküle entwickelt, jüngst vom inversen Wurster-Typ (aromatischer Grundzustand, chinoide oxidierte Form), die dem Gebiet der organischen Metalle neue Impulse geben können (Angew. Chem. 103 (1991) 608, 610).
Zuschriften
Reaktivität von Cobaltatomen gegenüber 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadien: Synthese und Struktur von Bis(η5-pentamethylcyclopentadienyl)(μ2-η5:η5-pentamethylcyclopentadienyl)dicobalt und Bis(η5-pentamethylcyclopentadienyl)dicobalt†‡
- Pages: 1145-1147
- First Published: September 1991
Vierzig Jahre nach der Entdeckung des Ferrocens konnte nun auch ein „Dimetallsandwich”︁, der Cobaltkomplex 1, synthetisiert und strukturell charakterisiert werden. 1 entsteht neben dem homoleptischen Tripeldecker 2 sowie weiteren Produkten bei der Cokondensation von C5Me5H mit Cobalt und ist ein weiteres Beispiel für das große präparative Potential von Metallverdampfungsreaktionen (siehe auch Highlight auf S. 1140).
Das Clusteranion [Ru6H(CO)15S3]−: ein planares sechskerniges Metallgerüst mit nahezu perfekter C3v-Symmetrie
- Pages: 1147-1148
- First Published: September 1991
Ein μ3-Hydrido- und drei μ3-Sulfidoliganden überdachen den sechskernigen Metallverband des Clusteranions 1 „unterhalb”︁ bzw. „oberhalb”︁ der Ru6-Dreiecksfläche. Das hochsymmetrische, ästhetisch reizvolle 1 bildet sich aus [Ru3(CO)12] und Tetramethylthioharnstoff unter Druck und kann als Tetramethylformamidinium-Salz aus Dichlormethan gefällt werden.
Über eine Metathesereaktion von Tetrathiafulvalen (TTF)†‡
- Pages: 1148-1149
- First Published: September 1991
Nicht die erwarteten Charge-Transfer-Komplexe bilden sich aus den Acceptorsystemen 1 und Tetrathiafulvalen 2, sondern die Metatheseprodukte 3. Diese sind aufgrund ihrer leichten Zugänglichkeit und der hohen Variabilität des Restes R (R CN, PhCC, CO2Et, H) für die Herstellung neuartiger Donor/Acceptor-systeme von Interesse.
Ein polymeres Tellur-Kation durch Oxidation von Tellur mit Wolframbromiden
- Pages: 1149-1151
- First Published: September 1991
Aus annähernd planaren Te7-Einheiten, die zu einem gefalteten Band verknüpft sind (siehe Bild rechts), ist das polymere Tellur-Kation  [Te
[Te ] in Te7WOBr5 aufgebaut. Verwandte Strukturmotive waren bisher nur von Tellur-Polyanionen bekannt. Te7WOBr5 kann durch Oxidation von Tellur mit einem WOBr4/WBr5-Gemisch erhaltenen werden.
] in Te7WOBr5 aufgebaut. Verwandte Strukturmotive waren bisher nur von Tellur-Polyanionen bekannt. Te7WOBr5 kann durch Oxidation von Tellur mit einem WOBr4/WBr5-Gemisch erhaltenen werden.
Reduktion der kleinen Untereinheit der Ribonucleotid-Reductase mit Diimid: Beweise für die Bildung eines gemischtvalenten FeIIFeIII-Zentrums†
- Pages: 1151-1153
- First Published: September 1991
Das Dieisen(III)-Zentrum des Proteins R2, einer Untereinheit der Ribonucleotid-Reductase, läßt sich mit Diimid effizient zum gemischtvalenten FeIIFeIII-Zustand reduzieren, der EPR-spektroskopisch nachgewiesen werden kann. Der Vergleich mit den Spektren des gemischtvalenten Zustands von Hämerythrin legt nahe, daß beide Fe-Atome nur schwach antiferromagnetisch gekoppelt und über eine Hydroxobrücke verbunden sind.
Intramolekulare Basenstabilisierung von SiN- und SiP-Verbindungen und verwandten Silandiyl-Übergangsmetallkomplexen
- Pages: 1153-1155
- First Published: September 1991
Die hohe Reaktivität niederkoordinierter Siliciumverbindungen kann durch intramolekulare Basenstabilisierung wirksam herabgesetzt werden: So läßt sich das Silanimin 1 ohne Dimerisierung bei 175°C/2 × 10−2 Torr destillieren, das Silaphosphen 2 bei 220°C/10−2 Torr sublimieren und die Silandiylkomplexe 3 und 4 aus Aceton umkristallisieren.
Reversible intramolekulare Basenstabilisierung des niederkoordinierten Siliciumatoms im Silandiylkomplex [(o-Me2NCH2C6H4)2SiCr(CO)5]†
- Pages: 1155-1157
- First Published: September 1991
Synthese, Struktur und Isomerisierung der (E)- und (Z)-Isomere eines Diphosphens†‡
- Pages: 1158-1159
- First Published: September 1991
Der Halogensubstituent der Diphosphane 1a, b entscheidet, ob bei der Halogensilan-Eliminierung das (E)- oder das (Z)-Diphosphen 2a bzw. 2b gebildet wird. Damit lassen sich erstmals beide Isomere eines Diphosphens gezielt herstellen. Diese wandeln sich in Lösung ineinander um, wobei die Aktivierungsbarriere für die (Z/E)-Isomerisierung bei 293 K 25.4 kcal mol−1 beträgt. Aryl = 2,4,6-tBu3C6H2.
Methylierende reduktive Dimerisierung aromatischer Carbonylverbindungen, eine neue metallorganische Reaktion†
- Page: 1160
- First Published: September 1991
Eine neuartige, der McMurry-Reaktion verwandte Umsetzung, die Kupplung aromatischer Aldehyde und Ketone nach Gleichung (a), bewirken die WV-Komplexe 1 nach Methylierung mit Methyllithium. Die Ausbeuten an 2 betragen 76-90% (fünf Beispiele); die Reaktion geht nicht mit aliphatischen Aldehyden und Ketonen.
Heterometallkomplexe mit d- und f-Block-Elementen: Synthesen, Strukturen und magnetische Eigenschaften von zwei LnxCu4-Komplexen†
- Pages: 1161-1163
- First Published: September 1991
Eine La4-Ebene, die zwei Paare von Cu-Atomen trennt, charakterisiert den La4Cu4-Komplex 1, dessen Struktur rechts abgebildet ist. Der ähnlich wie 1 synthetisierte Gd2Cu4-Komplex 2 zeigt ferromagnetische Kopplung zwischen den Cu- und den Gd-Atomen. Beide Komplexe interessieren im Hinblick auf molekulare Modellverbindungen für Hochtemperatur-Supraleiter (L = 2-Hydroxypyridin-Anion).
Eine neue Gallium-Phosphor-Käfigverbindung†
- Pages: 1163-1164
- First Published: September 1991
Als Lewis-Säure und Lewis-Base zugleich fungiert die tBuGaCl2-Einheit der Ga3P4-Käfigverbindung 1. Bei dieser formalen Betrachtungsweise stabilisieren die freien Elektronenpaare zweier Phosphoratome das Lewis-acide Galliumatom dieser Einheit und zwei von ihr ausgehende Chlorobrücken die Lewis-aciden Galliumatome der tBuGa(PtBu)2-Einheiten. 1 ist aus tBuGaCl2 und K2[tBuPPtBu] zugänglich.
Tetramere Gallium- und Aluminiumchalcogenide [tBuME]4 (M Al, Ga; E S, Se, Te), eine neue Klasse von Heterocubanen†
- Pages: 1164-1166
- First Published: September 1991
Schwefel, Selen und Tellur reagieren mit tBu3Ga zu Heterocubanen [tBuGa(μ3-E)]4 (E S(1), Se, Te). Bei analogen Reaktionen mit tBu3Al lassen sich auch die dimeren Intermediate [tBu2Al(μ2-EtBu)]2 isolieren, die beim Erhitzen in die entsprechenden Cubane übergehen. Derartige Chalcogenidverbindungen sind nicht nur bindungstheoretisch, sondern auch als Ausgangsmaterialien für die Herstellung von Schichtverbindungen aus Elementen der 3. und 5. Hauptgruppe von Bedeutung.
Bis(fluorcarbonyl)peroxid, eine Verbindung mit ungewöhnlicher Molekülstruktur†
- Pages: 1166-1167
- First Published: September 1991
Anziehende Wechselwirkungen zwischen den beiden Carbonylgruppen sind eine mögliche Erklärung für den sowohl durch Elektronenbeugung in der Gasphase als auch durch ab-initio-Rechnungen bestimmten extrem kleinen Diederwinkel C-O1-O1′-C′ im Peroxid 1. Die erwartete Aufweitung des Diederwinkels aufgrund einer ebenfalls denkbaren Konjugation der π-Elektronensysteme der C(O)F-Substituenten bleibt somit aus.
Über den Ursprung der diastereofacialen Selektivität bei Additionsreaktionen an Cyclohexanone†
- Pages: 1167-1170
- First Published: September 1991
Die unsymmetrische Elektronendichteverteilung des LUMOs der Carbonyl-π-Bindung von Cyclohexanonen (im Bild ist C links, O rechts) ist der Grund für den bevorzugt axialen Angriff (a) von Nucleophilen an diese Verbindungen. Substituiert man die Ketone in 3-Position mit elektronegativen Substituenten (z.B. Halogenen), verstärkt sich diese Tendenz noch. Diese konnten die Autoren mit quantenchemischen ab-initio-Rechnungen zeigen.
Reduktion von Azobenzol durch Naphthalinytterbium: Ein vierkerniger Ytterbium(III)-Komplex mit 1,2-Diphenylhydrazido(2 -) und Phenylimido-Liganden†
- Pages: 1170-1172
- First Published: September 1991
Ein planarer Yb4N4-Achtring, der von zwei μ3-Phenylimido-Liganden überdacht ist, liegt im Ytterbium(III)-Komplex [Yb4(μ2-η2:η2-Ph2N2)4(μ3-PhN)2(thf)4] 1 vor (im Strukturbild sind nur die ipso-C-Atome der Phenylsubstituenten gezeigt). 1 ist aus Naphthalinytterbium und Azobenzol zugänglich und als Modellsubstanz für die N2-Reduktion durch Lanthanoidhalogenide von Interesse.
Einfache Synthese von Si-funktionellen Silacyclobutenen†
- Pages: 1172-1173
- First Published: September 1991
Das in situ aus Trichlorvinylsilan und tBuLi erzeugte Cl2Si C(H)CH2tBu läßt sich mit Alkinen RCCR′ glatt zu Silacyclobutenen des Typs 1 umsetzen. Die Verbindung mit R = Me3Si und R′ = Ph konnte röntgenographisch charakterisiert werden. Die Cl-Substituenten am Si-Atom lassen sich gegen H und F austauschen.
Reaktivität eines (Diazomethylen)phosphorans gegenüber Alkylierungsmitteln und Lewis-Säuren; Synthese der ersten α-Diazoalkylborate†
- Pages: 1174-1175
- First Published: September 1991
Ein elektrophiler Angriff auf das Diazo-Kohlenstoffatom wird als einleitender Schritt bei der Lewis-Säure-katalysierten Zersetzung von Diazo-Verbindungen postuliert. Der experimentelle Nachweis derartiger Primäraddukte gelang nun mit dem elektronisch stabilisierten (Diazomethylen)phosphoran 1, das beispielsweise mit Quecksilber(II)-chlorid das Salz 2 und mit Tetrahydrofuran-Boran das Borat 3 ergibt. R = NiPr2.
Struktur einer Organometall-Intercalations-verbindung: Einkristall-Röntgenstrukturanalyse und Pulver-Neutronenbeugungsuntersuchungen von [SnS2{Co(η-C5H5)2}0.31] bzw. [SnS2{Co(η-C5H5)2}0.31]†
- Pages: 1175-1177
- First Published: September 1991
Vom Halbleiter zum Supraleiter können Schichtverbindungen durch Intercalation von Metallocenen wie [Co(η5-C5H5)2] werden. Unklar war bisher allerdings die molekulare Struktur dieser interessanten Materialien. Sind die Cp-Ebenen der Organometallverbindung senkrecht oder parallel zu den Schichten des Wirtgitters (siehe Bild rechts) angeordnet? Bei der Titelverbindung parallel, das jedenfalls ergaben aufwendige Strukturuntersuchungen.
Druckunterstützte Knüpfung einer Co-C-σ-Bindung; eine Pulsradiolyse-Untersuchung unter hohem Druck†
- Pages: 1177-1179
- First Published: September 1991
Ein deutlich negatives Reaktionsvolumen (− 16.4 ± 1.6 cm3mol−1) kennzeichnet Reaktion (a), die sich aus einer nahezu druckunabhängigen Bindungsbildung in der Hinreaktion und einer sich durch Druck stark verlangsamenden Bindungsspaltung (Rückreaktion) zusammensetzt. Dies weist darauf hin, daß Druck die Bildung der Cobalt-Kohlenstoff-σ-Bindung durch Verschiebung des Gleichgewichts der Gesamtreaktion nach rechts unterstützt. Diese Ergebnisse werden anhand der Ligandensubstitution an CoII- und der Homolyse von CoIII-Komplexen diskutiert (nta = Nitrilotriacetat).
Einfluß des Lösungsmittels auf Geometrie und chemische Verschiebung; Auflösung scheinbarer experimenteller Widersprüche für H3B · NH3 mit ab-initio/IGLO-Rechnungen†
- Pages: 1179-1181
- First Published: September 1991
Wie stark kann das umgebende Medium die Strukturparameter eine Moleküls verändern? Modellrechnungen in einem polaren Solvens-Kontinuum (H2O) deuten darauf hin, daß die B-N-Bindungslänge von solvatisiertem H3B · NH3 um etwa 0.1 Å gegenüber dem Wert, der in der Gasphase mikrowellenspektroskopisch bestimmt wurde (1.672 Å), verkürzt ist, also fast auf den im Festkörper gefundenen Abstand (1.564 Å, Röntgenbeugung). Gleiche Rechnungen mit dem Lösungsmittel Hexan ergaben einen Wert von 1.62 Å.
BPh als Ligand in kationischen Zirconiumkomplexen: neuartiger Bindungsmodus und Fluktuationsprozesse
als Ligand in kationischen Zirconiumkomplexen: neuartiger Bindungsmodus und Fluktuationsprozesse
- Pages: 1181-1183
- First Published: September 1991
Bei mittlerem sterischem Anspruch der substituierten Cp-Liganden können kationische Komplexe des Typs [Cp′2ZrMe(BPh4)] isoliert werden. Ein Phenylring des BPh -Ions ist dabei über die Bindungen zwischen den meta- und para-C-Atomen an das Zr-Atom koordiniert. Ist die Zr-Umgebung wie in 1 chiral, kann man neuartige Fluktuationsprozesse des koordinierten Phenylrings beobachten.
-Ions ist dabei über die Bindungen zwischen den meta- und para-C-Atomen an das Zr-Atom koordiniert. Ist die Zr-Umgebung wie in 1 chiral, kann man neuartige Fluktuationsprozesse des koordinierten Phenylrings beobachten.
5-Lithio-2H-tetrazolium-Carbenoide: NMR-spektroskopischer Nachweis und Reaktionen mit Stickstoffelektrophilen†
- Pages: 1183-1184
- First Published: September 1991
Galactosyltransferase-katalysierte Synthese von 2′-Desoxy-N-acetyllactosamin†‡
- Pages: 1184-1186
- First Published: September 1991
Wie alle 2′-Desoxy-β-disaccharide chemisch nur schwer zugänglich ist die Titelverbindung 1, die durch ihre Analogie zu Partialsequenzen von Glycoproteinen von Bedeutung ist. In einem Reaktionscyclus gelang nun die enzymatisch katalysierte Übertragung von 2-Desoxygalactose auf N-Acetylglucosamin, wobei ausschließlich die β(1-4)-glycosidische Bindung gebildet wird.
Direkte Lokalisierung der Hydridoliganden im Dianion [H4Os10(CO)24]2− durch Neutronenbeugungsuntersuchung seines [(Ph3P)2N]+-Salzes bei 20 K†
- Pages: 1186-1188
- First Published: September 1991
Das bislang beste molekulare Modell für die Chemisorption von CO und H2 an Metalloberflächen bildet das zehnkernige Clusteranion [H4Os10(CO)24]2− 1. Alle vier Hydridoliganden liegen auf der Außenseite des Clusterkerns, wobei aufgrund sehr enger C-H-Kontakte auf eine beginnende Wechselwirkung H ⃛CO geschlossen werden kann.
Metallzentrierte Kupplung von zwei Carbin- zu einem Alkin-Liganden†
- Pages: 1188-1191
- First Published: September 1991
Als Schlüsselintermediate zahlreicher C-C-Kupplungsreaktionen von Carbin- zu Alkin-Komplexen werden Bis(carbin)-Komplexe diskutiert - ein erster experimenteller Nachweis gelang nun bei der Umsetzung des kationischen Bis(carbin)-Komplexes 1 mit Brom oder Ethylisocyanid zu den Alkin-Komplexen 2 bzw. 3 (siehe auch Highlight auf S. 1139). Damit dürften die Voraussetzungen, unter denen auch Prozesse wie die katalytische Hydrierung von CO ablaufen, als prinzipiell geklärt gelten. Gegenion = BF .
.
Synthese und Struktur einiger neuer Sodalithe: Lithiumhalogenoberyllophosphate und -arsenate†
- Pages: 1191-1192
- First Published: September 1991
Kugelförmige Hohlräume mit eingelagerten tetraedrischen Li4Br-Einheiten, die von regelmäßig angeordneten BeO4- und PO4-Tetraedern umschlossen werden, liegen in Li8Br2(Be6P6O24) vor (Strukturbild rechts). Dieses Beryllophosphat mit Sodalithstruktur ist durch Hydrothermalsynthese zugänglich und ein weiterer Beleg für die reichhaltige Strukturchemie von Molekularsieben, die auf Metallen der 2. Hauptgruppe basieren.
Reversible Isomerisierung des zweikernigen Komplexes [(η6-p-Cymol)RuCl(μ-pz)2Ir(CO)2] unter Bildung einer Ruthenium-Iridium-Bindung†
- Pages: 1192-1194
- First Published: September 1991
Durch Wanderung eines Chloroliganden isomerisiert der doppelt Pyrazolyl-verbrückte Zweikernkomplex 1 bereits unter sehr milden Bedingungen und reversibel zu 2. Derartigen Isomerisierungen, die ohne Anlagerung oder Abspaltung von Liganden ablaufen, kommt zentrale Bedeutung im Zusammenhang mit der katalytischen Aktivität zweikerniger Metallkomplexe zu. L = p-Cymol, NN symbolisiert die N-N-Einheit des Pyrazolylliganden.
Strukturänderungen bei Zweifach-Oxidation von Tetrakis(dimethylamino)-p-benzochinon: Aus einer sterisch überfüllten, elektronenreichen Sessel-Verbindung wird ein twist-Dicyanin-Salz†‡
- Pages: 1194-1197
- First Published: September 1991
Infolge der vier voluminösen (H3C)2N-Substituenten ist das Tetrakis(dimethylamino)-p-benzochinon-Molekül elektronenreich und sterisch überfüllt. Es hat eine Sesselkonformation, in der die OC-Gruppen um 12° nach oben und unten aus der zentralen C4-Ebene ausgelenkt sind. Die Oxidation mit SbCl5/CH2Cl2 führt zu einem Dikation-bis-(hexachloroantimonat), das durch Bildung zweier Cyaninketten R2NC-C(O)-CNR zu einer twist-Konformation mit Diederwinkeln von 35° verzerrt wird; gleichzeitig verlängern sich die Chinon-CC-Bindungen von 137 auf 146 pm (Strukturbild rechts).
zu einer twist-Konformation mit Diederwinkeln von 35° verzerrt wird; gleichzeitig verlängern sich die Chinon-CC-Bindungen von 137 auf 146 pm (Strukturbild rechts).
Die Zweielektronen-Reduktion von 1,1′-Diphenylethen mit Lithium oder Natrium unter CC-Verknüpfung zu verschiedenartigen 1,1,4,4-Tetraphenylbutan-1,4-diid-Salzen - einem monomeren Dilithium-Kontaktionentripel und einer Polymerkette aus „Kohlenwasserstoff-Austern mit solvatisierten Natrium-Perlen”︁†‡
- Pages: 1197-1200
- First Published: September 1991
Modellcharakter für den Verlauf der anionischen Styrol-Copolymerisation hat die Reduktion von 1,1-Diphenylethen mit Alkalimetallen zu 1,1,4,4-Tetraphenylbutan. Es gelang, Einkristalle der luftempfindlichen dianionischen Zwischenprodukte zu züchten und deren Struktur zu bestimmen. Die Strukturen der Butan-1,4-diid-Salze werden durch die Radien der Gegenionen entscheidend beeinflußt: Im monomeren Dilithium-Kontaktionentripel liegt eine antiperiplanare ⊖CH2CCH2C⊖-Kette vor. Demgegenüber besteht der Polymerstrang des Dinatriumsalzes aus Kontaktionenpaar-Anionen, welche intramolekulare Na⊕-Diphenylsandwicheinheiten mit synclinaler Butankonformation bilden und über weitere Ether-koordinierte Na⊕-Gegenionen verknüpft sind.
SiI2, ein neues dreiatomiges Molekül mit relativistischem Touch†‡
- Pages: 1200-1202
- First Published: September 1991
Die Umsetzung von reinem Sil4 mit elementarem Silicium in einem Kurzwegthermolyseofen bei 1200 K liefert Sil2, eines der wenigen bis jetzt unbekannten der 1638 dreiatomigen Moleküle aus den 13 wichtigsten Nichtmetallelementen. Die Zuordnung seines zur Charakterisierung verwendeten Photoelektronen-Spektrums, das sieben Banden enthält, gelingt mit Hilfe einer quasi-relativistischen Zweikomponenten-Pseudopotential-SCF-Berechnung mit DZP-Basissatz; die Koopmans-Defekte betragen weniger als ± 0.33 eV.
[7.7]Circulen, ein Molekül in Form einer Acht†
- Pages: 1202-1203
- First Published: September 1991
2-Triphenylmethyldicyclohept[cd,g]inden: ein neuartiger, cata-peri-kondensierter, nicht alternierender Kohlenwasserstoff†
- Pages: 1203-1205
- First Published: September 1991
Durch zwei Kekulé-Strukturen des bisher unbekannten Dicyclohepta[a,d]benzols läßt sich die Elektronenstruktur der Titelverbindung 1/1′ am besten beschreiben. Das ausgedehnte π-Elektronensystem würde dabei durch die Triphenylmethyl-substituierte „externe”︁ Doppelbindung wenig gestört. 1/1′ läßt sich in wenigen Schritten aus 4-Methylazulen synthetisieren, wobei eine elektrocyclische Reaktion unter Beteiligung von 14 π-Elektronen von zentraler Bedeutung ist.
Alkan-Kaskadenpolymere mit einer Micellen-Topologie: Micellansäure-Derivate†
- Pages: 1205-1207
- First Published: September 1991
Die Addition eines tertiären Radikals an ein elektronenarmes Alken erwies sich als entscheidender Schritt bei der Synthese der quaterdirektionalen Kaskadenpolymere 1 und 2, die keine Heteroatome im Initiatorkern, in den Verzweigungszentren oder in den Repetiereinheiten haben. Lediglich die Peripherie ist hochfunktionalisiert.
Unimolekulare Micellen†
- Pages: 1207-1209
- First Published: September 1991
Ein lipophiles Inneres und eine hydrophile Oberfläche charakterisieren Ammonium-[82 · 3]-micellanoate, bei denen es sich um Kaskadenpolymere handelt, die nur sp3-C-Atome und CH2-Gruppen im Innern enthalten und CO -Gruppen an der Oberfläche. Die Micelleneigenschaften wurden durch Absorptions- und Fluoreszenzspektroskopie sowie durch Elektronen- und optische Fluoreszenzmikroskopie untersucht. Das Bild rechts zeigt eine „36-Carbonsäure”︁ in gestreckter Konformation.
-Gruppen an der Oberfläche. Die Micelleneigenschaften wurden durch Absorptions- und Fluoreszenzspektroskopie sowie durch Elektronen- und optische Fluoreszenzmikroskopie untersucht. Das Bild rechts zeigt eine „36-Carbonsäure”︁ in gestreckter Konformation.
Supraleitung in Schichtverbindungen von Seltenerdcarbidhalogeniden
- Pages: 1210-1211
- First Published: September 1991
Dicht gepackte Doppelschichten aus Metallatomen (M = Y, La, Lu), C2-Gruppen in den von ihnen gebildeten Oktaederlücken und Schichten aus Halogenatomen (X) über denen der M-Atome, so läßt sich die rechts gezeigte Struktur der M2C2X2-Phasen beschreiben. Der Befund, daß diese zweidimensional metallischen Systeme supraleitend werden können, kann sehr zum Verständnis der Attraktion zwischen Leitungselektronen in Supraleitern beitragen.
Neue Bücher
Cyclophan-Chemie. (Reihe: Teubner Studienbücher Chemie). Von F. Vögtle. Teubner, Stuttgart 1990. 593 S., Broschur DM 48.00. - ISBN 3-519-03508-1
- Pages: 1211-1212
- First Published: September 1991
Polymer Solutions. (Reihe: Studies in Polymer Science, Vol. 9). Von H. Fujita. Elsevier, Amsterdam 1990. xviii, 370 S., geb. HFl. 285.00. - ISBN 0-444-88339-8
- Pages: 1212-1213
- First Published: September 1991
Challenges in Synthetic Organic Chemistry. Von T. Mukaiyama. Oxford University Press, Oxford 1990. 225 S., geb. £ 27.50. - ISBN 0-19-855644-6
- Page: 1213
- First Published: September 1991
Chemical Oscillations and Instabilities. Non-linear Chemical Kinetics (Reihe: International Series of Monographs on Chemistry, Vol. 21). Von P. Gray and S. K. Scott. Clarendon Press, Oxford 1990. XVI, 453 S., geb. £50.00. - ISBN 0-19-855646-2
- Pages: 1213-1214
- First Published: September 1991
Grundlagen und Praxis der Biotechnologie. Von H. Diekmann und H. Metz. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1991. 276 S., kartoniert DM 64.00. - ISBN 3-437-20462-9
- Pages: 1214-1215
- First Published: September 1991
Selective Hydrocarbon Activation. Principles and Progress. Herausgegeben von J. A. Davies, P. L. Watson, J. F. Liebman und A. Greenberg. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim/VCH Publishers, New York 1990. XIV, 568 S., geb. DM 275.00. - ISBN 3-527-26959-2
- Pages: 1215-1217
- First Published: September 1991
Biocatalysis (Reihe: Van Nostrand Reinhold Catalysis Series). Herausgegeben von D. A. Abramovicz. Van Nostrand Reinhold, New York 1990. XXV, 369 S., geb. $ 89.95. - ISBN 0-442-23848-7
- Page: 1217
- First Published: September 1991
Robert Robinson-Chemist Extraordinary. Von T. I. Williams. Oxford University Press, Oxford 1990. VIII, 201 S., geb. £ 25.00. - ISBN 0-19-858180-7
- Pages: 1217-1218
- First Published: September 1991