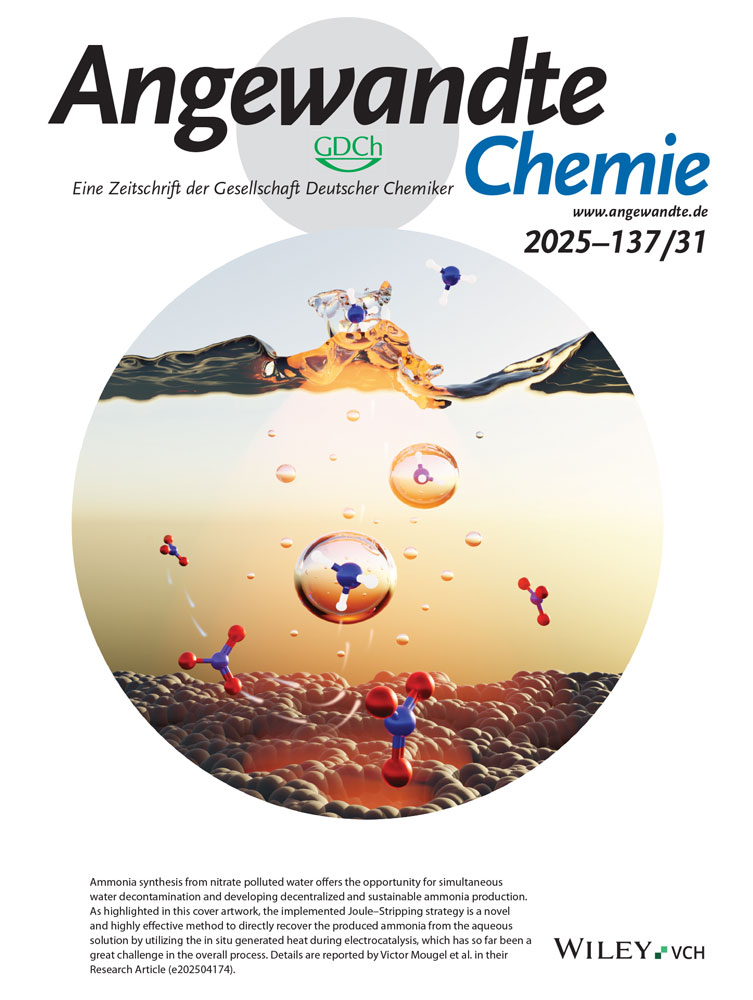Die Zweielektronen-Reduktion von 1,1′-Diphenylethen mit Lithium oder Natrium unter CC-Verknüpfung zu verschiedenartigen 1,1,4,4-Tetraphenylbutan-1,4-diid-Salzen - einem monomeren Dilithium-Kontaktionentripel und einer Polymerkette aus „Kohlenwasserstoff-Austern mit solvatisierten Natrium-Perlen”︁†‡
Corresponding Author
Prof. Dr. Hans Bock
Institut für Anorganische Chemie der Universität Niederurseler Hang, W-6000 Frankfurt am Main
Hans Bock, Institut für Anorganische Chemie der Universität Niederurseler Hang, W-6000 Frankfurt am Main
Hans Georg von Schnering, Max-Planck-Institut für Festkörperforschung Heisenbergstraße 1, W-7000 Stuttgart 80
Search for more papers by this authorKlaus Ruppert Dipl.-Chem.
Institut für Anorganische Chemie der Universität Niederurseler Hang, W-6000 Frankfurt am Main
Search for more papers by this authorDr. Zdenek Havlas
Institut für Anorganische Chemie der Universität Niederurseler Hang, W-6000 Frankfurt am Main
Institut für Organische Chemie und Biochemie der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften
Search for more papers by this authorDr. Wolfgang Bensch
Institut für Anorganische Chemie der Universität Niederurseler Hang, W-6000 Frankfurt am Main
Search for more papers by this authorDr. Wolfgang Hönle
Max-Planck-Institut für Festkörperforschung Heisenbergstraße 1, W-7000 Stuttgart 80
Search for more papers by this authorCorresponding Author
Prof. Dr. Hans Georg von Schnering
Max-Planck-Institut für Festkörperforschung Heisenbergstraße 1, W-7000 Stuttgart 80
Hans Bock, Institut für Anorganische Chemie der Universität Niederurseler Hang, W-6000 Frankfurt am Main
Hans Georg von Schnering, Max-Planck-Institut für Festkörperforschung Heisenbergstraße 1, W-7000 Stuttgart 80
Search for more papers by this authorCorresponding Author
Prof. Dr. Hans Bock
Institut für Anorganische Chemie der Universität Niederurseler Hang, W-6000 Frankfurt am Main
Hans Bock, Institut für Anorganische Chemie der Universität Niederurseler Hang, W-6000 Frankfurt am Main
Hans Georg von Schnering, Max-Planck-Institut für Festkörperforschung Heisenbergstraße 1, W-7000 Stuttgart 80
Search for more papers by this authorKlaus Ruppert Dipl.-Chem.
Institut für Anorganische Chemie der Universität Niederurseler Hang, W-6000 Frankfurt am Main
Search for more papers by this authorDr. Zdenek Havlas
Institut für Anorganische Chemie der Universität Niederurseler Hang, W-6000 Frankfurt am Main
Institut für Organische Chemie und Biochemie der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften
Search for more papers by this authorDr. Wolfgang Bensch
Institut für Anorganische Chemie der Universität Niederurseler Hang, W-6000 Frankfurt am Main
Search for more papers by this authorDr. Wolfgang Hönle
Max-Planck-Institut für Festkörperforschung Heisenbergstraße 1, W-7000 Stuttgart 80
Search for more papers by this authorCorresponding Author
Prof. Dr. Hans Georg von Schnering
Max-Planck-Institut für Festkörperforschung Heisenbergstraße 1, W-7000 Stuttgart 80
Hans Bock, Institut für Anorganische Chemie der Universität Niederurseler Hang, W-6000 Frankfurt am Main
Hans Georg von Schnering, Max-Planck-Institut für Festkörperforschung Heisenbergstraße 1, W-7000 Stuttgart 80
Search for more papers by this authorProfessor Hanskarl Müller-Buschbaum zum 60. Geburtstag gewidmet
Strukturen sterisch überfüllter und ladungsgestörter Moleküle, 9. Mitteilung. Diese Arbeit wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dem Fonds der Chemischen Industrie und dem Land Hessen gefördert. - 8. Mitteilung: H. Bock, K. Ruppert, D. Fenske, H. Goesmann, Z. Anorg. Allg. Chem. 595 (1991) 275.
Abstract
Modellcharakter für den Verlauf der anionischen Styrol-Copolymerisation hat die Reduktion von 1,1-Diphenylethen mit Alkalimetallen zu 1,1,4,4-Tetraphenylbutan. Es gelang, Einkristalle der luftempfindlichen dianionischen Zwischenprodukte zu züchten und deren Struktur zu bestimmen. Die Strukturen der Butan-1,4-diid-Salze werden durch die Radien der Gegenionen entscheidend beeinflußt: Im monomeren Dilithium-Kontaktionentripel liegt eine antiperiplanare ⊖CH2CCH2C⊖-Kette vor. Demgegenüber besteht der Polymerstrang des Dinatriumsalzes aus Kontaktionenpaar-Anionen, welche intramolekulare Na⊕-Diphenylsandwicheinheiten mit synclinaler Butankonformation bilden und über weitere Ether-koordinierte Na⊕-Gegenionen verknüpft sind.
References
- 1(a) Neuere Übersichten: C. Schade, P. von R. Schleyer, Adv. Organomet. Chem. 27 (1988) 169; (b) W. Setzer, P. von R. Schleyer, Adv. Organomet. Chem. 24 (1985) 353.
- 2(a) J. M. Lehn, Angew. Chem. 102 (1990) 1347; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 29 (1990) 1304; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 100 (1988) 91 bzw. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 27 (1988) 89; (b) H. Kurreck, B. Kirste, W. Lubitz: Electron Nuclear Double Resonance Spectroscopy of Radicals in Solution, VCH, New York 1988; (c) Y. Inone, G. W. Gokel (Hrsg.): Cation Binding by Macrocycles, Marcel Dekker, New York 1990, zit. Litt.
- 3(a) Ausgewählte eigene Beiträge: H. Bock, B. Solouki, P. Rosmus, R. Dammel, B. Hierholzer, U. Lechner-Knoblauch, H.-P. Wolf in H. Sakurai (Hrsg.): Organosilicon and Bioorganosilicon Chemistry, Horwood, Chichester 1985, S. 59 f.; H. Bock, Polyhedron 7 (1988) 2429; Angew. Chem. 101 (1989) 1679; Ange v. Chem. Int. Ed. Engl. 28 (1989) 1646; (b) H. Bock, H.-F. Herrmann, J. Am. Chem. Soc. 111 (1989) 7622; (c) H. Bock, H.-F. Herrmann, D. Fenske, H. Goesmann, Angew. Chem. 100 (1988) 1125; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 27 (1988) 1067; (d) H. Bock, K. Ruppert, D. Fenske, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 101 (1989) 1717 bzw. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 28 (1989) 1685; (e) H. Bock, K. Ruppert, Z. Havlas, D. Fenske, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 102 (1990) 1095 bzw. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 29 (1990) 1042 und (f) jeweils zit. Lit. Vgl. auch K. Ruppert, Dissertation, Universität Frankfurt 1991.
- 4(a) Zu den bemerkenswerten Ausnahmen zählen alle Methylalkalimetall-Verbindungen ( E. Weiss, S. Corbelin, J. K. Cockroff, A. N. Fitch, Angew. Chem. 102 (1990) 728; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 29 (1990) 650, zit. Lit; vgl. auch [1]), (b) die Li⊕-, Na⊕-, K⊕- und Rb⊕-Acetylide [1], c) Phenyllithium- und -natrium-Verbindungen ( T. Maezke, D. Seebach, Helv. Chim. Acta 72 (1989) 624 sowie [1] und zit. Lit.) sowie Cyclopentadienyllithium- und -natrium-Verbindungen [1] oder d) die Salze des Tetracyanethen-Anions mit Na⊕-, K⊕- und Cs⊕-Gegenionen ( H. Bock, K. Ruppert, D. Fenske, H. Goesmann, Z. Anorg. Allg. Chem. 595 (1991) 275; H. Bock, C. Näther, K. Ruppert, unveröffentlicht; vgl. auch D. A. Dixon, J. S. Miller, J. Am. Chem. Soc. 109 (1987) 3656).
- 5(a) Als Ursachen für bevorzugte Bildung von Na⊕-Sandwichstrukturen lassen sich diskutieren: eine günstige mittlere Solvationsenergie von Na⊕-Ionen auch in Diethylether (vgl. z. B. ΔHHydr. [kJ mol−1]: [Li(OH2)25]⊕ — 499.5; [Na(OH2)19]⊖ — 390, [K(OH2)11]⊕ — 306; N. Wiberg: Hollemann-Wiberg Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 91.–100. Aufl., de Gruyter, Berlin 1985, S. 954 ); (b) möglicherweise auch günstige Radienverhältnisse. Hierzu sei angeführt, daß ab-initio-SCF-Berechnungen mit 6-31G*-Bassisätzen etwa 80 proz. Ionencharakter nahelegen, für welchen die Radien der Alkalimetall-Gegenionen Liδ⊕ zu ≈ 75 pm und Naδ⊕ zu ≈ 115 pm abgeschätzt werden (siehe [1 a], Tabelle S. 174 ). Der Innenkreis-Radius eines Hexagons mit der Kantenlänge d beträgt rinnen = d√3/2; so daß für Benzol mit dCC = 139 pm etwa 120 pm für die maximale π-Ladungsdichte resultieren sollten.
- 6 Arbeitsvorschrift für das Dilithium-Salz: In eine im Vakuum ausgeheizte Schlenk-Falle werden unter Ar 15 mL wasserfreier entgaster Diethylether pipettiert und 310 mg entgastes 1,1′-Diphenylethen und 100 mg Li-Pulver zugegeben. Nach 1 d ist die Reaktionslösung rot, nach 3 d sind orangefarbene, luft- und hydrolyseempfindliche Kristalle gewachsen.
- 7 Arbeitsvorschrift für das Dinatrium-Salz: In einer im Vakuum ausgeheizten Schlenk-Falle wird durch Vakuumdestillation von 170 mg Na ein Metallspiegel erzeugt, und unter Argon werden 30 mL wasserfreier Diethylether sowie 500 mg entgastes 1,1′-Diphenylethen zupipettiert. Nach etwa 1 h färbt sich die Reaktionslösung dunkelrot, nach 24 h ist der Metallspiegel nahezu verschwunden. Langsames Abkühlen (1 Kh−1) von 293 K auf 263 K führt zum Wachstum von orangefarbenen, luft- und hydrolyseempfindlichen Kristallen.
- 8 (a) Kristallstrukturanalyse: [(H5C6)2CCH2CH2C(C6H5)2]⊖2Li⊖·4 Et2O, a = 833.4(4), b = 1109.5(6), c = 1194.9(9) pm, α = 79.45(5), β = 87.25(5), γ = 71.92(4)°, V = 1032.54 × 106 pm3 (170 K), Z = 1, ϱber. = 1.079 g cm−3, μ(MoKα) = 0.6 cm−1, triklin, Raumgruppe P1, Siemens-AED-II-Vierkreisdiffraktometer, 3492 gemessene Reflexe im Bereich von 3° < 2θ < 48°, davon 1795 unabhängige mit I > 1s̀(I), Strukturaufklärung mit direkten Methoden (SHELXTL-PLUS), N = 1795, NP = 351, R = 0.087, Rw = 0.061, w = 1/s̀2(F) + 0.000715 F2. C-, O- und Li-Atome anisotrop, gefundene Wasserstoffatome isotrop verfeinert. Ungenügendes Streuvermögen des gemessenen Einkristalls führt zu einem unvorteilhaften N/NP-Verhältnis. Das Dianion ist um ein kristallographisches Inversionszentrum angeordnet. b) Weitere Einzelheiten zur Kristallstrukturbestimmung können beim Fachinformationszentrum Karlsruhe, Gesellschaft für wissenschaftlich-technische Information mbH, W-7514 Eggenstein-Leopoldshafen 2, unter Angabe der Hinterlegungsnummer CSD-55 492, der Autoren und des Zeitschriftenzitats angefordert werden.
- 9 Kristallstrukturanalyse: [(H6C6)2CCH2CH2C(C6H5)2]⊖2Na⊖⊖2 Et2O, a = 1653.1(2), b = 1126.9(4), c = 1762.8(7) pm, β = 104.99(5)°, V = 3172.03 × 106 pm3 (200 K), Z = 8, ϱber. = 1.16 g cm−3, μ(MoKα) = 0.9 cm−1, monoklin, Raumgruppe P21, Siemens-AED-II-Vierkreisdiffraktometer, 5461 gemessene Reflexe im Bereich von 3° 2θ < 48°, davon 4918 unabhängige mit I > 1 s̀(I). Strukturaufklärung mit direkten Methoden (SHELXTL-PLUS), N = 4918, NP = 622, R = 0.097, Rw = 0.093, w = 1/s̀2(F) + 0.004844 F2. Na und C-Atome des Tetraphenylbutandiid-Gerüstes anisotrop, O- und C-Atome der Ethermoleküle isotrop verfeinert. Wasserstoffatome gruppenweise isotrop mit jeweils fixiertem Temperaturfaktor verfeinert. Die Kristallstruktur (Abb. 1 B) weist vier verschiedenartige Na⊕-Zentren aus, die alle mit Na-O-Kontaktabständen zwischen 229 und 235 pm von einem Diethylethermolekül solvatisiert sind und sich formal durch folgende vier Bindungstypen charakterisieren lassen: ein einseitiger Phenyl-Sandwich (Na1 und Na3), Koordination an vier benachbarte C-Zentren (Na2 und Na3), Allylanion-artige Wechselwirkungen (Na1 und Na4) sowie einzelne Na⊕-C-Bindungen (Na1, Na3 und Na4). Somit sind die vier verschiedenartigen (R2O)Naδ-Zentren wie folgt umgeben: Na1 von einem C6-Sandwich, einer C3-Allyleinheit und einer NaC-Einzelbindung, Na2 von einer C4- und einer C3-Kette, Na3 von einem C6-Sandwich, einer C4-Kette und einer Einzelbindung sowie Na4 von zwei Allyl-Teilsystemen und einer Einzelbindung [8 b].
- 10 Die reduktive CC-Verknüpfung von Ethenen durch Umsetzung mit Alkalimetallen ist beschrieben; z. B. für Ph3SiHCCH2: J. J. Eisch, R. J. Beuhler, J. Org. Chem. 28 (1963) 2876; (Me3Si)2 CCH2: M. Kira, T. Hino, Y. Kubota, N. Matsuyama, H. Sakurai, Tetrahedron Lett. 29 (1988) 6939. Kristallstrukturen sind unbekannt; der Reaktionsverlauf wurde durch Deuteriolyse, Reoxidation sowie durch Ringschluß mit R2SiCl2 zu Silacyclopentan-Derivaten gestützt.
- 11 Vgl. beispielsweise M. Sware (Hrsg.): Carbanions, Living Polymers and Electron Transfer Processes, Wiley-Interscience, New York 1968, S. 367f. Im Gegensatz zur thermisch initiierten technischen Styrolpolymerisation werden Styrol/Butadien-Copolymerisate mit Alkyllithium-Verbindungen dargestellt; auch Naphthalinnatrium eignet sich: Dr. Brandstetter (BASF, Ludwigshafen), persönliche Mitteilung.
- 12 Für einige lithiumorganische Verbindungen sind ebenfalls Li⊕-Sechsring-Sandwichanordnungen nachgewiesen [1 b], so beidseitig im Lithium-7 bH-indeno[1,2,3- j,k]fluorenid ( D. Bladauski, W. Broser, H. J. Hecht, D. Rewicki, H. Dietrich. Chem. Ber. 112 (1979) 1380) oder einseitig in den Bis[tetramethylethendiamin)lithium]naphthalin- und -anthracen-Salzen ( J. J. Brooks, W. Rhine, G. D. Stucky, J. Am. Chem. Soc. 94 (1972) 7346; W. E. Rhine, J. Davis, G. D. Stucky, J. Am. Chem. Soc. 97 (1975) 2079 ). Die Li⊕-C6-Kontaktabstände liegen zwischen 228 und 266 pm; in der beidseitigen Sandwichstruktur sind die Sechsringebenen nur 386 pm voneinander entfernt. Im hier vorgestellten Dinatrium-Salz (Abb. 1 B) betragen die Abstände Na⊕-C6 265 bis 305 pm und die zwischen den beiden nächstbenachbarten Phenylringen der Kontaktionen-Untereinheit etwa 470 pm.
- 13(a) H. Bock, B. Hierholzer, P. Schmalz, Angew. Chem. 99 (1987) 811; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 26 (1987) 791; (b) H. Bock, P. Dieckmann, H.-F. Herrmann, Z. Naturforsch. B46 (1991) 326; (c) H. Bock, H.-F. Herrmann, J. Nouv. Chim., im Druck. Vgl. auch die Dissertationen von P. Hänel, B. Hierholzer, H.-F. Herrmann, R. Baur (Universität Frankfurt am Main 1987, 1988, 1989 bzw. 1990 ).
- 14 Alle quantenchemischen Berechnungen sind mit dem MNDO-Programm SCAMP unter Verwendung der in [3e] beschriebenen Parameter durchgeführt worden. Für das Dinatrium-tetraphenylbutan-1,4-diid wird von der experimentell ermittelten Struktur ausgegangen und zur Rechenzeitverkürzung jede Ether-Ethylgruppe durch H ersetzt. Die Energiehyperflächenberechnungen zu anionischen Ethen-Dimerisierungen erfolgen jeweils mit allen Konfigurationen aus den sechs inneren, teils besetzten Molekülorbitalen. Als Reaktionskoordinate wird der Abstand C°C zwischen den C-Verknüpfungszentren gewählt und jeweils punktweise vollständig geometrieoptimiert.
- 15 H. Bock, C. Näther, K. Ruppert, Z. Havlas, unveröffentlicht.
Citing Literature
This is the
German version
of Angewandte Chemie.
Note for articles published since 1962:
Do not cite this version alone.
Take me to the International Edition version with citable page numbers, DOI, and citation export.
We apologize for the inconvenience.