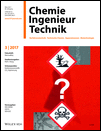Nanosafety
Liebe Leser,
was wissen wir über die Umwelt- und Sicherheitsaspekte der Nanotechnologie, kurz oft Nanosafety genannt? Die Nanotechnologie beschäftigt sich ja mit der Herstellung und Manipulation von Strukturen mit Dimensionen von weniger als 100 Nanometern. Auch wenn in der Natur und bei vielen, teilweise jahrhundertealten Produktionsverfahren Strukturen mit solchen Dimensionen auftreten, gibt es die Nanotechnologie als eigenständige Technologie erst seit etwas mehr als 20 Jahren, da wir erst jetzt gelernt haben, solche Nanostrukturen und Nanomaterialien in definierter Art und Weise herzustellen, zu vermessen und zu manipulieren. Dabei sind die teilweise erstaunlichen, oft im Vergleich zu den zugehörigen makroskopischen Materialien völlig anderen Eigenschaften solch kleiner Strukturen zu Tage getreten. Die Nanotechnologie wird deshalb allgemein als eine Zukunftstechnologie angesehen, da von ihr erwartet wird, dass mit ihr neue Produkte hergestellt, ja sogar existentielle Probleme der Menschheit gelöst werden können. Schon jetzt sieht man, dass Nanotechnologie eine Vielzahl von neuen Produkten ermöglicht und einen stetig wachsenden Markt bedient. Während für einige Jahre die Kennzeichnung von Produkten mit „Nano“ als positives Marketingargument angesehen wurde, mischten sich in den letzten Jahren auch kritische Stimmen in die Diskussion bis hin zu einer völligen Verurteilung der Nanotechnologie als Umwelt- und Gesundheitsrisiko. Ist die Nanotechnologie nun ein Segen oder ein Fluch?
Ein Großteil der Nanotechnologie beschäftigt sich mit der gezielten Herstellung von kleinsten Strukturen in makroskopischen Systemen, wie man sie z. B. von winzigen Transistoren auf modernen Halbleiterchips kennt. Diese Systeme stellen sicherlich weder ein Umwelt- noch ein Sicherheitsrisiko dar, zumindest kein größeres als die makroskopischen Systeme an sich. Etwas anders verhält es sich mit Nanomaterialien und Nanoteilchen, die einzeln oder als Konglomerat auftreten. Über den sicheren Umgang mit derartigen Materialien, über deren Einfluss auf die Umwelt und deren Toxizität gibt es seit etwa 10 Jahren eine wachsende Zahl von Untersuchungen, teilweise gefördert durch entsprechende wissenschaftliche Projekte von deutschen Bundesministerien und von der EU. Dabei wird immer deutlicher, dass viele Nanomaterialien unbedenklich sind, jedoch keine allgemeinen Aussagen möglich sondern für jede einzelne spezifische Sorte und Größe entsprechende Untersuchungen notwendig sind. Leider hat sich herausgestellt, dass viele publizierte Arbeiten hierbei nicht wirklich strengen wissenschaftlichen Maßstäben genügen, so fehlen z. B. sehr häufig genaue Charakterisierungen der benutzten Nanoteilchen. Deshalb ist hier noch viel Forschung notwendig. Deren derzeitiger Stand wird in diesem Heft in einem Schwerpunkt thematisiert.
Entstanden ist die Idee zu diesem Schwerpunkt anlässlich eines Workshops mit dem Kurztitel NanoSaTox (Nanosafety and Nanotoxicology), organisiert im Rahmen der Graduiertenschule “Hannover School for Nanatechnolgy”. der im Oktober 2015 in Hannover stattgefunden hat. Dabei sollte ein differenziertes Bild der Komplexität der derzeitigen Nanosicherheitsforschung erarbeitet werden. In Hannover existiert an der Leibniz Universität eine lange Tradition der Nanotechnologieforschung. So werden seit mehr als 20 Jahren in der von mir geleiteten Abteilung „Nanostrukturen“ die mechanischen und elektronischen Eigenschaften von kleinsten Strukturen untersucht. Seit mehr als 10 Jahren gibt es das interdisziplinäre Forschungszentrum „Laboratorium für Nano- und Quantenengineering (LNQE)“, dem bis zu 30 Arbeitsgruppen aus Chemie, Physik und den Ingenieurwissenschaften angehören. Entsprechende Forschungsarbeiten können seit 2009 in einem speziellen Forschungsbau durchgeführt werden. Seit 2008 koordiniert das LNQE auch den interdisziplinären Bachelor/Master-Studiengang Nanotechnologie, mit inzwischen mehr als 300 eingeschriebenen Studenten. Aufbauend auf diesen Studiengang wurde im Jahr 2012 ein Promotionsprogramm ins Leben gerufen, die „Hannover School for Nanotechnology (hsn)“. Während hier ursprünglich vor allem Promotionsarbeiten in Richtung von Anwendungen bei der Energietechnik (hsn-energy) gefördert wurden, werden inzwischen auch Promotionsarbeiten zu Sensoranwendungen (hsn-sensors) bearbeitet. Typischerweise bewerben sich mehr als 300 Bewerber und Bewerberinnen auf die ausgeschriebenen Promotionsarbeiten. Mit dem Workshop NanoSaTox sollten den Doktorandinnen und Doktoranden der Graduiertenschule die Sicherheitsaspekte der Nanotechnologie differenziert nahegebracht werden.
Der vorliegende Schwerpunkt zum Thema Nanosicherheitsforschung umfasst fünf Beiträge. Neben einer Aufarbeitung und Beurteilung der inzwischen umfangreichen Literatur beschäftigen sich zwei Beiträge mit den regulatorischen Aspekten der EU und dem Zugriff auf verlässliche Informationen. In einem Beitrag der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt wird die Problematik der Größenbestimmung von Nanoteilchen dargestellt, während in einem weiteren Artikel exemplarisch toxikologische Untersuchungen zu Eisenoxidnanoteilchen in medizinischer Anwendung präsentiert werden. Diese Beiträge sollten Ihnen, liebe Leser, einen guten Überblick über den derzeitigen Stand der Nanosicherheitsforschung bieten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.