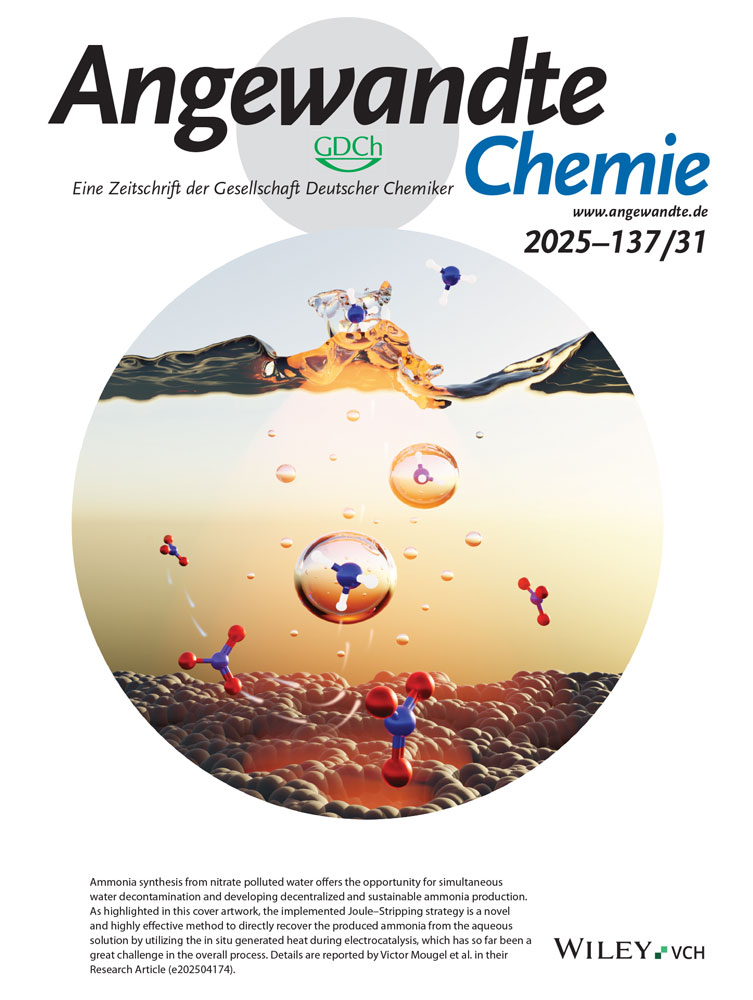[{Pt(CN)(C10H21N4)}6], ein lumineszierender, sechskerniger Platin(II)-Makrocyclus mit chelatisierenden Dicarben- und verbrückenden Cyanidliganden
Siu-Wai Lai
Department of Chemistry, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong, China, Telefax: Int.+852/2857-1586
Search for more papers by this authorKung-Kai Cheung
Department of Chemistry, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong, China, Telefax: Int.+852/2857-1586
Search for more papers by this authorMichael Chi-Wang Chan
Department of Chemistry, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong, China, Telefax: Int.+852/2857-1586
Search for more papers by this authorChi-Ming Che
Department of Chemistry, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong, China, Telefax: Int.+852/2857-1586
Search for more papers by this authorSiu-Wai Lai
Department of Chemistry, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong, China, Telefax: Int.+852/2857-1586
Search for more papers by this authorKung-Kai Cheung
Department of Chemistry, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong, China, Telefax: Int.+852/2857-1586
Search for more papers by this authorMichael Chi-Wang Chan
Department of Chemistry, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong, China, Telefax: Int.+852/2857-1586
Search for more papers by this authorChi-Ming Che
Department of Chemistry, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong, China, Telefax: Int.+852/2857-1586
Search for more papers by this authorAbstract
Ein Metall&ararr;π*(Carben)-Charge-Transfer-Übergang in Lösung bei Raumtemperatur wurde erstmals bei der Titelverbindung nachgewiesen. Dieser ungewöhnliche, sechskernige Platinamakrocyclus entsteht durch Selbstorganisation aus je sechs Dicarben-Platin(II)-Einheiten und Cyanidliganden, wobei die Platinzentren sechs Ecken eines Würfels besetzen und die Cyanidliganden die Kanten bilden (siehe schematische Darstellung rechts; Kreise = [Pt(C10H21N4)], Rechtecke = CN).
References
- 1(a) M. Fujita, K. Ogura, Bull. Chem. Soc. Jpn. 1996, 69, 1471–1482; (b) M. Fujita, D. Oguro, M. Miyazawa, H. Oka, K. Yamaguchi, K. Ogura, Nature 1995, 378, 469–471.
- 2 J. P. Sauvage, Acc. Chem. Res. 1990, 23, 319–327.
- 3 J. M. Lehn, A. Rigault, Angew. Chem. 1988, 100, 1121–1122; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1988, 27, 1095–1097.
- 4
D. Philp,
J. F. Stoddart,
Angew. Chem.
1996,
108,
1242–1286;
10.1002/ange.19961081105 Google ScholarAngew Chem. Int. Ed. Engl. 1996, 35, 1154–1196.
- 5(a)
P. J. Stang,
D. H. Cao,
S. Saito,
A. M. Arif,
J. Am. Chem. Soc.
1995,
117
6273–7283;
(b)
P. J. Stang,
B. Olenyuk,
Angew. Chem.
1996,
108,
798–802;
10.1002/ange.19961080708 Google ScholarAngew. Chem. Int. Ed. Engl. 1996, 35, 732–736; (c) P. J. Stang, N. E. Persky, J. Manna, J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 4777–4778.
- 6 R. V. Slone, J. T. Hupp, C. L. Stern, T. E. Albrecht-schmitt, Inorg. Chem. 1996, 35, 4096–4097.
- 7 B. C. Tzeng, W. C. Lo, C. M. Che, S. M. Peng, Chem. Commun. 1996, 181–182.
- 8
L. Tschgajeff,
M. Skanawy-grigorjewa,
A. Posnjak,
Z. Anorg. Allg. Chem.
1925,
148,
37–42.
10.1002/zaac.19251480105 Google Scholar
- 9 G. Rouschias, B. L. Shaw, J. Chem. Soc. A., 1971, 2097–2104; (b) W. M. Butler, J. H. Enemark, J. Parks, A. L. Balch, Inorg. Chem. 1973, 12, 451–457.
- 10
Kristallrukuranalyse von: 2: C66H126N30Pt6 10C2H6. 10C2H3N; Mr = 2920.94, triklin, Raumgruppe (p1 (Nr. 2), a = 14.713(6), b = 18.186(6), c = 14.042(8) Å, α = 101.03(3), β = 105.84(4), γ = 113.83(3)°, V3106(2) Å 3, Z = 1, ρber = 1.561 gcm−3, μ67.55 cm−1 (F(000) = 1420, T = 301 K. Ein gelber Kristall mit den Abmessungen 0.25 × 0.20 × 0.35 mm3 wurde zur Datensammlung bei 301 K auf einem RigakuAFC7R-Diffraktometer (graphitmonochromatisierte MoKα-Strahlung, λ = 0.71073 Å) verwendet. ω-2θ-Scan-Modus, ω-Scan-Winkel (0.73+0.35 tan θ)°, Scangeschwindigkeit 16.0° min−1 (bis zu sechs Scans für Reflexe mit I<15σ(I). Meßbereich: 2θmax. = 46°; h von 0 bis 16, k von-19 bis 19, I von-15 bis 15; drei Standardreflexe wurden nach jeweils 300 Reflexen gemessen und wiesen einen Intensitätsverlust von 3.74% auf. Die Intensitätsdaten wurden hinsichtlich des Intensitätsabfalls, der Lorentz- und Polarisationseffekte korrigiert, und eine empirische Absorptionskorrektur wurde durchgeführt, die auf dem ψ- Scan von sechs starken Reflexen (min./max. Transmissionsfaktoren 0.671/1.000) beruhte. 9041 Reflexe wurden gemessen, davon waren 8644 unabhängig mit Rint 0.026. 5738 Reflexe mit I>3σG(I) wurden detektiert und bei der Strukturanalyse verwendet. Die struktur wurde mit Patterson-Methoden gelöst, mit Fourier Methoden erweitert (PATTY) sowie nach der Volle-Matrix-Kleinste Quadrate-Methode mit dem Programmpaket TeXsan auf einem Silicon-Graphics-Indy-Computer verfeinert. Die asymmetrische Einheit bestecht aus einer Hälfte des Komplexes und fünf Molekülen Acetonitril. Die sechs CN-Gruppen, die den 18gliedrigen Ring bilden, waren fehlgeordnet, wobei alle Atomlagen halb von-und halb von C-Atomen besetzt waren. Die Atomlagen halb von- Und halb von C-Atomen besetzt waren. Die Atome N(1) bis N(6) sowie C(1) bis C(6) wurden mit der Besetzungszahl 0.5 isotrop verfeinert, wobei die Lagen und die thermischen Parameter der C-Atome and die der entsprechenden-Atome geknüpft wurden (d. h. N/C(1) bis C(6). Die C- und-Atome der fünf Solvensmoleküle wiesen große Temperaturfaktoren auf und wurden auch isotrop verfeinert. Die anderen Nichtwasserstoffatome des Komplexes wurden anisotrop verfeinert. Die an die-Atome der Ligandmoleküle gebundenen H-Atome konnten in Differenz-Fourier-Synthesen nicht lokakisiert werden. Die anderen 69 H-Atome (auch die der Solvensmoleküle) wurden auf berechneten lagen mit thermischen Parameteren eingeführt, die 1.3 mal so groß waren wie die der C-Atome, an die sie gebunden waren. Diese H-Atome wurden nicht verfeinert. Bei 490 Parametern konovergierte die Verfeinerun gengen F mit dem Wichungsschemai W = 4F
 /σ2(F
/σ2(F ) = [s2 (I) + (0.035 F
) = [s2 (I) + (0.035 F 2]) für 5738 Reflexen Mit (I>3σ (I) zu R = 0.038 und wR = 0.056 und GOF = 1.67. (Δ/s) max. = 0.04. für Atome des Komplexes. Die Abschließende Fourier-Karte wies keine aussageekräftigen Charakteristika auf, und die max./min. Restelektronendichte betrug 2.4/−0.71 e Å−3. Die kristallographischen Daten (ohne Strukturfaktoren) der in dieser Veröffentlichung beschriebenen Struktur wurden als „supplementary publication no. CCDC-100633”︁ beim Cambridge Crystallographic Data Centre hinterlegt. Kopien der Daten können kostenlos bei folgender Adresse in Großritannien angefordert werden: CCDC, 12 Union Road, Cambridge CB21EZ (Telefax: Int. +1223/336033; E-mail; [email protected].).
2]) für 5738 Reflexen Mit (I>3σ (I) zu R = 0.038 und wR = 0.056 und GOF = 1.67. (Δ/s) max. = 0.04. für Atome des Komplexes. Die Abschließende Fourier-Karte wies keine aussageekräftigen Charakteristika auf, und die max./min. Restelektronendichte betrug 2.4/−0.71 e Å−3. Die kristallographischen Daten (ohne Strukturfaktoren) der in dieser Veröffentlichung beschriebenen Struktur wurden als „supplementary publication no. CCDC-100633”︁ beim Cambridge Crystallographic Data Centre hinterlegt. Kopien der Daten können kostenlos bei folgender Adresse in Großritannien angefordert werden: CCDC, 12 Union Road, Cambridge CB21EZ (Telefax: Int. +1223/336033; E-mail; [email protected].).
- 11 J. Lorberth, W. Massa, M. E. Essawi, L. Labib, Angew. Chem. 1988, 100, 1194–1195; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1988, 27, 1160–1161; (b) B. Longato, G. Bandoli, G. Trovó, E. Marasciulo, G. Valle, Inorg. Chem. 1995, 34, 1745–1750.
- 12 J. T. Chen, W. H. Tzeng, F. Y. Tsai, M. C. Cheng, Y. Wang, Organometallics 1991, 10, 3954–3955.
- 13 R. A. Michelin, R. Bertani, M. Mozzon, L. Zanotto, F. Benetollo, G. Bombieri, Organometallics 1990, 9, 1449–1459.
- 14 R. F. Stepaniak, N. C. Payne, Inorg. Chem. 1974, 13, 797–801.
- 15 L. Malatesta, F. Bonati, Isocyanide Complexes of Metals Wiley, London, 1969, S. 169.
- 16 S. W. Lai, C. M. Che, univeröffentlichte Ergebnisse.
- 17 J. W. Schindler, R. C. Fukuda, A. W. Adamson, J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 3596–3600;
- 18(a) H. C. Foley, L. M. Strubinger, T. S. Targos, G. L. Geoffroy, J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 3064–3073; (b) A. D. Rooney, J. J. McGarvey, K. C. Gordon, R.-A. McNicholl, U. Schubert, W. Hepp, Organometallics 1993, 12, 1277–1282. (c) L. S. Hegedus, Tetrahedron 1997, 53, 4105–4128.
Citing Literature
This is the
German version
of Angewandte Chemie.
Note for articles published since 1962:
Do not cite this version alone.
Take me to the International Edition version with citable page numbers, DOI, and citation export.
We apologize for the inconvenience.