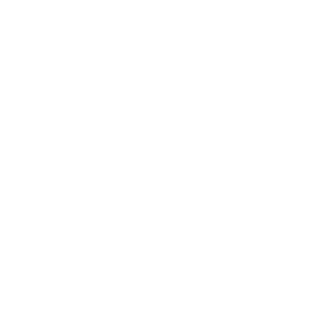Schnellnavigation
Ethische Leitlinien für Publikationen
Einleitung
Die Veröffentlichung wissenschaftlicher Forschungsarbeiten in begutachteten Fachzeitschriften (Peer-Review-Verfahren) ist für den wissenschaftlichen Fortschritt unverzichtbar. Sie ermöglicht die Verbreitung von Forschungsergebnissen (die eine Zeit- und Geldinvestition darstellen) in der Forschungsgemeinde, sodass andere Forschende darauf aufbauen können. Wissenschaftliche Veröffentlichungen dienen auch als Nachweis von Leistung und Rang und können die Karriereentwicklung von Forschenden, die untereinander um Anerkennung und Fördermittel konkurrieren, erheblich beeinflussen. Wissenschaftliche Integrität ist deshalb von höchster Bedeutung: Fragwürdige Forschungspraktiken schaden sowohl den Forscher:innen als auch der Gesellschaft. Im Kontext akademischer Publikationen sind Redakteur:innen, Autor:innen und Gutachter:innen für die Einhaltung hoher ethischer Standards verantwortlich und verpflichtet, die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis zu befolgen. In diesen ethischen Leitlinien für die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen werden diese Verantwortlichkeiten beschrieben.
1. Verantwortlichkeiten der Autor:innen
Autor:innen sind die Personen, die den Inhalt eines Manuskripts erstellt haben und deren Namen im Manuskript als (Mit-)Autor:innen genannt sind.
- Die genauen Kriterien für Autorenschaft können sich je nach Fachgebiet unterscheiden, Mindestvoraussetzung ist jedoch, dass die betreffende Person einen wesentlichen intellektuellen Beitrag zu der Arbeit geleistet haben muss, wobei auch Beiträge zu Konzeption und Design, Analyse und/oder Erstellung des Manuskripts eingeschlossen sein sollten.
- Alle Autor:innen sind für den Inhalt des Manuskripts verantwortlich.
- Eine administrative Funktion (z. B. Bereitstellung von Laborraum oder Fördermitteln) begründet keine Autorenschaft; Ehren- oder Gastautorenschaften sind nicht zulässig.
- Beitragende, die die Kriterien der Autorenschaft nicht erfüllen, können in der Danksagung („Acknowledgments“) aufgeführt werden. Autor:innen sollten sich vergewissern, dass die betreffenden Personen mit der Nennung einverstanden sind.
Autor:innen haben die folgenden Verantwortlichkeiten:
1.1. Daten auf ehrliche und objektive Art und Weise zu erheben und zu bewerten. Daten- und Bildmanipulation sowie andere Falschdarstellungen der Ergebnisse sind inakzeptabel. Es sollten nur originale unbearbeitete Bilder verwendet werden. Wenn Anpassungen aus wissenschaftlichen Gründen notwendig sind, sind sie in einer Legende zu erläutern.
1.2. Ihre Forschung klar und präzise zu präsentieren und deren wissenschaftliche Bedeutung objektiv zu diskutieren.
1.3. Ausreichende Daten und methodische Details bereitzustellen, damit die Arbeit kritisch geprüft, reproduziert und von anderen Forscher:innen weitergeführt werden kann.
1.4. Primäre Datensätze nach bewährten Praktiken für den wissenschaftlichen Datenaustausch zugänglich zu machen, zum Beispiel durch Einstellung in öffentlich zugängliche Datenbanken oder akademische Repositorien.
1.5. Alle, die einen Beitrag geleistet haben, in gebührender Weise zu würdigen, und die Zustimmung jeder Person zur Veröffentlichung einzuholen:
1.5.a) Nur diejenigen, die maßgeblich zur Forschungsarbeit beigetragen haben, sollten als Autor:innen angeführt werden.
1.5.b) Der/die korrespondierende Autor:in muss sicherstellen, dass alle, die einen substanziellen Beitrag geleistet haben, als Mitautor:innen genannt werden und das Manuskript vor Einreichung gesehen und genehmigt haben. Der/die korrespondierende Autor:in muss sicherstellen, dass alle Autor:innen auch die Möglichkeit haben, die endgültige Version (nach Überarbeitung und/oder Prüfung des Korrekturabzugs) vor der endgültigen Veröffentlichung zu genehmigen.
1.5.c) Der/die korrespondierende Autor:in unterzeichnet eine Urheberrechtslizenz im Namen aller Autor:innen.
1.6. Die Ergebnisse kontextgerecht darzustellen und veröffentlichte Arbeiten durch korrekte Literaturangaben und Zitierung gebührend anzuerkennen:
1.6.a) Autor:innen dürfen Arbeiten (Ergebnisse, Ideen, Texte, Bilder) anderer nicht als eigene ausgeben (Plagiarismus).
1.6.b) Vor Einreichung ist eine Literaturrecherche durchzuführen.
1.6.c) Zitierungen sollten nur aufgrund ihrer Relevanz für die präsentierte Arbeit erfolgen. Überflüssige Zitierungen von nur am Rande verwandten Arbeiten, insbesondere solcher von Autor:innen aus der eigenen Gruppe, sind zu vermeiden.
1.6.d) Relevante Arbeiten aus unterschiedlichsten Quellen sollten gebührend genannt werden, einschließlich Vorabdrucken, Patenten, Büchern, Websites und persönlichen Mitteilungen.
1.6.e) Falls publiziertes Material verwendet wird, muss eine Erlaubnis gemäß dem Urheberrecht eingeholt werden.
1.7. Die Redakteur:innen über verwandte Einreichungen durch dieselben Autor:innen zu informieren, einschließlich:
1.7.a) Einreichungen der Autor:innen, die sich aktuell bei einer Zeitschrift zur Prüfung oder im Druck befinden. Die Manuskripte sollten gegebenenfalls Querverweise enthalten; dem Redaktionsbüro sind Kopien vorzulegen, und die Beziehung zum aktuellen Manuskript muss klar dargelegt werden.
1.7.b) Versionen derselben Arbeit, die zuvor bei der Zeitschrift eingereicht und (mit oder ohne Begutachtung) abgelehnt wurden. Falls die Einreichung eine überarbeitete oder erweiterte Version eines früher eingereichten Manuskripts ist, müssen die Änderungen erklärt und eventuelle Kommentare der Gutachter:innen beantwortet werden.
1.8. Keine Arbeit gleichzeitig bei mehreren Zeitschriften einzureichen. Forschungsergebnisse, die bei einer Zeitschrift geprüft oder überarbeitet werden, dürfen einer anderen Zeitschrift erst vorgelegt werden, nachdem das Manuskript abgelehnt oder zurückgezogen wurde.
1.9. Keine redundanten Veröffentlichungen vorzunehmen:
1.9.a) Autor:innen sollten eine unverhältnismäßige Aufsplittung ihrer Arbeit vermeiden, d. h. eine zusammenhängende Arbeit nicht unnötig in mehrere kürzere Artikel aufteilen.
1.9.b) Ein eingereichtes Manuskript sollte keine Hypothesen, Daten, Diskussionspunkte oder Schlussfolgerungen enthalten, die sich in erheblichem Maß mit anderen veröffentlichten oder eingereichten Publikationen decken. Falls es Überschneidungen gibt, sind vollständige Angaben dazu und entsprechende Quer- und Quellenverweise unerlässlich.
1.9.c) Eine frühere Veröffentlichung im Rahmen einer Abschlussarbeit zur Erlangung eines akademischen Grads schließt eine spätere Veröffentlichung in einer Zeitschrift nicht aus, doch muss dies bei der Einreichung vollständig offengelegt werden.
1.9.d) Die nochmalige Veröffentlichung eines Artikels in einer anderen Sprache kann akzeptabel sein, sofern bei der Einreichung die Originalquelle vollständig und klar angegeben ist.
1.10. Die Redakteur:innen zu informieren, bevor wesentliche inhaltliche Änderungen (einschließlich angegebener Werte und Liste der Autor:inn) nach Annahme eines Manuskripts vorgenommen werden, zum Beispiel bei der Einreichung der endgültigen Version durch Autor:innen oder während der Prüfung des Korrekturabzugs.
1.11. Alle Finanzierungsquellen für die präsentierte Arbeit anzugeben.
1.12. Potenzielle Interessenkonflikte offenzulegen, einschließlich finanzieller Beteiligungen am Ergebnis der Forschung, z. B. das Halten eines Patents oder der Besitz von Aktien.
1.13. Alle ungewöhnlichen (potenziellen) Gesundheits- oder Umweltrisiken im Zusammenhang mit den vorgestellten Arbeiten oder Materialien klar anzugeben und gegebenenfalls notwendige Vorsichtsmaßnahmen zu erläutern.
1.14. Keine Gutachter:innen zu empfehlen, die wegen persönlicher oder beruflicher Beziehungen zu Autor:innen positiv voreingenommen sein könnten, zum Beispiel Personen, mit denen diese/r in jüngster Zeit oder oft zusammengearbeitet hat, oder frühere Student:innen oder Betreuer:innen.
1.15. Sicherzustellen, dass die gesamte Kommunikation, einschließlich der Diskussion im Manuskript, der Antworten auf die Kommentare der Gutachter:innen und der Korrespondenz mit der Redaktion, immer fachlich geführt wird. Eine kritische Diskussion der Arbeit anderer kann angebracht sein, persönliche Kritik, Beleidigungen oder Diffamierungen sind jedoch inakzeptabel.
2. Verantwortlichkeiten der Gutachter:innen
Gutachter:innen haben die Aufgabe, bei der Beurteilung eines Manuskripts hinsichtlich seiner möglichen Veröffentlichung durch den Verlag Unterstützung zu leisten; sie sind Experten auf dem betreffenden Fachgebiet und nicht beim Verlag angestellt. Gutachter:innen haben die folgenden Verantwortlichkeiten:
2.1. Das Manuskript und den Überprüfungsprozess vertraulich zu behandeln.
2.1.a) Die Redakteur:innen müssen konsultiert werden, bevor weitere Personen in die Begutachtung eines Manuskripts einbezogen werden. Die von den Redakteur:innen beauftragte Person trägt die alleinige Verantwortung für die inhaltliche Prüfung.
2.1.b) Es dürfen weder die Identität der Gutachter:innen noch sonstige Details des Überprüfungsprozesses Dritten gegenüber offengelegt werden.
2.1.c) Kein Teil des Inhalts von eingereichten, unveröffentlichten Artikeln (Daten, Informationen, Interpretation, Diskussion) darf an Dritte weitergegeben werden.
2.1.d) Nach Abschluss der Überprüfung darf das eingereichte Manuskript in keiner Form gespeichert werden; Gutachter:innen müssen die einschlägigen Datenschutzvorschriften einhalten.
2.2. Keine Informationen (Daten, Interpretation und Diskussion), die sie auf vertraulicher Basis aus eingereichten, unveröffentlichten Artikeln erhalten haben, für ihre eigenen Forschungszwecke zu verwenden.
2.3. Die Redakteur:innen unverzüglich zu informieren, falls sie nicht über die notwendige Qualifikation verfügen oder aus anderen Gründen nicht zur Begutachtung des Manuskripts imstande sind.
2.4. Die Redakteur:innen zu informieren, falls im Laufe des Verfahrens ein Interessenkonflikt erkennbar wird. Im Zweifelsfall ist die Frage mit den Redakteur:innen abzuklären. Mögliche Interessenkonflikte sind unter anderem:
2.4.a) Fälle, in denen die Gutachter:innen in einer engen persönlichen oder beruflichen Beziehung zu den Autor:innen stehen, zum Beispiel, weil es sich um frühere akademische Betreuer:innen oder Student:innen oder Mitautor:innen oder Partner:innen handelt, mit den sie zuletzt oder häufig zusammengearbeitet haben.
2.4.b) Fälle, in denen die vorgestellte Arbeit in direkter Konkurrenz zu einem aktuellen Projekt steht, an dem die Gutachter:innen beteiligt sind.
2.5. Das Manuskript zeitnah zu prüfen; Die Redakteur:innen sollten sofort informiert werden, wenn die Gutachter:innen nicht mehr in der Lage sind, das Manuskript zu prüfen, oder mehr Zeit dafür benötigen.
2.6. Die Arbeit (einschließlich der ergänzenden Informationen) sorgfältig und objektiv zu prüfen; Gutachter:innen sollten ihre Bewertungen erläutern und belegen, gegebenenfalls auch durch Verweise auf bereits veröffentlichte Arbeiten. Literaturhinweise sollten nur auf Basis ihrer Relevanz für die vorgestellte Arbeit angegeben werden.
2.7. Kommentare für die Autor:innen höflich und professionell mit Fokus auf den Inhalt des Manuskripts zu formulieren und persönliche Kritik zu vermeiden.
2.8. Die Redakteur:innen über Ähnlichkeiten zwischen dem eingereichten Manuskript und bereits veröffentlichten oder aktuell bei anderen Zeitschriften zur Prüfung eingereichten Arbeiten zu informieren.
2.9. Die Redakteur:innen zu warnen, falls es Anzeichen für mögliche ethische Probleme gibt, einschließlich:
2.9.a) Wissenschaftliches Fehlverhalten, zum Beispiel Plagiarismus oder Datenmanipulation.
2.9.b) Unzureichend erörterte Gefahren oder Dual-Use-Bedenken, d. h. die Möglichkeit, dass die vorgestellte Arbeit in einer Weise missbraucht werden könnte, die eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit darstellt.
3. Verantwortlichkeiten der Redakteur:innen
Redakteur:innen können hauseigene Redakteur:innen sein oder aktive Forscher:innen, die im Auftrag des Verlags redaktionelle Aufgaben übernehmen; sie treffen die endgültige Entscheidung darüber, ob ein eingereichtes Manuskript angenommen oder abgelehnt wird. Die folgenden Verantwortlichkeiten gelten gegebenenfalls auch für Mitglieder der Redaktionsleitung.
Redakteur:innen von wissenschaftlichen Zeitschriften haben die folgenden Verantwortlichkeiten:
3.1. Redaktionelle Entscheidungen auf der Grundlage des wissenschaftlichen Werts der Arbeit zu treffen, ohne Rücksicht auf institutionelle Zugehörigkeit, Nationalität, ethnische Herkunft, Geschlecht, Alter oder sonstige persönliche Umstände der Autoren.
3.2. Alles zu tun, um einen fairen und zeitnahen Bewertungs-/Prüfungsprozess für eingereichte Manuskripte sicherzustellen.
3.3. Sicherzustellen, dass eingereichte Manuskripte vertraulich behandelt werden. Ohne Erlaubnis der Autor:innen sollten keine Details gegenüber anderen Personen mit Ausnahme der Gutachter:innen offengelegt werden, es sei denn, dies ist im Rahmen einer formalen Untersuchung wegen Vorwürfen unethischen Verhaltens erforderlich.
3.4. Mögliche Interessenkonflikte, die entstehen könnten, anzugeben. Dies ist besonders dann wichtig, wenn die Redakteur:innen in der Forschung sind:
3.4.a) Sind die Redakteur:innen Autor:innen eines eingereichten Manuskripts, muss das Manuskript an anderen Redakteur:innen zur unabhängigen Überprüfung weitergegeben werden.
3.4.b) Sind die Autor:innen aktuelle oder frühere Kolleg:innen und/oder häufiger Mitarbeiter:innen der Redakteuri:innen, muss das Manuskript an eine/n andere/n Redakteur:in zur Bearbeitung weitergegeben werden.
3.4.c) Die Redakteur:innen dürfen Arbeiten, die in noch unveröffentlichten eingereichten Manuskripten vorgestellt werden, nicht für eigene Forschungszwecke verwenden, und müssen das Manuskript, falls das Thema zu eng mit einem ihren eigenen Projekte verknüpft ist, an eine/n andere/n Redakteur:in zur Bearbeitung weiterleiten.
3.5. Gutachter:innen sorgfältig auszuwählen, um einen fairen Begutachtungsprozess sicherzustellen:
3.5.a) Von Autor:innen empfohlene Gutachter:innen sollten mit Vorsicht hinzugezogen werden, um positive Voreingenommenheit zu vermeiden (z. B. keine Mitautor:innen früherer Veröffentlichungen oder frühere akademische Betreuer:innen/Student:innen).
3.5.b) Die Kontaktdaten der von Autor:innen empfohlenen Gutachter:innen sollten unabhängig überprüft werden, um die Integrität des Peer-Review-Prozesses sicherzustellen.
3.5.c) Redakteur:innen haben das Recht, Gutachter:innen nach eigener Wahl zu beauftragen.
3.5.d) Wenn Autor:innen nicht gewünschte Gutachter:innen namentlich angeben, sollten letztere nicht beauftragt werden, es sei denn, daran besteht ein erhebliches, übergeordnetes Interesse.
3.6. Sicherzustellen, dass die Namen und anderen Daten der Gutachter:innen vertraulich behandelt werden. Im Ausnahmefall, z. B. wenn Verdacht auf ethisches Fehlverhalten besteht, können Gutachter:innen über die Namen der Vorgutachter:innen informiert werden.
3.7. Beschwerden gegen redaktionelle Entscheidungen fair und sorgfältig zu prüfen.
3.8. Die einschlägigen Datenschutzvorschriften einzuhalten.
3.9. Hinweisen oder Vorwürfen wegen fragwürdiger Forschungspraktiken nachzugehen. Siehe Abschnitt 4 „Umgang mit unethischem Verhalten“.
4. Fragwürdige Forschungspraktiken und unethisches Verhalten
Fragwürdige Forschungspraktiken bei Veröffentlichungen sind unter anderem:
- Betrug: Datenerfindung oder Fälschung/Manipulation von Daten in der Weise, dass Erkenntnisse falsch dargestellt werden, einschließlich Vorenthalten von Informationen, die Auswirkungen auf die Interpretation oder Schlussfolgerungen haben würden.
- Mehrfacheinreichung: gleichzeitige Einreichung derselben Forschungsergebnisse (insgesamt oder teilweise) bei verschiedenen Zeitschriften. Ebenso Mehrfachveröffentlichung: Veröffentlichung derselben Forschungsergebnisse bei verschiedenen Zeitschriften ohne korrekte Angaben und ohne Erlaubnis.
- Mangelhafte Zitierung: Einreichung von inhaltlich eng verbundenen Artikeln ohne angemessene Querverweise; keine Nennung von früheren Arbeiten; absichtlicher Verzicht auf die Zitierung oder Diskussion von verwandten (einschließlich eigenen) Arbeiten, um den scheinbaren Neuigkeitswert der Ergebnisse zu steigern.
- Plagiarismus: Materialien einschließlich Ergebnisse, Ideen und Texte aus den Arbeiten anderer als eigene ausgeben. Ebenso Selbstplagiate: das Wiederverwenden wesentlicher Inhalte aus eigenen früheren Veröffentlichungen. Die Wiederverwendung von Text aus eigenen (zitierten) Arbeiten des Autors oder der Autorin kann in einer Einleitung oder im experimentellen Teil angebracht sein, es sollte jedoch keine erheblichen Überschneidungen im Hauptteil geben.
- Fehlverhalten von Gutachter:innen: Keine Angabe von Interessenkonflikten; Verhindern/Verzögern der Veröffentlichung von Konkurrenzarbeiten; Verwendung von vertraulichen unveröffentlichten Informationen für eigene Forschungszwecke.
- Fehlverhalten von Autor:innen: Nichterwähnung von Personen in der Autorenliste, die einen bedeutsamen intellektuellen Beitrag geleistet haben, oder Nennung von Personen, auf die dies nicht zutrifft; Nennung einer Person als Autor:in ohne deren Zustimmung und Genehmigung des eingereichten Entwurfs.
Umgang mit unethischem Verhalten
- Redakteur:innen müssen allen Vorwürfen wegen wissenschaftlichen Fehlverhaltens nachgehen, auch bei anonymen oder in sonstiger Form von Dritten gegebenen Hinweisen, sofern klare Beweise vorgelegt werden. Gegebenenfalls können Gutachter:innen oder Mitglieder der Redaktionsleitung konsultiert werden.
- Bei Zweifeln hinsichtlich der korrekten Vorgehensweise sollten die Wiley Best Practice Guidelines on Publishing Ethics und/oder die Leitlinien des Committee on Publication Ethics (COPE) eingesehen werden.
- Der betreffende Autor oder Gutachter oder die betreffende Autorin oder Gutachterin sollte informiert und ihm/ihr Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.
- Redakteur:innen können formale Untersuchungen nicht selbst durchführen. In komplexen Fällen oder wenn die Vorwürfe bestritten werden, kann eine institutionelle Untersuchung verlangt werden.
- Idealerweise sollten Institutionen über einen Ombudsman oder eine andere zuständige Person für ethische Fragen verfügen, die die Anfrage der Zeitschrift unverzüglich beantwortet und mitteilt, welche Schritte ergriffen werden. Es sollte innerhalb einer angemessenen Frist eine umfassende und faire Untersuchung durchgeführt werden, nach deren Abschluss die Institution die Zeitschrift über ihre Ergebnisse unterrichtet.
- Gegebenenfalls sollte eine Rücknahme des Artikels oder ein Corrigendum zur Berichtigung des wissenschaftlichen Werts veröffentlicht werden.
- In seltenen Fällen kann es notwendig sein, Sanktionen gegen Forscher:innen, die an fragwürdigen Forschungspraktiken oder Veröffentlichung unter Verstoß gegen ethische Grundsätze beteiligt waren, anzuwenden. Die Redaktion kann zum Beispiel erwägen, den Artikel mit einer Warnung in Bezug auf zukünftiges Verhalten abzulehnen oder ein Verbot gegen Autor:innen oder Gutachter:innen in Bezug auf die Einreichung weiterer Manuskripte oder die Gutachtertätigkeit für einen bestimmten Zeitraum auszusprechen oder die Institution des Autors oder der Autorin zu informieren. Sanktionen sollten konsequent und erst nach sorgfältiger Prüfung angewandt werden. Es sollte die Möglichkeit bestehen, bei der Zeitschrift und/oder beim Verlag schriftlich gegen ausgesprochene Sanktionen Beschwerde einzulegen.
- In Fällen von eng verwandten Einreichungen/Veröffentlichungen bei verschiedenen Zeitschriften können Redakteur:innen die Redakteur:innen der anderen Zeitschriften, auch anderer Verlage, warnen und an diese zur Klärung des Falles notwendige Informationen weitergeben.
Version 2.0, 2022. Die ethischen Leitlinien wurden von Ernst & Sohn GmbH für die Zeitschriften des Verlags übersetzt und angepasst.
Version 1.0, 2021. Author Contributions: These Ethical Guidelines were written by Tamaryin Godinho and Ulf Scheffler in collaboration with Irem Bayindir-Buchhalter, Elizabeth Moylan, and Chris Graf for journals published by Wiley-VCH GmbH and John Wiley & Sons, Ltd.