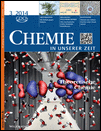Theoretische Chemie? Barrieren überwinden!
Graphical Abstract
Theoretische Chemie? Barrieren überwinden!
Niemals werde ich die allererste Stunde meiner Grundvorlesung “Physikalische Chemie” für Zweitsemester-Studierende der Chemie und Chemischen Biologie an der TU Dortmund vergessen. Während der Vorstellung meiner Person und der Arbeitsgruppe versuchte ich, die üblichen Ängste der Studierenden vor den kommenden Semestern abzubauen und erwähnte beiläufig, dass ich “Theoretiker” sei. Es ging ein Raunen und Aufstöhnen durch den vollbesetzten Hörsaal – obwohl mit ziemlicher Sicherheit sich kaum einer der Anwesenden etwas Konkretes unter dem Begriff “Theorie” in der Chemie vorstellen konnte.
Verwunderlich ist das im Nachhinein nicht. Der Nimbus des “Praktikers” im Vergleich mit dem “Theoretiker” zieht sich durch alle gesellschaftlichen und beruflichen Ebenen und scheint offenbar bereits in den Köpfen junger Menschen mit bestimmten qualitativen Vorurteilen und abgrenzenden bis wertenden Charakteristika verknüpft zu sein. Während der Praktiker die realen Probleme anpackt und löst, gilt der Theoretiker doch als weltfern und bisweilen sogar nutzlos. Gleichzeitig weckt das Wort “Theorie” offenbar auch tief sitzende Ängste, zumindest unter Chemiestudierenden. Auch dies wundert nicht, denn die typische Zielgruppe für ein Chemie- bzw. Biochemiestudium ist geprägt durch ein starkes Interesse an real beobachtbaren Phänomenen, experimentelle Arbeit im Labor, und weniger durch die quantitative und mathematische Beschreibung der Natur in Abgrenzung beispielsweise zur Physik. Dies erklärt auch die unterschwellige Besorgnis einer Mehrheit, ein Pflichtfach wie die Physikalische Chemie im Studium zu bewältigen, die zudem in der schulischen Ausbildung typischerweise nur geringen Anteil hat. In der Konsequenz wählen aus einer Kohorte Chemiestudierender prozentual weniger Interessierte die Physikalische und noch weniger die Theoretische Chemie als Spezialgebiet verglichen mit den Bereichen Anorganische, Organische oder Biochemie.
Diese Situation wird allerdings der Realität in der akademischen und industriellen chemischen und biochemischen Forschung nicht gerecht. Im Material- und Medikamentendesign oder der rationalen Syntheseplanung spielen theoretische Modellierungsansätze eine zunehmend größere Rolle. Zur Illustration (ohne Anspruch auf sachgerechte statistische Auswertung nach allen Regeln der Kunst) sei das Ergebnis einer Recherche nach Artikeln, die im weitest gehenden Sinne theoretische Arbeiten in der (Bio-)Chemie beinhalten, in allen Datenbanken von Web of Science (http://wokinfo.com) dargestellt. Neben der offenbar seit Jahrzehnten (erschreckend) exponentiellen Zunahme von Veröffentlichungen (absolute Anzahl insgesamt: Ntot, Theorie-Artikel: Nth) fallen zwei zeitliche Marken im vergangenen Jahrhundert auf, an denen die Theorie in der Chemie gemessen am relativen Anteil Rth = Nth/Ntot an Relevanz gewann: Zum einen die Mitte der 60er Jahre, was mit der Verfügbarkeit von quantenchemischer Software auf (wenigen) Großrechnern an Universitäten zusammenhängen dürfte, zum anderen der Beginn der 90er Jahre, geprägt durch den massiven Zuwachs an bezahlbarer Computerleistung und vermutlich den zunehmenden Einsatz von Simulationsmethoden, insbesondere der Moleküldynamik. Fakt ist: seit vielen Jahren wächst der Anteil und damit die Bedeutung der Theorie monoton.
Um diese Diskrepanz zur Ausbildungssituation zu korrigieren, hat sich Chemie in unserer Zeit zur Aufgabe gemacht, im Rahmen der mehrteiligen Themenreihe “Theoretische Chemie” Studierende und auch fortgeschrittene Schüler mit den vielen Facetten der Theorie in verständlicher Weise vertraut zu machen. Die Artikel sollen einen Eindruck über die Bandbreite theoretischer und computergestützter Verfahren (“Computational Chemistry”) der modernen Chemie vermitteln, ihre fließenden Grenzen zu den klassischen chemischen Fächern und die Brückenfunktion für interdisziplinär zu lösende Fragestellungen darstellen. Ich freue mich, dass sich eine Reihe hervorragender Autoren bereit erklärt haben, dieses Ziel zu unterstützen: Grundlegende Methoden werden eingeführt von Georg Jansen (Universität Duisburg-Essen) zur Quantenchemie, Philippe Bopp (Université Bordeaux) zur Molekulardynamiksimulation und Thomas Engel (LMU München) zur Chemoinformatik. Die zweite Hälfte umfasst speziellere Themen: Dirk Zahn (Universität Erlangen-Nürnberg) berichtet über Simulationsverfahren für seltene Vorgänge, Stefan Güssregen (Sanofi) über die Anwendung theoretischer Methoden in der pharmazeutischen Industrie, ich selbst über die Modellierung von Solvenseffekten.
Natürlich kann eine begrenzte Reihe nicht das gesamte Feld umfassend beschreiben. Wir als Autoren setzen uns aber zum Ziel, die Theoretische Chemie als lebensnahe, fachübergreifende und vor allem spannende Disziplin zu vermitteln. Theorieinteressierten soll der Zugang erleichtert, Praktikern die mitunter fremdartige Sprache der Theorie vermittelt werden. Hierdurch hoffen wir, beiderseitige Barrieren zu überwinden.
Stefan M. Kast

Prof. Dr. Stefan M. Kast studierte Chemie an der TH (später TU) Darmstadt und fertigte dort seine Doktorarbeit an. Nach einem Postdoc-Aufenthalt an der University of Chicago (U.S.A.) habilitierte er sich für Physikalische Chemie an der TU Darmstadt. Seit 2009 ist er Professor für Theoretische Physikalische Chemie an der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der TU Dortmund.