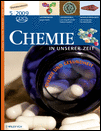Der gehörnte Roggen. Ein chemischer Blick auf den Isenheimer Altar
Abstract
deDer Pilz Claviceps purpurea war und ist eine gängige Verunreinigung von Getreide, vor allem Roggen. Besonders im Mittelalter führte der Verzehr von mit Claviceps purpurea verunreinigtem Brot häufig zu seuchenartig auftretenden Epidemien. Die Krankheit wurde wegen des brennenden Schmerzes in den Extremitäten als Antoniusfeuer bezeichnet und führte über Abfaulen von Gliedmaßen und Krampfanfällen schließlich zum Tode. Die Ursache der Krankheit liegt in den pharmakologisch hoch wirksamen Alkaloiden des Pilzes, die chemisch betrachtet Derivate der Lysergsäure sind. Die Geschichte der Krankheit, die Entdeckung der Ursachen und der Nachweis, die Isolierung und Strukturaufklärung der Mutterkorn-Alkaloide werden dargestellt. Der Pilz befällt immer noch das Getreide, aber dank enormer, auf naturwissenschaftlichen und vor allem chemischen Erkenntnissen beruhender Anstrengungen, können wir heute unser tägliches Brot ohne Angst genießen.
Abstract
enThe fungus Claviceps purpurea was and is a common contaminant in cereals, especially rye. Historically, consumption of Claviceps purpurea contaminated bread was frequently responsible for epidemics in the Middle Ages. The disease was called St. Anthony's fire because of the burning sensations in the limbs that resulted before the other symptoms of gangrene, convulsions, and ultimately death. The disease is caused by a pharmacologically very potent group of alkaloids in the fungus which chemically are lysergic acid derivatives. The history of the disease, the discovery of its cause and detection, isolation and structure determination of the ergot alkaloids are shown. The fungus is still with us, but enormous efforts based on scientific, especially chemical knowledge guarantee that we can enjoy our daily bread without harm.
REFERENCES
- 1 Auch im 19. und 20. Jahrhundert traten Epidemien lokal auf, z.B. 1951 in Frankreich und 1978 in Äthiopien. Das Mutterkorn, E. Mühle und K. Breuel, 1977, A. Ziemsen Verlag, Lutherstadt Wittenberg.
- 2 Kranke fanden manchmal ihre abgestoßenen Finger und Zehen nach dem Ausziehen in ihren Handschuhen und Stiefeln. Es wurde von einer Frau berichtet, die auf einem Esel zur Amputation ihres Beines in das Hospital reiste, dort aber bereits amputiert ankam, da sich das Bein durch die Erschütterungen beim Ritt ohne Schmerzen und Blutungen unterwegs abgelöst hatte. R. Kobert, Hist. Stud. Pharmakol. Inst. Kaiserl. Univ. Dorpat, 1889 1.
- 3 Die Spezialisierung auf eine Krankheit machte den Antoniterorden erfolgreich, aber besiegelte auch sein Ende. Als die Ursache der Krankheit im 18. Jahrhundert erkannt war und Epidemien nicht mehr auftraten, verlor der Orden seine Aufgabe und ging 1776 im Malteserorden auf.
- 4 Diese vorwurfsvolle Frage: “Ubi eras, Jesus bone. Ubi eras quare non affuisti ut savares vulnera mea?” hat Grünewald wie in einem Comic im unteren rechten Bildrand festgehalten. Tatsächlich hatte Gott ihn nicht verlassen, sondern antwortete: “Antonius, ich war hier, aber ich wartete, um dein Kämpfen zu sehen. Da du den Streit bestanden hast, ohne zu unterliegen, werde ich dir immer hilfreich sein, und ich werde dich berühmt machen allerorten.” (Kap. 10 in Atanasius vita antonii, siehe www.unifr.ch/bkv/kapitel44.htm).
- 5 W. Kühn, Ann. Soc. Hist. Litt. Colmar 1951, 1952, 20. Daneben ist die von den Bäumen herabhängende Bartflechte (Usnea barbata) zu erkennen, die in feuchten Wäldern oberhalb von 1000 m von den Baumästen herunter wächst.
- 6 U.Schedlik, siehe http://joerg-sieger.de/isenheim/menue/frame10.htm; Die Webseite von Pfarrer Jörg Sieger (http://joerg-sieger.de/isenheim.htm) ist eine ausgezeichnete Quelle für ein tieferes Verständnis des Isenheimer Altars.
- 7 E. Clémentz, Antoniter-Forum 1994, 2, 13. Dort ist die detaillierte Rezeptur angegeben.
- 8 P. Thieme, Veröff. Geb. Medizinalverw., 1930, 1, Richard Scholz Verlag, Berlin.
- 9 Die Sicherheit dieser Überlieferung ist noch immer umstritten. Grund dafür ist, dass in den alten Kulturländern rund um das Mittelmeer vorwiegend Weizen angebaut wurde. So vermutet Guggisberg eher eine Verunreinigung des Getreides durch Rostpilze, die auch zu schweren Erkrankungen in der Bevölkerung führen kann. Mutterkorn, H. Guggisberg, 1954, 52, Karger, Basel.
- 10 Einige Quellen bezeichnen 1630 als das Jahr der Entdeckung, andere das Jahr 1676. Nach Thieme [8] entdeckte Tuillier 1630 Mutterkorn als Ursache des Ergotismus, die Ergebnisse wurden aber erst 1676 unter Mithilfe seines Sohnes veröffentlicht.
- 11 Versuche mit dem Mutterkorn, D. T. A. Schleger, 1770, Hofbuchdruck Henrich Schmiede, Kassel.
- 12 Claviceps bedeutet wörtlich übersetzt schlüsselköpfig. Der zweite Teil des Namens purpurea ist sicher leichter zu deuten: Das Mutterkorn ist außen oft violett und die Fruchtkörper zeigen manchmal eine leuchtend rosarote Farbe.
- 13 Zum Austreiben im kommenden Frühjahr benötigt das Mutterkorn während des Winters 6 bis 8 Wochen lang Temperaturen zwischen 2 bis 4°C. siehe: H. Mielke, Mitteil. Biol. Bundesanstalt 2000, Heft 375, www.bba.de/veroeff/mitt/pdfs/mitt375.pdf.
- 14 Den genauen Ablauf der Sporenbildung und Entwicklung bei Ascomyceten findet der interessierte Leser in Die Welt der Pilze, H. Dörfelt, E. Ruske, 2008, Weissdorn-Verlag, Jena.
- 15 Ascus (lat. Schlauch) gab der gesamten Abteilung der Ascomyceten (Schlauchpilze) den Namen. Zu den Ascomyceten gehören bekannte Vertreter wie Trüffel und Morcheln.
- 16 Als pflanzlichen Honigtau werden zuckerhaltige Ausscheidungen bei Getreideblüten, die vom Mutterkornpilz befallen sind, bezeichnet. Bekannter ist oft der tierische Honigtau, bei dem es sich zwar ebenfalls um zuckerhaltige Ausscheidungen handelt, diese aber von Blatt- und Schildläusen stammen.
- 17 Bei Weizen liegen die Verhältnisse anders: Die Weizenblüte kann sich im Gegensatz zur Roggenblüte selbst bestäuben. Sie öffnet sich ohnehin nur wenige Minuten und bleibt bei feuchter Witterung ganz geschlossen, so dass eine Infektion mit dem Mutterkornpilz nicht möglich ist (siehe [9]).
- 18 Die Abläufe der Hexenprozesse von Salem regten Arthur Miller zu seinem Drama “Hexenjagd” (The Crucible, 1953) an, einer Parabel auf die Kommunistenhatz in der US-amerikanischen McCarthy-Ära. Das Drama wurde mehrfach verfilmt, letztmalig 1996.
- 19 Praktisch alle Verhörprotokolle und Gerichtsakten der Hexenprozesse von Salem sind im Internet zugänglich: http://etext.virginia.edu/salem/witchcraft/texts/transcripts.html, www.gutenberg.org/files/17845/17845-h/salem2-htm.html, www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/salem/salem.htm, Eine Zusammenfassung aller Zeugenaussagen gegen Sarah Good findet sich z.B. unter www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/salem/ASA_GOOD.HTM.
- 20 Auch zwei Hunde wurden gehängt, da nach damaliger Überzeugung der Teufel häufig in Hundegestalt sein Unwesen trieb.
- 21 L. R. Carporael, Science 1976, 192, 21.
- 22 M. K. Matossian, Am.Sci. 1982, July/August, 355. Poisons of the Past, M.K. Matossian, 1989, Yale University Press, New Haven.
- 23 Auch die klimatischen Verhältnisse in den späteren Jahre 1693–1698 begünstigten einen Mutterkornbefall. Nach 1693 waren jedoch Hexenprozesse verboten, so dass keine Berichte über aufgetretene Erkrankungen vorliegen.
- 24 Salem witchcraft papers, vol 2, P. Boyer and S. Nissenbaum (eds.), pp. 410, 423 und 524; Siehe http://etext.virginia.edu/salem/witchcraft/texts/transcripts.html.
- 25 Der Pharmakologe Sir Arnold Burgen bezeichnete das Mutterkorn zu Recht nicht nur als Fluch, sondern auch als ein Geschenk des heiligen Antonius: “St. Anthony's Gift”, Eur. Rev. 2003, 11, 27.
- 26
Die Aufklärung der grundlegenden Strukturen dieser Verbindungen verdanken
wir vor allem den Arbeiten von Adolf Windaus (1876–1959) (Nobelpreis
für Chemie 1929) Siehe
H. Remane,
ChemKon
2009,
16,
164.
10.1002/ckon.200990024 Google Scholar
- 27 Stoll war damals Leiter des Pharmazeutischen Departements der Firma Sandoz in Basel und hat sich ein Leben lang mit den Inhaltsstoffen des Mutterkorns befasst. Eine Übersicht: A. Stoll, Helv.Chim.Acta 1945, 28, 1283.
- 28
D. Gröger,
Fortschr.Chem. Forsch
1966,
6,
159.
10.1007/BFb0051579 Google ScholarKurzer historischer Abriss: A. Stoll, A. Hofmann, Helv.Chim.Acta 1943, 26, 1570.
- 29 S. Smith und G.M. Timmis, J.Chem. Soc. 1932, 1543. W. A. Jacobs und L. C. Craig, Science 1935, 81, 256. Vgl. J. Org, Chem. 1937, 1, 245.
- 30 E.C. Kornfeld, R.B. Woodward et al., J.Am.Chem.Soc. 1954, 76, 5256.
- 31 Totalsynthese des Ergotamins: A. Hofmann et al., Experientia 1961, 17, 206. Weitere Synthesen: I. Moldvai et al., Helv.Chim.Acta 2005, 88, 1344.
- 32 W. Schlientz, A. Hofmann et al., Experientia 1961, 17, 108.
- 33 Getreidemarktordnung Nr. 824/200 vom 19.4.2000.
- 34 J. Wolff et al., Z.Ernährungswiss. 1988, 27, 1.
- 35 Dieser hohe Durchsatz wird erreicht, weil eine Kamera die herabfallenden Körner in 72 Schächten gleichzeitig erfasst. Durch Parallelbetrieb mehrerer Kameras kann der Durchsatz in einem Farbausleser auf über 150.000 Körner pro Sekunde gesteigert werden.
- 36 U. Lauber et al., Mycotoxin Res. 21, (2005), 258.
- 37 Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung vom 22. Januar 2004.
- 38 Aber Achtung: Einige Bioverbände verbieten den Anbau von Hybridroggen, der wesentlich anfälliger gegenüber einer Mutterkorninfektion ist. Dadurch ist “Bio”-Roggen von vornherein wesentlich weniger mit Mutterkorn belastet. Dennoch wird auch dieser in aller Regel mit dem high-tech-Aufwand einer Großmühle noch weiter gereinigt. Siehe [36].
- 39 H.J. Pfänder et al Deutsches Ärzteblatt 1985, 82, 2013.
- 40 R. Giebelmann, toxichem krimtech 2002, 1, 30.
- 41 Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten, v. Siebold (Hrsg.), 1837, 10. Band, Verlag Wilhelm Engelmann, Leipzig.
- 42 Deutsches Arzneibuch, 6. Ausgabe, 1926, Verlag Decker, Berlin.
- 43 Um 1900 diente der sogenannte “Hahnenkammtest” der Gehaltsbestimmung von Mutterkornpräparaten. Einem Hahn wurde dazu eine definierte Menge Mutterkornextrakt intramuskulär injiziert. Zum Vergleich wird eine Substanz mit bekanntem Alkaloidgehalt verwendet. Die sichtbar werdenden Durchblutungsstörungen im Kamm dienten zur Auswertung. Der gleiche Hahn durfte zur Wertbestimmung nicht vor Ablauf von zwei Wochen wiederverwendet werden (siehe [9]).
- 44 P. van Dongen, A. de Groot, Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 1995, 60, 109.
- 45 W. Rath, W. Gogarten, Frauenarzt 2008, 49, 498.
- 46 P.C. Tfelt-Hansen, P.J. Koehler, cephalalgia 2008, 28, 877.
- 47 Dies gilt nicht für alle Patienten, denn die meisten können Migräne- von Ergotamin-induzierten Kopfschmerzen genau unterscheiden.
- 48 P.C. Tfelt-Hansen, P.J. Koehler, cephalalgia 2008, 28, 1126.
- 49 Bevorzugt werden als Migränetherapeutika heute Arzneimittel aus der Wirkstoffgruppe der Triptane.
- 50 Hagers Handbuch der pharmakologischen Praxis, Drogen A-D, R. Hänsel et al., 1992, Springer, Berlin.
- 51 Wer waren die Antoniter?, A. Mischlewski, 2000, Stadtarchiv Memmingen. So brillant die Idee war, es ging auf Dauer schief, denn Schweine sind nicht ungefährlich. So kam der französische Kronprinz Philippe 1131 ums Leben, weil ein Schwein sein Pferd zum Straucheln brachte und in London wurde 1322 ein Säugling von einem Schwein zu Tode gebissen. Frei herumlaufende Schweine waren aber auch ein hygienisches Problem und viele Städte begrenzten die Anzahl der Antoniterschweine z.B. Lübeck 1465 auf 20 und München 1475 auf vier. Im süddeutschen Volksmund wird der heilige Antonius liebevoll als Sau-Toni bezeichnet, um eine Verwechslung mit dem Schlamper-Toni zu vermeiden, denn der heilige Antonius von Padua ist der Schutzpatron der Vergesslichen (“Schlamperten”).
- 52 Strasburger – Lehrbuch der Botanik, Bresinsky, A. et al., 2008, Spektrum Verlag, Heidelberg.
- 53 R. Itterheim, Kult. Wissenschaftsgesch. 2007, 18, 639.
- 54 Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, 1798, Adelung, Band 3, Leipzig.
- 55
B. Franck,
Angew. Chem.
1969,
81,
269.
10.1002/ange.19690810802 Google Scholar
- 56 P.S. Steyn, Tetrahedron 1970, 26, 51.
- 57 B. Franck, Angew. Chem. 1984, 96, 462.
- 58 M. Yamazaki et al., Chem. Pharm.Bull. 1971, 19, 199.
- 59 Tree-Ring chronologies of eastern North America, E. DeWitt und M. Ames, (eds.), 1978, Tucson, loc. cit. [22].
- 60 Auch die Wachstumsringe der Jahre 1693-95 lassen auf einen hohen Mutterkornbefall schließen. Da Hexenprozesse ab 1693 verboten waren, liegen Unterlagen über das Auftreten entsprechender Symptome in der Bevölkerung nicht vor.
- 61 H.G. Floss, Tetrahedron 1975, 32, 873.
- 62 www.muehle-heiligenrode.de/mtrieur.htm