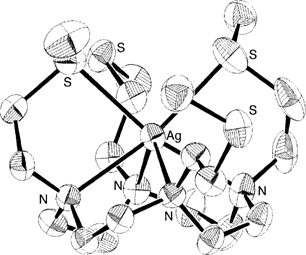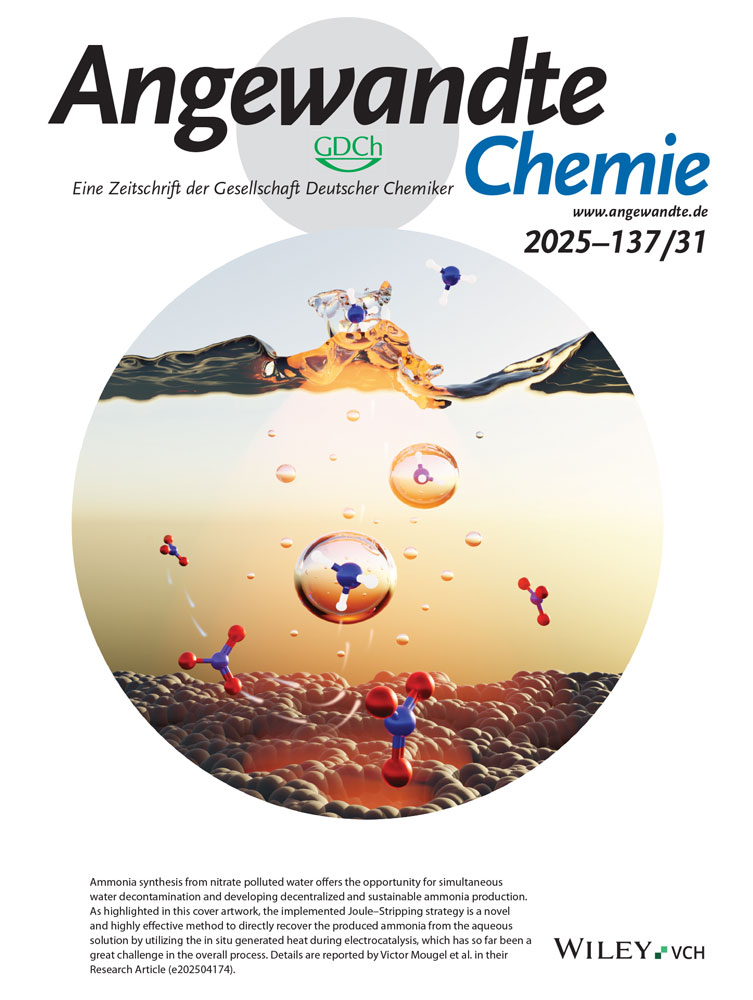Ein hochstabiler Silber(I)-Komplex mit einem makrocyclischen Liganden†
Dipl.-Chem. Thomas Gyr
Institut für Nuclearmedizin des Universitätsspitals Petersgraben 4, CH-4031 Basel (Schweiz) Telefax: Int. + 61/265-4897 E-mail: [email protected]
Search for more papers by this authorCorresponding Author
Prof. Dr. Helmut R. Mäcke
Institut für Nuclearmedizin des Universitätsspitals Petersgraben 4, CH-4031 Basel (Schweiz) Telefax: Int. + 61/265-4897 E-mail: [email protected]
Institut für Nuclearmedizin des Universitätsspitals Petersgraben 4, CH-4031 Basel (Schweiz) Telefax: Int. + 61/265-4897 E-mail: [email protected]Search for more papers by this authorDr. Michael Hennig
Hoffmann-La Roche, Pharma Research, 65/308 CH-4070 Basel (Schweiz)
Search for more papers by this authorDipl.-Chem. Thomas Gyr
Institut für Nuclearmedizin des Universitätsspitals Petersgraben 4, CH-4031 Basel (Schweiz) Telefax: Int. + 61/265-4897 E-mail: [email protected]
Search for more papers by this authorCorresponding Author
Prof. Dr. Helmut R. Mäcke
Institut für Nuclearmedizin des Universitätsspitals Petersgraben 4, CH-4031 Basel (Schweiz) Telefax: Int. + 61/265-4897 E-mail: [email protected]
Institut für Nuclearmedizin des Universitätsspitals Petersgraben 4, CH-4031 Basel (Schweiz) Telefax: Int. + 61/265-4897 E-mail: [email protected]Search for more papers by this authorDr. Michael Hennig
Hoffmann-La Roche, Pharma Research, 65/308 CH-4070 Basel (Schweiz)
Search for more papers by this authorDiese Arbeit wurde vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung unterstützt (Förder-Nr. 31–42516/94). Wir danken Karin Stalder und Pia Powell für ihre technische Hilfe.
Abstract
Die höchste bekannte Bindungskonstante für Silber(I)-Ionen (lg K = 19.63) wurde bei einem Silberkomplex (Struktur im Kristall siehe rechts) mit einem auf Cyclen basierenden Liganden gemessen. Dieser enthält vier Stickstoff- und vier Schwefelatome, aber dennoch bevorzugt das weiche Silber(I)-Ion die Koordination durch die Stickstoffatome und bindet im Festkörper nur zwei Schwefelatome. Der Chelatligand wurde für eine therapeutische In-vivo-Anwendung des β-strahlenden Radionuclids 111Ag entwickelt.
References
- 1 P. J. Sadler, R. E. Sue in Handbook of Metal-Ligand Interactions in Biological Fluids, Vol. 2 (Hrsg.: G. Berthon), Marcel Dekker, Basel, 1995, S. 1039–1051.
- 2 R. Alberto, P. Bläuenstein, I. Novak-Hofer, A. Smith, P. A. Schubiger, Appl. Radiat. Isot. 1992, 43, 869–872.
- 3 C. A. Hoefnagel, Eur. J. Nucl. Med. 1991, 408–431.
- 4a) C. F. Meares, M. K. Moi, M. J. McCall, W. C. Cole, S. J. DeNardo, Anal. Biochem. 1985, 148, 249–253; b) J. R. Morphy, D. Parker, R. Kataky, A. Harrison, M. A. W. Eaton, A. Millican, A. Phipps, C. Walker, J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1989, 792–794; c) P. M. Smith-Jones, R. Fridrich, T. A. Kaden, I. Novak-Hofer, K. Siebold, D. Tschudin, H. R. Mäcke, Bioconjugate Chem. 1991, 2, 415–421.
- 5a) M. K. Moi, C. F. Meares, S. J. DeNardo, J. Am. Chem. Soc. 1988, 110, 6266–6267; b) R. W. Kozak, A. Raubitschek, S. Mirzadeh, M. W. Brechbiel, R. Junghaus, O. A. Gansow, T. A. Waldmann, Cancer Res. 1989, 49, 2639–2644.
- 6a) A. S. Craig, R. Kataky, D. Parker, H. Adams, N. Bailey, H. Schneider, J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1989, 1870–1872; b) P. C. Riesen, T. A. Kaden, Helv. Chim. Acta 1995, 78, 1325–1333; c) R. Alberto, W. Nef, A. Smith, P. A. Schubiger, T. A. Kaden, M. Neuburger, M. Zehnder, A. Frey, U. Abram, Inorg. Chem. 1996, 35, 3420–3427.
- 7 K. R. Adam, D. S. Baldwin, A. Bashall, L. F. Lindoy, M. McPartlin, H. R. Powell, J. Chem. Soc. Dalton Trans. 1994, 237–238.
- 8 J. Clarkson, R. Yagbasan, P. J. Blower, S. C. Rawle, S. R. Cooper, J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1987, 950–951.
- 9 H. Maumela, R. D. Hancock, L. Carlton, J. H. Reibenspies, K. P. Wainwright, J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 6698–6707.
- 10 F. A. Cotton, G. Wilkinson, P. L. Gaus, Grundlagen der Anorganischen Chemie, VCH Weinheim, 1990, S. 582 f.
- 11a)
A. J. Blake,
R. O. Gould,
G. Reid,
M. Schröder,
Polyhedron
1989,
513–518;
b)
A. J. Blake,
R. O. Gould,
S. Parsons,
C. Radek,
M. Schröder,
Angew. Chem.
1995,
107,
2563–2565;
10.1002/ange.19951072108 Google ScholarAngew. Chem. Int. Ed. Engl. 1995, 34, 2374–2376.
- 12 A. K. W. Stephens, R. S. Dhillon, S. E. Madbak, S. L. Whitbread, S. F. Lincoln, Inorg. Chem. 1996, 35, 2019–2024.
- 13 R. M. Izatt, K. Pawlak, J. S. Bradshaw, R. L. Bruening, Chem. Rev. 1991, 91, 1721–1735.
- 14 A. D. Zuberbühler, T. A. Kaden, Talanta 1982, 29, 201–206.
- 15 Kristallstrukturanalysen. a) Allgemeines: Alle Messungen wurden auf einem Nicolet-P3-Diffraktometer mit Graphit-monochromatisierter MoKα-Strahlung durchgeführt Die kristallographischen Daten (ohne Strukturfaktoren) der in dieser Veröffentlichung beschriebenen Strukturen wurden als „supplementary publication no. CCDC-100510”︁ beim Cambridge Crystallographic Data Centre hinterlegt Kopien der Daten können kostenlos bei folgender Adresse in Großbritannien angefordert werden: The Director, CCDC, 12 Union Road, Cambridge CB21EZ (Telefax: Int. + 1223/336–033; E-mail: [email protected]). b) Hdotete+PF6−: C20H45F6N4PS4, monoklin, Raumgruppe P21/n, a = 14.487 (3), b = 14.225(3), c = 14.848(3) Å, β = 95.81(3)° V = 3044.2(11) Å3, Z = 4, ρber. = 1.339 g cm−3, T = 293 K. Die Struktur wurde mit Direkten Methoden gelöst, fehlende Atome wurden durch Differenz-Fourier-Methoden bestimmt und nach der Methode der kleinsten Quadrate gegen F1 unter Verwendung des Programmpakets SHELX-93 verfeinert[16]. Anisotrope Temperaturfaktoren und Bindungslängen wurden wegen der schwachen Reflexe mit Restraints verfeinert. 2390 gemessene (Maximum 2ϑ = 35°), 1886 unabhängige Reflexe Es wurden 317 Parameter mit 93 Restraints verfeinert, wobei 1457 unabhängige Reflexe mit I > 2σ(I) kristallographische R-Werte von R = 0.117 und Rw = 0.249 ergaben. c) 2: C40H88Ag2F12N8P2S 8, monoklin, Raumgruppe P21/a, a = 14.330(4), b = 25.350(5), c = 17.932(3) Å, β = 107.66(3)°, V = 6207.1(24) Å3, Z = 8, ρber. = 1.539 g cm−3, T = 293 K. Die Struktur wurde unter Verwendung der Patterson-Methode (SHELX-93[16]) gelöst, fehlende Atome durch Differenz-Fourier-Techniken bestimmt und nach der Methode der kleinsten Quadrate gegen F2 unter Verwendung des Programmpakets SHELX-93 verfeinert[16]. In der asymmetrischen Einheit befinden sich zwei Moleküle Die ungeordnete Seitenkette eines Moleküls wurde isotrop in zwei Konformationen verfeinert Für die beteiligten Atome wurden keine Wasserstoffatompositionen berechnet und verfeinert Alle anderen Nichtwasserstoffatome wurden anisotrop verfeinert. 11351 gemessene (Maximum 2ϑ = 50°), davon 10876 unabhängige Reflexe. 649 Parameter mit 4 Restraints wurden gegen 7701 Reflexe mit I > 2σ(I) verfeinert und ergaben kristallographische R-Werte von R = 0.0558 und Rw = 0.1467.
- 16 G. M. Sheldrick, Acta Crystallogr. Sect. A 1990, 46, 467–473.
Citing Literature
This is the
German version
of Angewandte Chemie.
Note for articles published since 1962:
Do not cite this version alone.
Take me to the International Edition version with citable page numbers, DOI, and citation export.
We apologize for the inconvenience.