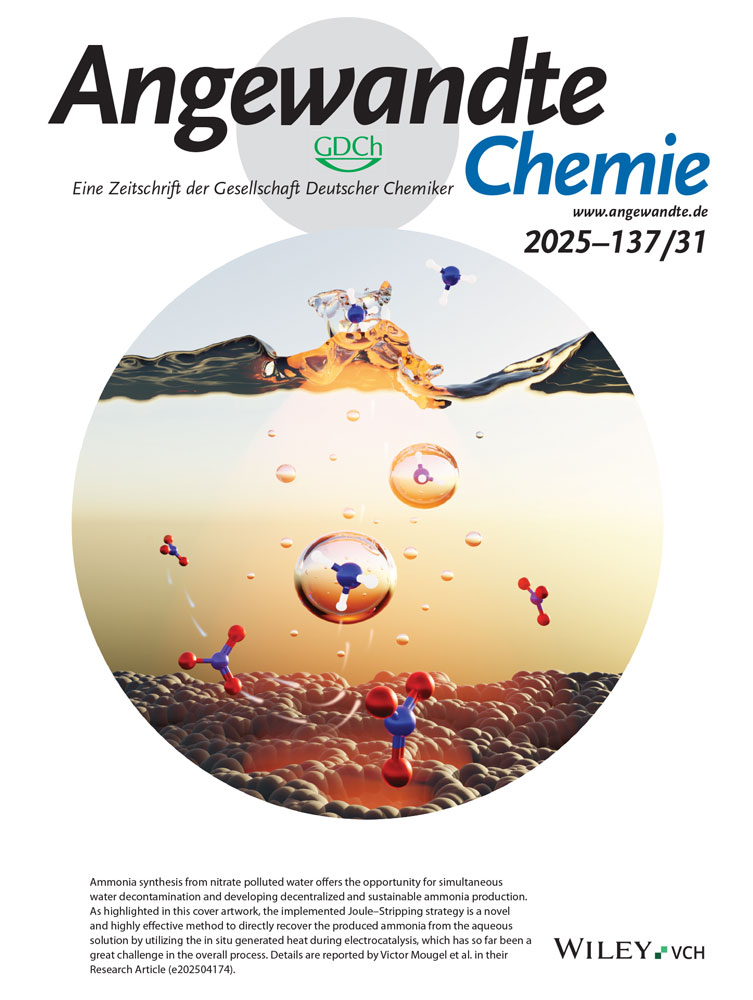Ein selbstreplizierendes System aus drei Eduktbausteinen†
Thomas Achilles Dipl.-Chem.
Institut für Organische Chemie und Biochemie der Universität Alberstraße 21, D-79104 Freiburg Telefax: Int. + 761/203-2815
Search for more papers by this authorCorresponding Author
Prof. Dr. Günter von Kiedrowski
Institut für Organische Chemie und Biochemie der Universität Alberstraße 21, D-79104 Freiburg Telefax: Int. + 761/203-2815
Institut für Organische Chemie und Biochemie der Universität Alberstraße 21, D-79104 Freiburg Telefax: Int. + 761/203-2815Search for more papers by this authorThomas Achilles Dipl.-Chem.
Institut für Organische Chemie und Biochemie der Universität Alberstraße 21, D-79104 Freiburg Telefax: Int. + 761/203-2815
Search for more papers by this authorCorresponding Author
Prof. Dr. Günter von Kiedrowski
Institut für Organische Chemie und Biochemie der Universität Alberstraße 21, D-79104 Freiburg Telefax: Int. + 761/203-2815
Institut für Organische Chemie und Biochemie der Universität Alberstraße 21, D-79104 Freiburg Telefax: Int. + 761/203-2815Search for more papers by this authorDiese Arbeit wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Fonds der Chemischen Industrie gefördert.
Abstract
Einem elektronischen Schaltplan ähnelt das Reaktionsnetzwerk, das ein selbstreplizierendes System mit einem trimeren, einem dimeren und einem monomeren Eduktbaustein beschreibt. In Gegenwart eines Carbodiimids entstehen trimere bis hexamere Desoxynucleotidderivate, die über katalytische, kreuzkatalytische und autokatalytische Matrizenwirkungen in die jeweiligen Synthesewege einkoppeln. Hauptprodukt ist ein Tetramer, das bevorzugt über einen nicht autokatalytischen Synthesekanal gebildet wird. Im autokatalytischen Reaktionskanal verhält sich dieses Produkt ausschließlich „egoistisch”︁, während das Pentamer und das Hexamer auch eine „altruistische”︁ Beziehung eingehen und darüber „vergesellschaftet”︁ werden.
References
- 1(a) Aktuelle Übersichten: L. E. Orgel, Nature 1992, 358, 203–209; (b) A. Eschenmoser, E. Loewenthal, Chem. Soc. Rev. 1992, 1–16; (c) S. Hoffmann, Angew. Chem. 1992, 104, 1032–1035; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1992, 31, 1013–1016; (d) M. Famulok, J. S. Nowick, J. Rebek, Acta Chem. Scand. 1992, 46, 315–324; (e) G. von Kiedrowski, J. Helbing, B. Wlotzka, S. Jordan, M. Matzen, T. Achilles, D. Sievers, A. Terfort, B. C. Kahrs, Nachr. Chem. Tech. Lab. 1992, 40, 578–588.
- 2 Es handelt sich hier grundsätzlich um Oligodesoxynucleotidderivate; das Präfixd für desoxy wird daher weggelassen. Abkürzungen: Me = 5′-O-Me-thyl, MTM = 5′-O-Methylthiomethyl, N3 = 5′-Azido-5′-desoxy, H2N = 5′-Amino-5′-desoxy, HO = 5′-Hydroxy, p = 3′-Phosphat, p = 3′-(2-Chlorphenyl)phosphat, pPTE = 3′-(2-Phenylthioethyl)phosphat, pn = 3′-5′-Phosphoamidat (die Sequenzen sind - sofern nicht anders angegeben - immer in der 5′→ 3′-Leserichtung aufgeführt; HPLC = Hochleistungsflüssigkeitschromatographie, RPC = Umkehrphasen-Säule.
- 3 G. von Kiedrowski, Angew. Chem. 1986, 98, 932–934; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1986, 25, 932–935.
- 4(a) Zur Theorie des Quadratwurzelgesetzes und parabolischen Wachstums siehe: G. von Kiedrowski, Bioorg. Chem. Front. 1993, 3, 113–146. (b) Interessanterweise wurde ein parabolisches Wachstum auch im Zusammenhang mit der Ausbreitung von Computerviren beschrieben: J. O. Kephart, S. R. White, Proc. 1991 IEEE Computer Soc. Symp. Res. Securacy and Privacy, IEEE Computer Society, Washington, 1991, S. 343–359.
- 5 G. von Kiedrowski, B. Wlotzka, J. Helbing, M. Matzen, S. Jordan, Angew. Chem. 1991, 103, 456–459, 1066; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1991, 30, 423–426, 892.
- 6(a) Weitere selbstreplizierende Systeme mit selbstkomplementären Templaten aus zwei Eduktbausteinen: W. S. Zielinski, L. E. Orgel, Nature 1987, 327, 346–347; (b) G. von Kiedrowski, B. Wlotzka, J. Helbing, Angew. Chem. 1989, 101, 1259–1261; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1989, 28, 1235–1237; (c) T. Tjivikua, P. Ballester, J. Rebek Jr., J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 1249–1250; (d) J. S. Nowick, Q. Feng, T. Tjivikua, P. Ballester, J. Rebek Jr., J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 8831–8839; (e) J.-I. Hong, Q. Feng, V. Rotello, J. Rebek, Science 1992, 255, 848–850; (f) Q. Feng, T. K. Park, J. Rebek, Science. 1992, 256, 1179–1180; (g) A. Terfort, G. von Kiedrowski, Angew. Chem. 1992, 104, 626–628; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1992, 31, 654–656. (h) Verwandte Beispiele: W. S. Zielinski, L. E. Orgel, J. Mol. Evol. 1989, 29, 281–283; ) K. E. Ng, L. E. Orgel, J. Mol. Evol. 1989, 29, 101–107; (j) J. T. Goodwin, D. G. Lynn, J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 9197–9198; (k) F. Persico, J. D. Wuest, J. Org. Chem. 1993, 58, 95.
- 7(a) Andere Systeme: Selbstreplizierende Micellen: P. A. Bachmann, P. Walde, P. L. Luisi, J. Lang, J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 8200–8201; (b) P. A. Bachmann, P. L. Luisi, J. Lang, Nature 1992, 357, 57–59. (c) Auf dem Wege zu selbstreplizierenden Ribozymen: J. A. Doudna, J. W. Szostak, Nature. 1989, 339, 519; (d) J. A. Doudna, J. Couture, J. W. Szostak, Science 1991, 251, 1605–1610. c) Zu selbstreplizierenden Algorithmen siehe Aufsätze in Artificial Life. The Proceedings of an Interdisciplinary Workshop on the Synthesis and Simulation of Living Systems Held September, 1987 in Los Alamos, New Mexico (Hrsg.: C. G. Langton), Addison-Wesley, Redwood City, USA, 1989; (f) J. A. Reggia, S. L. Armentrout, H.-H. Chou, Y. Peng, Science 1993, 259, 1282–1287.
- 8(a) J. Helbing, Dissertation, Göttingen. 1990; (b) T. Achilles, G. von Kiedrowski, unveröffentlicht. c) Verwendetes Kupplungsverfahren: V. A. Efimov, O. G. Chakhmakhcheva, Y. A. Ovchinnikov, Nuclic Acids Res. 1985, 13, 3651–3670.
- 9 Folgende Standardbedingungen wurden bei allen beschriebenen Reaktionen gewählt: T = 20 ° C; 0.2 M EDC; 0.1 M Mclm-pH 7.2; Eduktkonzentrationen: 2 mM.
- 10 Nucleosil C18, 4 × 250 mm; A: 0.1 M Natriumhydrogencarbonat. B: Acetonitril-Wasser 30:70 (v-v); Fluß: 1 mL min−1; Gradient (B): 18–28% in 5 min 28–42% in 2 min, 42–50% in 4 min, 50 75% in 2.5 min und 0.5 min 75%; Detektion bei λ = 254 nm.
- 11 Als Spurenprodukte bei der Umsetzung ( A + B + C) werden alle möglichen Oligomerisationsstufen der Typen Bn, ABn, BnC und ABnC angenommen ( n ≥ 1), da jeder Aminobaustein ( Bn, Bn C) prinzipiell mit jedem 3′-terminalen Phosphatbaustein ( ABn, Bn) unter Phosphoamidatverknüpfung kondensieren kann. Mit Ausnahme von ABC ließen sich höhere Kondensationsprodukte im HPLC-Profil jedoch nicht sicher identifizieren.
- 12 Das Elutionsverhalten der Nucleotidbausteine an C18 wird zum Großteil durch die terminalen Gruppen bestimmt. Verbindungen mit polaren Termini, z.B. B und BB, eluieren sofort und lassen sich daher nicht auftrennen.
- 13 AC″, AB″ und AB′″ wurden durch Festphasensynthese nach der Phosphoamiditmethode hergestellt. Die Phosphodiesterbildung zwischen 3′-Phosphaten und den terminalen OH-Gruppen dieser Matrizen ist unter den Reaktionsbedingungen vernachlässigbar, so daß die Matrizen als inert betrachtet werden können.
- 14 B. Wlotzka, Dissertation, Göttingen, 1992.
- 15(a) S. M. Freier, A. Sinclair, T. Neilson, D. H. Turner, J. Mol. Biol. 1985, 185, 645–648; (b) K. H. Breslauer, R. Frank, H. Blöcker, L. A. Marky, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1986, 83, 3746–3749.
- 16 E. Szathmáry, I. Gladkih, J. Theor, Biol. 1989, 138, 55–58.
Citing Literature
This is the
German version
of Angewandte Chemie.
Note for articles published since 1962:
Do not cite this version alone.
Take me to the International Edition version with citable page numbers, DOI, and citation export.
We apologize for the inconvenience.