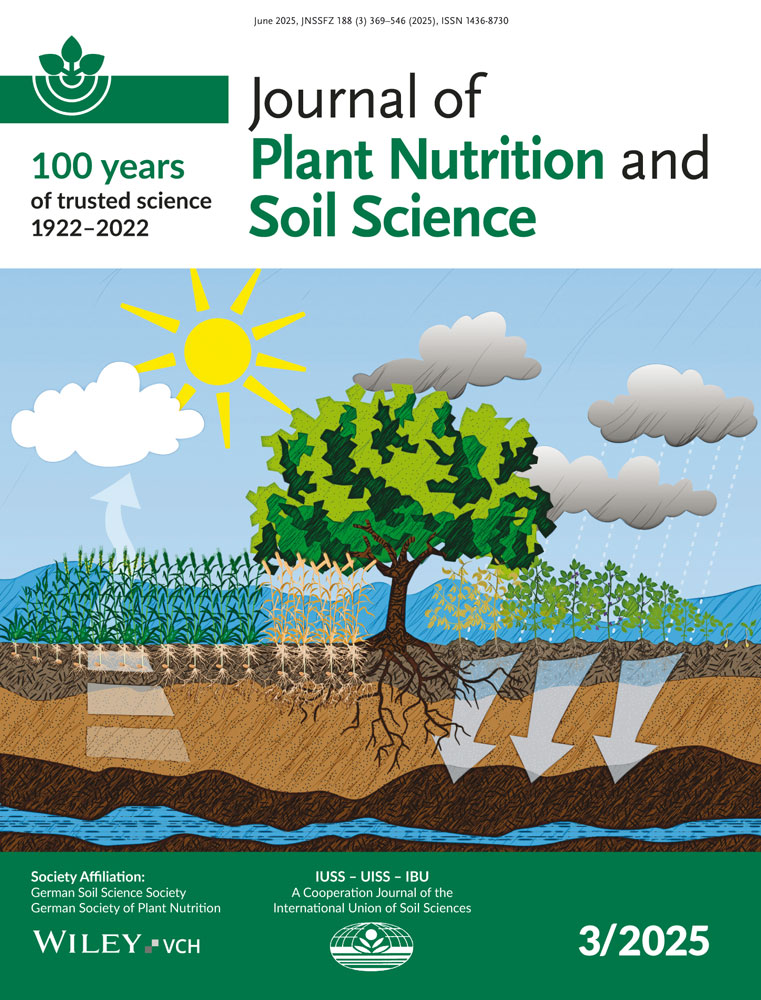Erosion processes and erodibility of cultivated soils in North Rhine-Westphalia under artificial rain. II. Results of field experiments and comparison with laboratory trials†
The article is partially based on the Ph.D. thesis by M. Kehl (1997): Experimentelle Laboruntersuchungen zur Dynamik der Wassererosion verschieden texturierter Ackerböden Nordrhein-Westfalens, and on the Ph.D. thesis by C. Everding (1998): Kennzeichnung des Erosionsverhaltens und der Erosionsanfälligkeit verschieden texturierter Ackerböden Nordrhein-Westfalens mit Hilfe von Feldberegnungen. Both: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Germany.
Abstract
enIn the densely populated state of North Rhine-Westphalia, soil erosion by water causes substantial on-site degradation and off-site damages. The implementation of soil-conservation measures is improved, if soil erodibilities and erosion processes are known. In a state-wide investigation, we aimed to representatively assess soil-erosion processes and erodibilities of cultivated soils. For this purpose, we measured surface runoff and soil-loss rates of 28 cultivated soils with field plots under artificial rain.
In the field experiments, surface runoff and soil loss indicated high sealing susceptibilities and high erodibilities on soils of quite different textures including a clay silt, a loam silt, a loam sand, a sand loam, and two standard loams. Rill formation causing high soil-loss rates was observed on a clay silt (soil BM) and on a loam silt (soil RB), the latter yielding an empirical K-factor of 1.66 t ha–1 h N–1. K-factors of other silty soils ranged from 0.04 to 0.48, whereas sandy soils and clayey soils had K-factors ranging from 0.00 to 0.32, and 0.00 to 0.12, respectively. Comparatively high erodibilities of two silt clays were due to saturation overland flow. Erosion processes and erodibilities of soils with similar texture varied to a large extent, possibly caused in part by seasonal differences in the timing of erosion tests.
Surface runoff was different in field experiments compared with laboratory experiments (companion paper) conducted with topsoil material taken from the field plots. In addition, higher concentrations of suspended sediment were recorded on average in the field than in the laboratory. These differences might reflect the influence of the subsoil and are due to higher transport capacities on longer plots in the field. Thus, laboratory experiments can complement but not replace costly field trials for K-factor determination.
Empirical K-factors derived from field and laboratory experiments are in general lower than K-factors of other soils in Germany or calculated K-factors derived from pedotransfer functions, which might be attributed to a more maritime-type climate in North Rhine-Westphalia. Since the temporal variability of erodibility was not assessed, the reported K-factors should be regarded as preliminary.
Abstract
deErosionsverhalten und Erosionsanfälligkeit von Ackerböden in Nordrhein-Westfalen unter simulierten Starkregen II. Ergebnisse von Feldberegnungen und Vergleich zu Laborexperimenten
Im dicht besiedelten Bundesland Nordrhein-Westfalen führt Bodenerosion durch Wasser zu erheblichen on- und off-site-Schäden. Die Umsetzung von Bodenschutzmaßnahmen wird verbessert, wenn die Erosionsanfälligkeit und das Erosionsverhalten der Böden bekannt sind. In einer landesweiten Untersuchung war es unser Ziel, eine repräsentative Einschätzung des Erosionsverhaltens und der Erodibilität von Ackerböden zu erhalten. Dazu wurden Oberflächenabfluss- und Bodenabtragsraten von Feldparzellen auf 28 Ackerböden unter simulierten Starkregen gemessen.
Oberflächenabfluss und Bodenabtrag spiegeln hohe Verschlämmungsneigungen und Erodibilitäten von Böden sehr unterschiedlicher Textur wider, darunter ein Tonschluff, ein Lehmschluff, ein Lehmsand, ein Sandlehm und zwei Normallehme. Rillenbildung verursachte bei einem Tonschluff (Boden BM) und einem Lehmschluff (RB) stark erhöhte Bodenabträge, die bei RB einen empirischen K-Faktor von 1,66 t ha–1 h N–1 ergaben. Die K-Faktoren der anderen schluffreichen Böden reichten von 0,04 bis 0,48, die der sandigen Böden von 0,00 bis 0,32 und die der tonreichen Böden von 0,00 bis 0,12. Die vergleichsweise hohen Erodibilitäten von zwei Schlufftonen sind auf Sättigungsabfluss zurückzuführen. Das Erosionsverhalten auch von texturell ähnlichen Böden war teilweise sehr unterschiedlich. Dies ist z. T. vermutlich durch saisonal unterschiedliche Beregnungstermine begründet.
In den Feldversuchen zeigten viele Böden ein anderes Abflussverhalten und höhere Sedimentkonzentrationen als in Laborversuchen mit Oberbodenmaterial der gleichen Standorte (Publikation Teil I). Diese Unterschiede spiegeln vermutlich den Einfluss des Unterbodens wider und sind auf die höhere Transportkapazität des Oberflächenabflusses in den Feldversuchen zurückzuführen. Zur Bestimmung von K-Faktoren können die Laborversuche daher aufwändige Feldversuche ergänzen, aber nicht ersetzen.
Die aus den Feld- und Laborexperimenten abgeleiteten K-Faktoren sind meistens deutlich niedriger als empirische K-Faktoren vergleichbarer Böden Süddeutschlands und unterschreiten auch die mittels Pedotransferfunktionen berechneten K-Faktoren. Dies kann u. a. auf das stärker ozeanisch geprägte Klima in Nordrhein-Westfalen zurückzuführen sein. Da zeitliche Schwankungen der Bodenerodierbarkeit nicht erfasst wurden, sind die ermittelten K-Faktoren als vorläufig anzusehen.