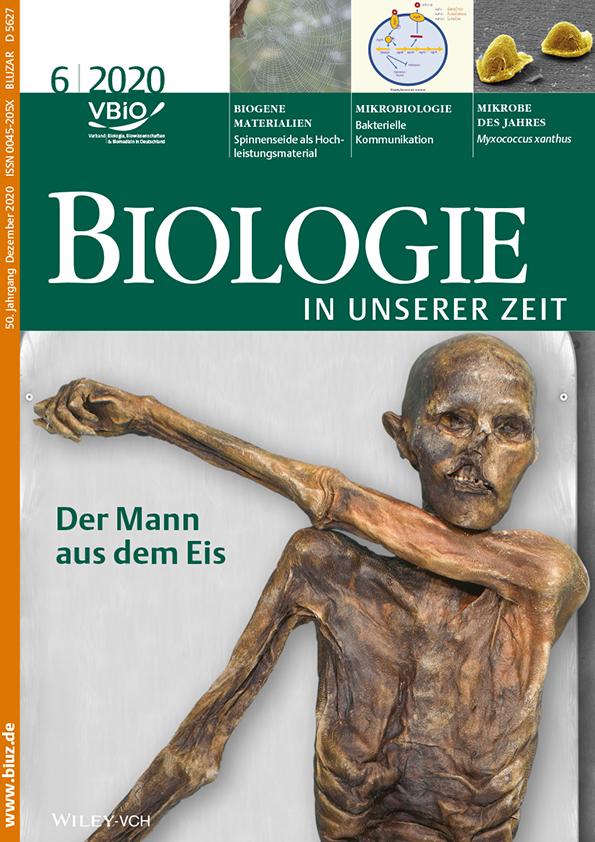Die Brückenechse im Stammbaum der Landwirbeltiere
Evolution
Abstract
Zu den heute lebenden Landwirbeltierarten gehören weltweit schätzungsweise 7.000 Amphibien, 6.000 Säugetiere, 10.000 Vögel, 10.000 Echsen und Schlangen, 350 Schildkröten, 25 Krokodile, aber nur eine einzige Art der Brückenechsen: Sphenodon punctatus, in der Sprache der Maori „Tuatara“ genannt [1]. Die aktuelle Genomsequenzierung liefert einerseits einen Einblick in die Evolution der Landwirbeltiere und andererseits in die arteigenen Besonderheiten wie Sehvermögen, Immunabwehr und Langlebigkeit dieser seltenen Tierart. Die Untersuchungen verliefen in Zusammenarbeit mit Maoris, die die Tuatara als Kulturschatz ansehen.
Als „Reptilien“ bezeichnet man traditionell die vier Ordnungen: Echsen und Schlangen (Squamata), Schildkröten (Testudinata), Krokodile (Crocodylia) und Brückenechsen (Sphenodontia). Es sind wechselwarme Landwirbeltiere mit Hornschuppen, Lungenatmung und ohne Larvenstadien. Innerhalb der Landwirbeltiere stehen sie in ihrer Evolutionsstufe zwischen den wasserabhängigen Amphibien und den gleichwarmen Vögeln und Säugetieren. In der phylogenetischen Systematik wird der Ausdruck „Reptilien“ allerdings nicht mehr verwendet, denn nur vollständige Abstammungsgruppen erhalten einen eigenen Namen. Solche monophyletischen Taxa umfassen alle Arten, die sich auf eine einzige Ursprungsart im Stammbaum zurückführen lassen, also von demselben Verzweigungsknoten ausgehen. Die heutigen „Reptilien“ bilden allenfalls zusammen mit ihren ausgestorbenen Sauriervorfahren und allen Nachkommen, also Vögeln und Säugetieren, eine monophyletische Gruppe. Arten aus diesem Taxon nennt man Amniontiere (Amniota). Die Amnioten teilten sich vor über 300 Millionen Jahren in die Zweige Synapsida und Sauropsida. Aus den überwiegend ausgestorbenen Synapsiden gingen die Säugetiere hervor, aus den Sauropsiden die Vögel, Squamaten, Schildkröten, Krokodile und Brückenechsen. Vor 250 bis 145 Millionen Jahren, also etwa zeitgleich mit den Dinosauriern, waren Brückenechsen auf dem alten Superkontinent Gondwana weit verbreitet, vor 30 Millionen Jahren verschwanden sie. Nur eine einzige Art überlebte: Sphenodon punctatus (Tuatara). In Neuseeland leben die letzten etwa 100.000 Individuen, verteilt auf 32 Inseln und kleinere Schutzgebiete.

Die Brückenechse (Sphenodon punctatus) im „Zealandia“ (Wildlife Sanctuary), Wellington, Neuseeland.
Phylogenetische Einordnung der Tuatara
Zur phylogenetischen Einordnung der fossilen und rezenten Sauropsidenarten dient vor allem der knöcherne Schädel. Als ursprüngliche Form wird eine geschlossene Schädelkapsel angesehen, im Laufe der Evolution entstanden Schläfenfenster, die erweitert oder wieder reduziert wurden. Solche paarigen Löcher im knöchernen Schädel schaffen Platz und Ansatzfläche für die Kaumuskulatur, wodurch diese von der Schädelinnenseite auf die Außenseite verlagert werden konnte. Brückenechsen, Krokodile (und Dinosaurier) haben zwei Paar Schläfenfenster, Eidechsen und Schlangen höchstens eins, Schildkröten keine. Brückenechsen bilden wegen ihres besonderen Schädelbaus mit zwei Paar Schläfenfenstern und einer doppelten Zahnreihe im Oberkiefer eine eigene Wirbeltierordnung. Ein Genomvergleich bestätigt jetzt die Sonderstellung der Tuatara [2, 3]. Das Tuatara-Genom gehört mit 5 Gb (5 Milliarden Basenpaaren) zu den größten Genomen innerhalb der Wirbeltiere (Mensch 3 Gb). Das ist auf unzählige Wiederholungssequenzen zurückzuführen, die überwiegend an Sequenzen bei Säugetieren erinnern. Etwa die Hälfte davon sind Transposons, also springende Gene. Extrem viele Genombereiche sind methyliert und damit inaktiviert. 17.500 Gene lassen sich abgrenzen, davon sind 75 Prozent konserviert auch bei Vögeln, Schildkröten und Krokodilen zu finden. Brückentiere und Squamata (Echsen und Schlangen) bilden eine monophyletische Gruppe, genannt Schuppenechsen oder Lepidosauria. Vor etwa 250 Millionen Jahren trennte sich die Linie der Brückenechsen von den Squamaten. In genetischer Hinsicht sind Brückentiere lebende Fossilien, ihre Evolutionsrate ist nicht besonders schnell, wie vielfach diskutiert, sondern besonders langsam [2].
Arteigene Merkmale der Tuatara
Eigentlich sieht eine Tuatara gar nicht so spektakulär aus, wie die besondere Stellung im Stammbaum vermuten ließe. Es ist eine typische Echse, bis zu 80 cm lang und 1,3 kg schwer, mit einem Zackensaum auf dem Rücken und schnabelartig vorspringender Schnauze. Der Schwanz kann regeneriert werden. Tuatara bewegen sich langsam und jagen nachts nach Kleintieren. Nur die Jungtiere sind tagaktiv und entgehen, versteckt in Bäumen, dem räuberischen Zugriff der Alttiere. Das große Augenpaar weist in der Netzhaut mindestens drei verschiedene Lichtsinneszelltypen auf [4]. Alle fünf bei Wirbeltieren bekannten Opsingene lassen sich nachweisen [2]. Außerdem haben Tuatara ein drittes Auge auf der Schädeloberseite. Solche Scheitelaugen waren bei ursprünglichen Wirbeltieren verbreitet, sie ermöglichen eine sehr gute Hell-Dunkel-Sicht und sind vielleicht auch an der Wärmeregulation beteiligt. Ein Scheitelauge besteht aus Linse, Netzhaut und Sehnerv und ist über eine Lücke zwischen den paarigen Scheitelbeinknochen mit dem Zwischenhirn verbunden. Das Licht fällt durch eine transparente Schuppe unter die Haut. Die sehr gute Sehfähigkeit der Tuatara entscheidet über ihren Jagderfolg: Versuche zeigen, dass Gehör und Geruchssinn bei vollständiger Dunkelheit nicht ausreichen, um Beute zu machen [5]. Ihr Geruchssinn ist schwächer als bei Krokodilen und Schildkröten. Die Anzahl der Geruchsrezeptoren ist wie bei den Vögeln nicht sehr groß. Ein Vergleich entsprechender Gensequenzen mit denen anderer Wirbeltiere zeigt zwar erstaunlich viele intakte Geruchsrezeptorgene, diese sind aber durch Methylierungen inaktiviert [2], [3].
Tuatara mögen es vergleichsweise kalt (Optimum 16–21 °C) und regulieren die Körperwärme durch entsprechendes Verhalten. Das passt zu dem großen Genrepertoire für TRP-Ionenkanäle (transient receptor potential channels), die mit der Temperaturwahrnehmung und dem Blutgefäßstoffwechsel in Verbindung gebracht werden. Die Geschlechtsbestimmung ist temperaturabhängig, Weibchen entwickeln sich bei Temperaturen unter 22 °C, Männchen bei über 22 °C, es gibt keine unterscheidbaren Geschlechtschromosomen oder Gene. Die MHC-Gene (histocompatibility complex) des Immunsystems haben weniger mit denen von Vögeln als von Amphibien und Säugetieren gemeinsam. Tuatara werden uralt, in Gefangenschaft über 100 Jahre. Das könnte in Zusammenhang mit zahlreichen DNA-Sequenzen des Selenstoffwechsel stehen. Selen gilt als Schutz gegen „Sauerstoffradikale“ in den Zellen.
Schutzstatus der Tuatara
Für viele Maori, insbesondere die Ngãtiwai und Ngãti, sind Tuatara ein „taonga“, also ein Kulturschatz, der behütet werden muss. Sie haben die Besonderheit dieser Art schon seit Generationen erkannt. Laut IUCN (Internationale Union für Naturschutz) gilt die Tuatara als vom Aussterben bedrohte Tierart. Das liegt nicht nur an ihrem geografisch begrenzten Vorkommen, sondern auch an Lebensraumverlust, globaler Erwärmung, Prädation und Krankheiten. Die einzelnen Populationen haben nur eine geringe genetische Diversität, zeigen aber auf jeder Insel kleine genetische Besonderheiten, die sich gut mit der Inselentstehung und mit neuen oder verschwundenen Landbrücken in Einklang bringen lassen. Die Population auf North Brother Island bildet anders als zeitweise vermutet genetisch keine eigene Art. Ihr separater Schutzstatus ist aber wegen einer starken Inzuchtgefahr berechtigt. Für den Schutz und die Forschung an dieser im Wortsinne „einmaligen“ Art ist die Zusammenarbeit mit der indigenen Bevölkerung bemerkenswert.