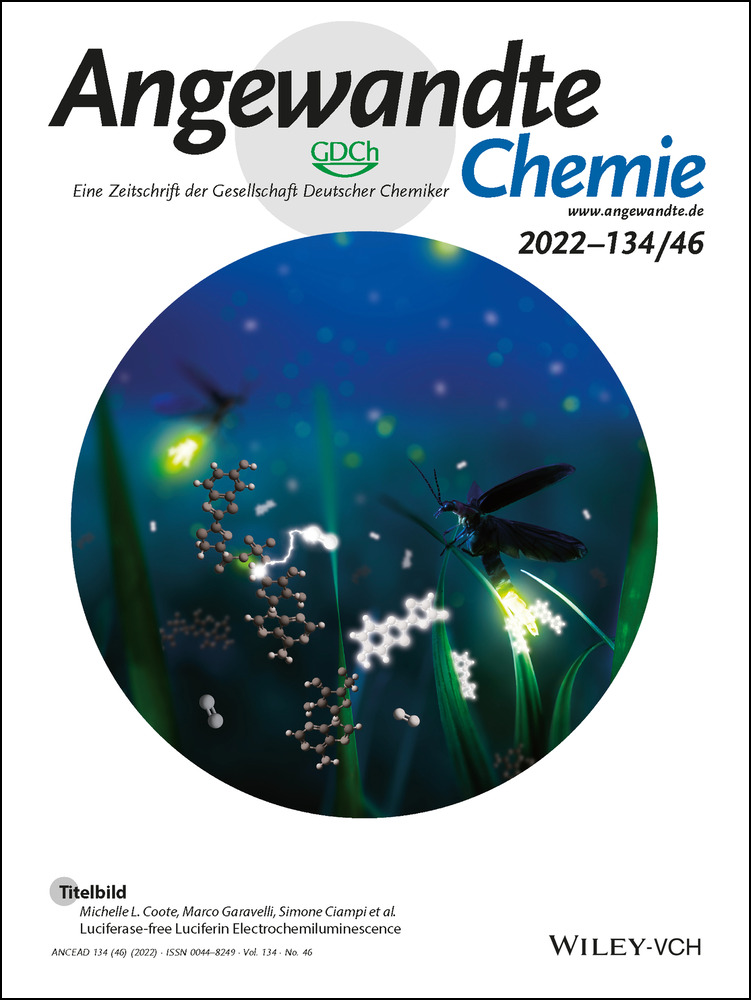Ionenadsorption und -desorption an der CaF2-Wasser-Grenzfläche untersucht mit Flussexperimenten und Schwingungsspektroskopie
Abstract
Die Auflösung von Mineralien in Kontakt mit Wasser spielt eine entscheidende Rolle in der Geochemie. Einblicke in die Grenzflächenchemie auf molekularer Ebene zu erhalten, gestaltet sich jedoch schwierig. Beim Auflösen werden typischerweise Ionen an der Oberfläche freigesetzt, die eine geladene Mineraloberfläche entstehen lassen. Diese Ladung beeinflusst die Ausrichtung der Wassermoleküle an der Grenzfläche, was mittels oberflächenspezifischer Schwingungsspektroskopie auf Basis der Summenfrequenzerzeugung (v-SFG-Spektroskopie) untersucht werden kann. Die aktuellsten spektroskopischen Untersuchungen lassen darauf schließen, dass bei der Fluorit-Wasser-Grenzfläche die Adsorption und Desorption von Fluoridionen die Oberflächenladung bestimmt. Dies steht im Gegensatz zu älteren Zeta-Potential-Messungen, welche diese Rolle den Calciumionen zuschrieben. Durch Kombination von v-SFG-Spektroskopie und Flussexperimenten mit systematisch unterdrückter Ionenfreisetzung wird das Zusammenspiel von dominanter Fluorid und schwacher Calciumionen Adsorption/Desorption entdeckt und löst somit die Kontroverse in der Literatur. Hierbei konnten wir abschätzen, dass der Beitrag von Calcium um Größenordnungen geringer ist, was die Empfindlichkeit unseres Ansatzes unterstreicht.
Einleitung
 für die feste Subphase.
für die feste Subphase.
 (1)
(1) (2)
(2)Da in beide Reaktionen das Fluoridanion vorkommt, sind Oberflächenladung und Auflösung gekoppelt. Eine allgemeinere Interpretation der Kopplung zwischen Oberflächenladung und Auflösung könnte die Desorption von Fluorid aus Gleichung (2) als Schritt innerhalb des gesamten Auflösungsprozesses sein. Wenn dies der Fall ist, muss ein weiterer Schritt innerhalb der Auflösung die Desorption von Calcium sein. In diesem Szenario würde das Zusammenspiel von Fluorid- und Calciumdesorption die Oberflächenladung bestimmen. Diese Überlegung sowie die Kontroverse in der Literatur zwischen Zetapotenzialmessungen und spektroskopischen Untersuchungen wirft die Frage auf, ob die Beiträge von Fluorid- und Calciumionen zur Oberflächenladung entflochten werden können und welches Ion letztendlich das Potenzial bestimmt.
Da die Adsorptions-/Desorptionsreaktionen von Ionen die Oberflächenladung verändern, können diese Reaktionen mit nichtlinearer optischer Spektroskopie untersucht werden. Insbesondere die Schwingungs-Summenfrequenz-Spektroskopie (v-SFG-Spektroskopie) ist eine etablierte Methode zur Untersuchung solcher geladenen Mineral-Wasser-Grenzflächen. Bei der v-SFG-Spektroskopie werden sichtbare (Vis) und infrarote (IR) Laserpulse an der zu untersuchenden Grenzfläche räumlich und zeitlich überlagert, wobei Licht mit der Summe der beiden einfallenden Frequenzen (SFG) entsteht. Dieser nichtlineare optische Prozess ist in zentrosymmetrischen Medien, wie z. B. Volumenwasser, nicht möglich. Jedoch ist die Symmetrie an der Mineral-Wasser-Grenzfläche gebrochen und SFG Strahlung wird erzeugt. Die Resonanzverstärkung durch die Anpassung eines breitbandigen IR-Pulses auf den OH-Streckschwingungsfrequenzbereich des Wassers kann die Empfindlichkeit der Spektroskopie auf die Wassermoleküle nahe der Grenzfläche beschränken.18, 19 Die Größe der detektierten Intensität korreliert mit der Nettoorientierung der Wassermoleküle an der Grenzfläche und der Polarisation der Wassermoleküle aufgrund von Grenzflächenfeldern. Beide Beiträge skalieren mit der Oberflächenladung des Minerals, welche die Wassermoleküle aufgrund elektrostatischer Wechselwirkungen zwischen den Wassermolekülen und dem elektrischen Feld, das durch die Oberflächenladung entsteht, ausrichtet und polarisiert. Die ermittelte Intensität kann daher zur Untersuchung von Oberflächenladungen und -potenzialen, sowie der Wechselwirkung von Ionen und Wassermolekülen an einer geladenen Oberfläche auf molekularer Ebene verwendet werden.4, 19-29
 mit dem Oberflächenpotenzial
mit dem Oberflächenpotenzial  durch Gleichung 3 verbunden.21, 30
durch Gleichung 3 verbunden.21, 30
 (3)
(3) und
und  die nichtlineare Suszeptibilität zweiter und dritter Ordnung. Das Oberflächenpotenzial hängt von der Oberflächenladung und der Ionenstärke der wässrigen Lösung ab, welche die Oberflächenladung abschirmt und damit die Polarisationstiefe begrenzt. Diese Abschirmung kann durch das Gouy-Chapman-Modell beschrieben werden, welches zu Gleichung (4) für das Oberflächenpotenzial führt.21, 29-31
die nichtlineare Suszeptibilität zweiter und dritter Ordnung. Das Oberflächenpotenzial hängt von der Oberflächenladung und der Ionenstärke der wässrigen Lösung ab, welche die Oberflächenladung abschirmt und damit die Polarisationstiefe begrenzt. Diese Abschirmung kann durch das Gouy-Chapman-Modell beschrieben werden, welches zu Gleichung (4) für das Oberflächenpotenzial führt.21, 29-31 (4)
(4)Hierbei ist  die Boltzmann-Konstante,
die Boltzmann-Konstante,  die Temperatur, e die Elementarladung,
die Temperatur, e die Elementarladung,  die Oberflächenladungsdichte,
die Oberflächenladungsdichte,  die Avogadro-Konstante,
die Avogadro-Konstante,  die Ionenstärke,
die Ionenstärke,  die elektrische Permittivität des Vakuums und
die elektrische Permittivität des Vakuums und  die relative Permittivität des vorliegenden Mediums (hier Wasser),
die relative Permittivität des vorliegenden Mediums (hier Wasser),  die Ladung des Ions
die Ladung des Ions  , und
, und  die Konzentration dieses Ions im Volumen.
die Konzentration dieses Ions im Volumen.
Die Empfindlichkeit der v-SFG-Intensität gegenüber Ionenkonzentrationen bietet die Möglichkeit, Auflösungsprozesse zu untersuchen: Die Anhäufung von Ionen in der Nähe der Grenzfläche aufgrund von Auflösungsprozessen, wenn die wässrige Phase in Ruhe ist, und die Konzentrationsabnahme aufgrund von Verdünnung bei Fluss wirken sich nachweislich drastisch auf das Oberflächenpotenzial und damit auf die v-SFG-Intensität aus.15, 16, 20 Solche Konzentrationsänderungen können die Abschirmung der Oberflächenladung, sowie die Oberflächenladung selbst aufgrund der Adsorptions-/Desorptionsgleichgewichte von Ionen beeinflussen. Da eine flussinduzierte Verdünnung die Konzentration der adsorbierenden/desorbierenden Ionen und die Menge der Adsorption/Desorption verringert, kann sich die Oberflächenladung ändern. Für die Fluorit-Wasser-Grenzfläche wurde eine flussbedingte Zunahme der positiven Oberflächenladung durch eine Verdünnung der gelösten Fluoridanionen und damit einer verringerten Adsorption erklärt.15-17 In dieser Arbeit kombinieren wir v-SFG-Spektroskopie und Flussexperimente, um zusätzliche molekulare Einblicke in die Oberflächenchemie an der geladenen Fluorit-Wasser-Grenzfläche zu gewinnen. Die durch v-SFG-Spektroskopie erhaltene Intensität wird als indirektes Maß für die Oberflächenladung genutzt. Durch die systematische Unterdrückung von Auflösung und flussinduzierten Konzentrationsänderungen wird das komplexe Zusammenspiel von Fluorid- und Calciumadsorption/-desorption aufgeklärt.
Ergebnisse und Diskussion
Experimente mit und ohne Fluss wurden an der Fluorit-Wasser-Grenzfläche unter sauren Bedingungen (1 mM HCl) durchgeführt und dabei systematisch die Fluoridkonzentration durch Zugabe verschiedener Mengen Natriumfluorid zur Salzsäurelösung variiert. Die Adsorption/Desorption von Fluorid wurde unter sauren Bedingungen mit der Oberflächenladung in Verbindung gebracht.9, 12, 15, 16 Um jedoch festzustellen, bei welchen Konzentrationen zugesetztes NaF den Einfluss der Fluoridadsorption/-desorption unterdrücken könnte, wurde zunächst die v-SFG-Intensität als Funktion des zugesetzten Natriumfluorids unter statischen Bedingungen (ohne Fluss) untersucht. Um zusätzliche Einblicke in die Abhängigkeit der Oberflächenladung von den Grenzflächenkonzentrationen von Fluorid und möglicherweise Calcium zu gewinnen, wurde ebenfalls untersucht, wie die flussinduzierte Verdünnung der gelösten Ionen die v-SFG-Intensität beeinflusst.
Abbildung 1a zeigt eine Auswahl von v-SFG-Spektren für verschiedene Mengen an zugesetztem Natriumfluorid unter statischen Bedingungen. Es wird deutlich, dass eine Erhöhung der Fluoridkonzentration die v-SFG-Intensität drastisch verringert. Um diesen Rückgang zu quantifizieren, ist in Abbildung 1b das Integral der Spektren von 2800 bis 3600 cm−1 als Funktion gegen die zugesetzte Menge Natriumfluorid aufgetragen. Daraus ist zu erkennen, dass die v-SFG-Intensität mit der Fluoridzugabe monoton abnimmt. Diese Abnahme ist bei niedrigeren Fluoridkonzentrationen steiler, ≈20 % zwischen 1 und 10 μM im Vergleich zu ≈5 % zwischen 1 und 3 mM. Tatsächlich scheint die Intensität im minimolaren Fluoridkonzentrationen abzuflachen. Bei der höchsten NaF-Konzentration beträgt die Intensität nur ≈15 % der Intensität ohne Fluoridzusatz (reine 1 mM HCl-Lösung). Gemäß den Gleichungen (3) und (4) kann eine solche Abnahme der v-SFG-Intensität, die auf ein verringertes Oberflächenpotenzial hinweist, zwei mögliche Ursachen haben: eine Zunahme der Ionenstärke und/oder eine verringerte Oberflächenladung. In den Experimenten erhöht die Zugabe von Natriumfluorid die Salzkonzentration und damit die Ionenstärke, erhöht aber auch die Fluoridadsorption, wodurch die Oberflächenladung gemäß Gleichung (2) sinkt.

Fluoridabhängige SFG-Experimente unter statischen Bedingungen. a) v-SFG-Spektren der Fluorit-Wasser-Grenzfläche mit zunehmender Fluoridkonzentration. b) Abhängigkeit der v-SFG-Intensität von der Menge des zugesetzten Natriumfluorids. Die experimentellen Werte (gefüllte schwarze Kreise) ergeben sich aus der Integration der v-SFG-Spektren zwischen 2800 und 3600 cm−1. Die Integrale, die den Spektren aus Abbildung 1a entsprechen, sind durch einen farbigen Kreis gekennzeichnet, dessen Farbe der Farbe des Spektrums in a entspricht. Die Datenpunkte sind auf die reine Salzsäurelösung normiert, d. h. ohne Fluoridzusatz. Die Fehlerbalken ergeben sich aus mehreren Messungen. Die Illustration zeigt die abnehmende Oberflächenladung als Hauptursache für die verringerte Nettoorientierung der Wassermoleküle an der Grenzfläche, die zu einer abnehmenden v-SFG-Intensität führt. Die durchgezogene graue Linie basiert auf dem im Text beschriebenen Modell.
 und von Calcium
und von Calcium  unter statischen Bedingungen sowie die Ionenstärke als Funktion gegen die zugesetzte Menge Natriumfluorid berechnet. Diese Konzentrationen beruhen auf der Annahme eines gesättigten Flusskanals. Das bedeutet, dass sich CaF2 von der Grenzfläche löst und in den Flusskanal diffundiert, bis das Löslichkeitsprodukt
unter statischen Bedingungen sowie die Ionenstärke als Funktion gegen die zugesetzte Menge Natriumfluorid berechnet. Diese Konzentrationen beruhen auf der Annahme eines gesättigten Flusskanals. Das bedeutet, dass sich CaF2 von der Grenzfläche löst und in den Flusskanal diffundiert, bis das Löslichkeitsprodukt  gemäß Gleichung 5 erreicht ist:
gemäß Gleichung 5 erreicht ist:
 (5)
(5)
Abschätzung von Grenzflächenkonzentrationen und flussinduzierten Veränderungen. a) Statische Konzentration (kein Fluss) von Fluoridanionen und Calciumkationen in Abhängigkeit von zugesetztem Natriumfluorid unter der Annahme eines gesättigten Flusskanals durch Auflösung von Fluorit. b) Ionenstärke unter statischen (kein Fluss, grau) und unter verdünnten Flussbedingungen (schwarz) als Funktion des zugegebenen Natriumfluorids unter der Annahme eines gesättigten Flusskanals durch Auflösung von Fluorit unter statischen Bedingungen und 35 % Verdünnung mit der Lösung aus dem Reservoir bei Fluss. c) Unterschiede zwischen den Konzentrationen von Fluoridanionen und Calciumkationen bei gesättigtem Fluss-Aus und verdünntem Fluss-An Bedingungen als Funktion des zugesetzten Natriumfluorids  . d) Verhältnis der relativen flussinduzierten Änderungen der Calcium- und Fluoridkonzentration als Funktion des zugesetzten Natriumfluorids.
. d) Verhältnis der relativen flussinduzierten Änderungen der Calcium- und Fluoridkonzentration als Funktion des zugesetzten Natriumfluorids.
wobei  für die Konzentration des gelösten Fluorits steht. Das System wurde mit
für die Konzentration des gelösten Fluorits steht. Das System wurde mit  =3.45×10−2 mol3 m−9 modelliert. Es wird angenommen, dass die Konzentrationen des Volumens im Reservoir aufgrund der Zeitskala des Experiments (≈1 h) und des um zwei Größenordnungen geringeren Volumens der flüssigen Phase im Flusskanal im Vergleich zum Reservoir von der Diffusion und Advektion der gelösten Ionen unbeeinflusst bleiben. Zusätzlich wird angenommen, dass die Calciumkonzentration in der Lösung gleich Null ist. Aus Abbildung 2a ist ersichtlich, dass die Auflösung und damit die Konzentration des gelösten Calciums mit der Zugabe von Fluorid abnimmt. Da wir von einem gesättigten Flusskanal ausgehen und alle Lösungen 1 mM HCl enthalten, liegt die Ionenstärke bereits im mM-Bereich, ohne dass der Lösung Natriumfluorid zugesetzt wird. Daher ist der Anstieg der Ionenstärke durch die Zugabe von NaF gering, wie es aus Abbildung 2b ersichtlich ist. Zu beachten ist, dass auch der geringe Effekt der HF-Bildung berücksichtigt wurde, welcher in den Hintergrundinformationen, Absatz S1.1 beschrieben wird. Die HF-Bildung führt zu geringen Unterschieden zwischen den nominell zugegebenen Konzentrationen von zugesetztem NaF und der Fluoridkonzentration der Lösung.
=3.45×10−2 mol3 m−9 modelliert. Es wird angenommen, dass die Konzentrationen des Volumens im Reservoir aufgrund der Zeitskala des Experiments (≈1 h) und des um zwei Größenordnungen geringeren Volumens der flüssigen Phase im Flusskanal im Vergleich zum Reservoir von der Diffusion und Advektion der gelösten Ionen unbeeinflusst bleiben. Zusätzlich wird angenommen, dass die Calciumkonzentration in der Lösung gleich Null ist. Aus Abbildung 2a ist ersichtlich, dass die Auflösung und damit die Konzentration des gelösten Calciums mit der Zugabe von Fluorid abnimmt. Da wir von einem gesättigten Flusskanal ausgehen und alle Lösungen 1 mM HCl enthalten, liegt die Ionenstärke bereits im mM-Bereich, ohne dass der Lösung Natriumfluorid zugesetzt wird. Daher ist der Anstieg der Ionenstärke durch die Zugabe von NaF gering, wie es aus Abbildung 2b ersichtlich ist. Zu beachten ist, dass auch der geringe Effekt der HF-Bildung berücksichtigt wurde, welcher in den Hintergrundinformationen, Absatz S1.1 beschrieben wird. Die HF-Bildung führt zu geringen Unterschieden zwischen den nominell zugegebenen Konzentrationen von zugesetztem NaF und der Fluoridkonzentration der Lösung.
Wird insbesondere der Bereich bis 0.1 mM zugesetztem Natriumfluorid betrachtet, fällt die v-SFG-Intensität zwar drastisch ab, die Ionenstärke (graue Linie in Abbildung 2b) steigt jedoch kaum an. Aus diesem Grund dominiert, zumindest bei geringen Mengen an zugesetztem Natriumfluorid, die Abnahme der Oberflächenladung aufgrund der Fluoridadsorption als Erklärung unserer Beobachtungen. Der Zusammenhang zwischen Oberflächenladung und Fluoridkonzentration lässt sich mit Gleichung (2) erklären. Bei höheren Fluoridkonzentrationen verschiebt sich das Adsorptions-/Desorptionsgleichgewicht auf die linke Seite (Adsorption), was zu einer geringeren Oberflächenladungsdichte führt. Folglich steht die dargestellte Abhängigkeit der v-SFG-Intensität von der Fluoridkonzentration im Einklang mit früheren spektroskopischen Studien und deren Schlussfolgerung, dass die Adsorption/Desorption von Fluoridanionen die Oberflächenladung und das Potenzial beeinflusst.9, 15-17
Bisher können die spektroskopischen Beobachtungen zumindest qualitativ durch Fluoridadsorption erklärt werden. Um diese Erklärung mit zusätzlichen Experimenten zu überprüfen, untersuchten wir auch, wie sich die flussbedingte Änderung der Konzentration der gelösten Ionen auf die v-SFG-Intensität in Abhängigkeit von der zugegebenen Menge an NaF auswirkt. Eine Auswahl der v-SFG-Intensitäten während eines Fluss-An/Aus-Zyklus für bestimmte Natriumfluoridkonzentrationen des Volumens ist in Abbildung 3a dargestellt, wobei jeder offene Kreis ein integriertes Spektrum darstellt. Es wird deutlich, dass das Vorhandensein des Flusses die v-SFG-Intensität verändern kann. Während die v-SFG-Intensität bei niedrigen Fluoridkonzentrationen (z. B. bei reiner Salzsäurelösung, rote Linie in Abbildung 3a) durch den Fluss zunimmt, bleibt die Intensität bei hohen Fluoridkonzentrationen konstant (siehe bei Zugabe von 3 mM NaF, blaue Linie in Abbildung 3a). Diese Beobachtungen wurden bereits in früheren Studien15-17 gemacht und können auf flussinduzierte Veränderungen der oberflächennahen Konzentration von Fluoridionen aufgrund der Verdünnung mit der frischen Lösung bei Fluss zurückgeführt werden. Bei niedrigen Fluorid-Volumenkonzentrationen verschiebt sich das chemische Gleichgewicht der Adsorptions-/Desorptionsreaktion aus Gleichung (2) aufgrund der höheren Oberflächenladung zur rechten Seite, da die Fluoridkonzentration bei flussinduzierter Verdünnung abnimmt. Im Gegensatz dazu ist bei hohen Fluoridkonzentrationen die Konzentrationsänderung bei Fluss gering. Folglich ändert sich die Oberflächenladung bei 3 mM zugesetztem NaF durch den Fluss nicht wesentlich. Interessanterweise ist bei mittleren Fluoridkonzentrationen (etwa 1 mM zugesetztes Natriumfluorid, grüne Linie in Abbildung 3a) zu beobachten, dass die v-SFG-Intensität bei Fluss abnimmt. Um die durch den Fluss herbeigeführten Veränderungen zu quantifizieren, wird der Durchschnitt der Intensitäten von ≈1 Minute vor dem Wechsel von Fluss-Aus zu Fluss-An und umgekehrt ( and
and  ) gebildet, und der relative Anstieg
) gebildet, und der relative Anstieg  als Funktion in Abhängigkeit der zugesetzten Menge an NaF in Abbildung 3b dargestellt. Aus diesem Diagramm geht hervor, dass die flussinduzierte Abnahme der v-SFG-Intensität eine signifikante und reproduzierbare Beobachtung für einen Konzentrationsbereich um 1 mM zugegebenes NaF darstellt.
als Funktion in Abhängigkeit der zugesetzten Menge an NaF in Abbildung 3b dargestellt. Aus diesem Diagramm geht hervor, dass die flussinduzierte Abnahme der v-SFG-Intensität eine signifikante und reproduzierbare Beobachtung für einen Konzentrationsbereich um 1 mM zugegebenes NaF darstellt.

Fluoridabhängige SFG-Experimente unter Fluss-An-Bedingungen. a) Entwicklung der v-SFG-Intensität während eines Fluss-An/Aus-Zyklus. Der graue Bereich hebt den Flussbereich mit einer Flussrate von 6 mL⋅min−1 hervor, was einer Reynoldszahl von ≈25 entspricht. Jeder offene schwarze Kreis stellt ein integriertes v-SFG-Spektrum dar. Die farbigen durchgezogenen Linien sind gleitende Zehn-Punkt-Mittelwerte zur Orientierung, wobei die gleiche Farbe wird verwendet, um die entsprechenden Daten in Abbildung 1 die Menge zugesetzten Natriumfluorids zuzuordnen. Die v-SFG-Intensitäten unter Fluss-Aus-Bedingungen sind wie in Abbildung 1a normiert. In der oberen Kurve ist die Höhe der v-SFG-Intensität unter Fluss-An-Bedingungen durch Pfeile mit  und
und  gekennzeichnet. Quantitativ sind die Werte über ≈1 Minute vor dem Wechsel zwischen Fluss-An/Aus gemittelt. b) Auftragung der flussinduzierten relativen Änderung der v-SFG-Intensität
gekennzeichnet. Quantitativ sind die Werte über ≈1 Minute vor dem Wechsel zwischen Fluss-An/Aus gemittelt. b) Auftragung der flussinduzierten relativen Änderung der v-SFG-Intensität  als Funktion gegen der zugesetzten Natriumfluoridmenge. Die gefüllten Kreise stellen die experimentellen Werte dar, die aus den Flusszyklen gewonnen wurden. Die Fehlerbalken ergeben sich aus mehreren an verschiedenen Tagen aufgezeichneten Fluss-An/Aus-Zyklen. Die relativen Veränderungen, die den Intensitätsentwicklungen aus Abbildung 3a entsprechen, sind durch entsprechende farbige Kreise gekennzeichnet. Die durchgezogene graue Linie resultiert aus dem im Text beschriebenen Modell. c) Wie a), aber Vergleich der Abwesenheit und Anwesenheit von 10 μM zugesetztem Calciumchlorid mit einer 1 mM Natriumfluorid- und 1 mM HCl-Lösung, die für das Fluss-Experiment verwendet wurde.
als Funktion gegen der zugesetzten Natriumfluoridmenge. Die gefüllten Kreise stellen die experimentellen Werte dar, die aus den Flusszyklen gewonnen wurden. Die Fehlerbalken ergeben sich aus mehreren an verschiedenen Tagen aufgezeichneten Fluss-An/Aus-Zyklen. Die relativen Veränderungen, die den Intensitätsentwicklungen aus Abbildung 3a entsprechen, sind durch entsprechende farbige Kreise gekennzeichnet. Die durchgezogene graue Linie resultiert aus dem im Text beschriebenen Modell. c) Wie a), aber Vergleich der Abwesenheit und Anwesenheit von 10 μM zugesetztem Calciumchlorid mit einer 1 mM Natriumfluorid- und 1 mM HCl-Lösung, die für das Fluss-Experiment verwendet wurde.
 zwischen der Konzentration bei ohne Fluss
zwischen der Konzentration bei ohne Fluss  und der Volumenkonzentration im Reservoir liegen. Die Verdünnung unter Flussbedingungen wird durch eine effektive Verdünnung
und der Volumenkonzentration im Reservoir liegen. Die Verdünnung unter Flussbedingungen wird durch eine effektive Verdünnung  gemäß Gleichung (6) berücksichtigt.
gemäß Gleichung (6) berücksichtigt.
 (6)
(6)In Anlehnung an numerische Simulationen eines vergleichbaren Flusskanals setzen wir  .16 Die Konzentrationsunterschiede
.16 Die Konzentrationsunterschiede  zwischen
zwischen  und
und  für Calcium- und Fluoridionen sind in Abbildung 2c als flussinduzierte Konzentrationsänderungen in Abhängigkeit des zugesetzten Natriumfluorids dargestellt.
für Calcium- und Fluoridionen sind in Abbildung 2c als flussinduzierte Konzentrationsänderungen in Abhängigkeit des zugesetzten Natriumfluorids dargestellt.
 von Calciumionen zu denen der Fluoridionen in Beziehung gesetzt wird. Da dieser Wert mit der hinzugefügten Natriumfluoridmenge ansteigt, wird die Verringerung der Calciumionenkonzentration unter Flussbedingungen mit zunehmender Fluoridkonzentration immer relevanter. Um zu verstehen, wie sich dieses Zusammenspiel zwischen fließbedingten Konzentrationsänderungen auf den Vorzeichenwechsel in der v-SFG-Intensitätsänderung unter Flussbedingungen auswirkt, schlagen wir vor, dass nicht nur die Fluorid-, sondern auch die Calciumadsorption/-desorption (Gleichung (7)) berücksichtigt werden muss - insbesondere bei mittleren NaF-Konzentrationen.
von Calciumionen zu denen der Fluoridionen in Beziehung gesetzt wird. Da dieser Wert mit der hinzugefügten Natriumfluoridmenge ansteigt, wird die Verringerung der Calciumionenkonzentration unter Flussbedingungen mit zunehmender Fluoridkonzentration immer relevanter. Um zu verstehen, wie sich dieses Zusammenspiel zwischen fließbedingten Konzentrationsänderungen auf den Vorzeichenwechsel in der v-SFG-Intensitätsänderung unter Flussbedingungen auswirkt, schlagen wir vor, dass nicht nur die Fluorid-, sondern auch die Calciumadsorption/-desorption (Gleichung (7)) berücksichtigt werden muss - insbesondere bei mittleren NaF-Konzentrationen.
 (7)
(7)Hier führt die Adsorption eines Calciumions an eine endständige ungeladene  -Gruppe zu einer endständigen
-Gruppe zu einer endständigen  -Gruppe. Dementsprechend kann das Zusammenspiel von flussinduzierter Fluorid- und Calciumadsorption/-desorption die Oberflächenladung positiver oder weniger positiv machen. Da mit zunehmender NaF-Menge die Auswirkung der flussinduzierten Änderungen der Calciumkonzentration an Bedeutung gewinnt (Abbildung 2d), überwiegt der Einfluss von Calciumadsorption/-desorption auf die Oberflächenladung (Gleichung (7)) gegenüber der von Fluoridadsorption/-desorption (Gleichung (2)). Dies erklärt ebenfalls die Beobachtung der unterschiedlichen Vorzeichen der flussinduzierten Änderung der v-SFG-Intensität in Abbildung 3.
-Gruppe. Dementsprechend kann das Zusammenspiel von flussinduzierter Fluorid- und Calciumadsorption/-desorption die Oberflächenladung positiver oder weniger positiv machen. Da mit zunehmender NaF-Menge die Auswirkung der flussinduzierten Änderungen der Calciumkonzentration an Bedeutung gewinnt (Abbildung 2d), überwiegt der Einfluss von Calciumadsorption/-desorption auf die Oberflächenladung (Gleichung (7)) gegenüber der von Fluoridadsorption/-desorption (Gleichung (2)). Dies erklärt ebenfalls die Beobachtung der unterschiedlichen Vorzeichen der flussinduzierten Änderung der v-SFG-Intensität in Abbildung 3.
Um den Beitrag der Calciumadsorption/-desorption zu bestätigen, wurden zusätzliche Flussexperimente mit und ohne Calciumzusatz durchgeführt. Wenn die beobachtete Abnahme der v-SFG-Intensität unter Flussbedingungen auf eine Verringerung der Calciumkonzentration zurückzuführen ist, was auf Calciumadsorption/-desorption hindeutet, wird die Zugabe von Calcium zur Reservoirlösung die Verdünnung des Calciums bei Fluss verringern. Folglich werden die Änderung der Oberflächenladung und die entsprechende v-SFG-Intensität weniger ausgeprägt sein, wenn Calcium zur Reservoirlösung hinzugefügt wird. Abbildung 3c zeigt die Ergebnisse für Flussexperimente von 1 mM HCl mit 1 mM NaF-Lösungen mit und ohne Zusatz von 10 μM CaCl2. Die flussbedingte Änderung der v-SFG-Intensität nimmt bei Zugabe von 10 μM CaCl2 eindeutig ab. Daraus lässt sich schließen, dass sowohl die Fluorid- als auch die Calciumadsorption/-desorption durch die beiden Reaktionen (Gleichungen (2) und (7)) auf kompetitive Weise zur Oberflächenladung beitragen. Unter Fluss haben die beiden Reaktionen entgegengesetzte Auswirkungen: Die flussbedingte Verringerung der Fluoridkonzentration an der Grenzfläche erhöht die Oberflächenladung, indem sie das Gleichgewicht aus Gleichung (2) auf die rechte Seite treibt. Die Abnahme der Calciumkonzentration verringert die Oberflächenladung, indem sie das Gleichgewicht aus Gleichung (7) auf die linke Seite verlagert. Bei einer Fluoridkonzentration des Volumens von 1 mM wird die Auswirkung der Fluoridadsorption/-desorption auf die Verdünnung bei Fluss unterdrückt, wodurch der Beitrag von Calcium sichtbar wird. Da die Zugabe von Fluorid den Auflösungsprozess unterdrückt, werden auch die Calciumkonzentration und die Verdünnung mit zunehmender Fluoridkonzentration kleiner (Abbildung 2a und c), weshalb sich bei 3 mM zugesetztem Natriumfluorids beide Adsorptions-/Desorptionsgleichgewichte und damit die Oberflächenladung und die beobachtete v-SFG-Intensität bei Fluss nicht mehr ändern.
Die Auswirkung der Calciumadsorption auf die Oberflächenladung wird auch durch die Höhe der v-SFG-Intensität bestätigt. Aus dem Vergleich der beiden Datensätze in Abbildung 3c geht klar hervor, dass die Zugabe von Calcium die Oberflächenladung erhöht, wie man an der ≈10 % höheren v-SFG-Intensität im Fluss-Aus-Zustand erkennen kann.
 , an (sowohl unter fließenden als auch unter statische Bedingung). Dieser Anstieg wird aber durch die Dichte der Adsorptions-/Desorptionsstellen
, an (sowohl unter fließenden als auch unter statische Bedingung). Dieser Anstieg wird aber durch die Dichte der Adsorptions-/Desorptionsstellen  zu einer Monolage gemäß Gleichung (8) begrenzt. Hier wird die Menge der Adsorption durch die Dichte der besetzten Adsorptionsstellen
zu einer Monolage gemäß Gleichung (8) begrenzt. Hier wird die Menge der Adsorption durch die Dichte der besetzten Adsorptionsstellen  quantifiziert. Die Stärke der Adsorption hängt von den Geschwindigkeitskonstanten für Adsorption und Desorption
quantifiziert. Die Stärke der Adsorption hängt von den Geschwindigkeitskonstanten für Adsorption und Desorption  und
und  ab. Man beachte, dass das Langmuir-Modell jegliche Wechselwirkung zwischen verschiedenen Oberflächenstellen sowie elektrostatische Wechselwirkungen vernachlässigt. Einzelheiten zum mathematischen Hintergrund und eine Erweiterung von Gleichung (8) für die Adsorption/Desorption von zwei Spezies (Calcium- und Fluoridionen) werden in der Hintergrundinformation, Absatz S1.2 vorgestellt.
ab. Man beachte, dass das Langmuir-Modell jegliche Wechselwirkung zwischen verschiedenen Oberflächenstellen sowie elektrostatische Wechselwirkungen vernachlässigt. Einzelheiten zum mathematischen Hintergrund und eine Erweiterung von Gleichung (8) für die Adsorption/Desorption von zwei Spezies (Calcium- und Fluoridionen) werden in der Hintergrundinformation, Absatz S1.2 vorgestellt.
 (8)
(8)Gemäß Gleichung (8) und der Erweiterung aus Gleichung (S-15) erfordert die Modellierung die Kenntnis der Konzentration der adsorbierenden/desorbierenden Ionen bei ausgeschaltetem und eingeschaltetem Fluss, welche bereits oben diskutiert und in Abbildung 2 dargestellt wurden. Die zu modellierenden Daten sind die normierten v-SFG-Intensitäten aus Abbildung 1b und ihre durch den Fluss induzierte Änderung  aus Abbildung 3b. Die experimentellen Daten und das Modell sind in diesen Abbildungen zusammen dargestellt. Wie in der Hintergrundinformation, Absatz S1.3, näher beschrieben, wurde im Modell Γ=1019 m−2,
aus Abbildung 3b. Die experimentellen Daten und das Modell sind in diesen Abbildungen zusammen dargestellt. Wie in der Hintergrundinformation, Absatz S1.3, näher beschrieben, wurde im Modell Γ=1019 m−2,  =3.45×10−2 mol3 m−9, und 35 % Verdünnung bei Fluss verwendet. Die Parameter
=3.45×10−2 mol3 m−9, und 35 % Verdünnung bei Fluss verwendet. Die Parameter  250 V− und die Geschwindigkeitskonstanten
250 V− und die Geschwindigkeitskonstanten  700 m3 mol−1 für die Adsorption/Desorption von Fluorid und
700 m3 mol−1 für die Adsorption/Desorption von Fluorid und  0.005 m3 mol−1 für die Adsorption/Desorption von Calcium wurden gewählt, um die experimentellen Daten am besten zu beschreiben und das Oberflächenpotenzial ohne zugesetztes Natriumfluorid mit dem literaturbekanntem
0.005 m3 mol−1 für die Adsorption/Desorption von Calcium wurden gewählt, um die experimentellen Daten am besten zu beschreiben und das Oberflächenpotenzial ohne zugesetztes Natriumfluorid mit dem literaturbekanntem  -Potenzial von ≈70 mV abzustimmen.7 Außerdem ist eine leichte pH-Abhängigkeit für die HF-Bildung berücksichtigt (siehe Abbildung S1). Trotz seiner Einfachheit erfasst dieses Modell die grundlegenden Charakteristika der experimentellen Daten. Dieses Verhalten ist die monotone Abnahme der statischen v-SFG-Intensitäten und der Übergang von einer flussinduzierten Zunahme der v-SFG-Intensität bei niedrigen Fluoridkonzentrationen zu einer flussinduzierten Abnahme bei mittleren Konzentrationen und das Ausbleiben einer Änderung bei hohen Fluoridkonzentrationen. Insbesondere die Flussexperimente liefern einen entschiedenen Beitrag innerhalb der Modellierung in Bezug auf die Calciumadsorption/-desorption, wie in Abbildung S2 hervorgehoben wird. Dort ist das hier beschriebene erweiterte Modell mit einem Modell verglichen, welches nur die Adsorption/Desorption von Fluoridanionen berücksichtigt.
-Potenzial von ≈70 mV abzustimmen.7 Außerdem ist eine leichte pH-Abhängigkeit für die HF-Bildung berücksichtigt (siehe Abbildung S1). Trotz seiner Einfachheit erfasst dieses Modell die grundlegenden Charakteristika der experimentellen Daten. Dieses Verhalten ist die monotone Abnahme der statischen v-SFG-Intensitäten und der Übergang von einer flussinduzierten Zunahme der v-SFG-Intensität bei niedrigen Fluoridkonzentrationen zu einer flussinduzierten Abnahme bei mittleren Konzentrationen und das Ausbleiben einer Änderung bei hohen Fluoridkonzentrationen. Insbesondere die Flussexperimente liefern einen entschiedenen Beitrag innerhalb der Modellierung in Bezug auf die Calciumadsorption/-desorption, wie in Abbildung S2 hervorgehoben wird. Dort ist das hier beschriebene erweiterte Modell mit einem Modell verglichen, welches nur die Adsorption/Desorption von Fluoridanionen berücksichtigt.
Wir möchten betonen, dass unser Modell eher konzeptionelle Einblicke vermittelt und dass die quantitative Werte der Adsorptionsgeschwindigkeitskonstanten mit Vorsicht zu betrachten sind. Dies liegt daran, dass dieses einfache Modell einige quantitative Merkmale der experimentellen Daten nicht komplett erfasst, wie z. B. die deutlich steilere Abnahme der v-SFG-Intensität bei niedrigen Fluoridkonzentrationen oder die Unterschätzung des Plateaus im minimolaren Bereich für die statischen Intensitäten (Abbildung 1b). Zudem zeigt das Modell eine verschobene und gestreckte Kurve der flussinduzierten Intensitätsänderungen (Abbildung 3b). All diese Abweichungen könnten mit der angenommenen Ladungsunabhängigkeit von  , den Einschränkungen des Gouy-Chapman-Modells bei höheren Oberflächenpotentialen, der Vernachlässigung der Elektrostatik oder anderen Vereinfachungen innerhalb des Langmuir-Adsorptionsmodells zusammenhängen. Darüber hinaus hängen die Diskrepanzen vermutlich mit der Tatsache zusammen, dass Änderungen der SFG-Intensitäten auf relative Variationen der Oberflächenladung basieren, während im Modell absolute Werte der Oberflächenladung erforderlich sind. Dies macht die erhaltenen Parameter in gewisser Weise uneindeutig: So ist die Beschreibung der Daten bei statischen Bedingungen weniger empfindlich gegenüber der genauen Wahl der Modellparameter (Abbildung S3a). Jedoch wird in Abbildung S3 ersichtlich, dass insbesondere die Größenordnung der vorhergesagten flussinduzierten Änderungen sehr empfindlich auf das Verhältnis der Adsorptionsgleichgewichte für Calcium und Fluorid reagieren: Werden diese Verhältnisse um den Faktor 5 verändert, über- bzw. unterschätzen die theoretisch vorhergesagten flussinduzierten v-SFG-Änderungen die experimentellen Beobachtungen deutlich und können wichtige Merkmale wie den Wechsel des Vorzeichens der flussinduzierten Intensitätsänderungen nicht mehr beschreiben. Die in Abbildung 3 dargestellten Flussexperimente sind daher sehr empfindlich gegenüber den relativen Adsorptionsgleichgewichten der beiden Ionen: Auf der Grundlage des Modells wird eine klare Dominanz der Adsorption/Desorption von Fluorid gefunden, wenn die verwendeten Geschwindigkeitskonstanten (
, den Einschränkungen des Gouy-Chapman-Modells bei höheren Oberflächenpotentialen, der Vernachlässigung der Elektrostatik oder anderen Vereinfachungen innerhalb des Langmuir-Adsorptionsmodells zusammenhängen. Darüber hinaus hängen die Diskrepanzen vermutlich mit der Tatsache zusammen, dass Änderungen der SFG-Intensitäten auf relative Variationen der Oberflächenladung basieren, während im Modell absolute Werte der Oberflächenladung erforderlich sind. Dies macht die erhaltenen Parameter in gewisser Weise uneindeutig: So ist die Beschreibung der Daten bei statischen Bedingungen weniger empfindlich gegenüber der genauen Wahl der Modellparameter (Abbildung S3a). Jedoch wird in Abbildung S3 ersichtlich, dass insbesondere die Größenordnung der vorhergesagten flussinduzierten Änderungen sehr empfindlich auf das Verhältnis der Adsorptionsgleichgewichte für Calcium und Fluorid reagieren: Werden diese Verhältnisse um den Faktor 5 verändert, über- bzw. unterschätzen die theoretisch vorhergesagten flussinduzierten v-SFG-Änderungen die experimentellen Beobachtungen deutlich und können wichtige Merkmale wie den Wechsel des Vorzeichens der flussinduzierten Intensitätsänderungen nicht mehr beschreiben. Die in Abbildung 3 dargestellten Flussexperimente sind daher sehr empfindlich gegenüber den relativen Adsorptionsgleichgewichten der beiden Ionen: Auf der Grundlage des Modells wird eine klare Dominanz der Adsorption/Desorption von Fluorid gefunden, wenn die verwendeten Geschwindigkeitskonstanten ( ) aus unserem Modell verglichen werden. Aus diesem Vergleich geht hervor, dass die Adsorption/Desorption von Fluorid die von Calcium um etwa 5 Größenordnungen übersteigt. Da die Modellierung auf mehreren Annahmen und Vereinfachungen wie dem Langmuir-Adsorptionsmodell beruht, wird hauptsächlich darauf abgezielt, mechanistische Erkenntnisse zu gewinnen. Die experimentellen Ergebnisse in Verbindung mit dem Modell belegen eindeutig das Zusammenspiel zweier Adsorptionsreaktionen, wobei das Herauslösen von Fluorid gegenüber dem von Calcium deutlich überwiegt. Auch wenn es schwierig ist, quantitative Adsorptionsraten zu erhalten, kann die Dominanz der Fluoridadsorption um mehrere Größenordnungen bestimmt werden. Die hier beschriebene Schätzung wird auch verwendet, um die Auswirkungen von Fluorid- und Calciumkonzentrationen auf die Oberflächenladung (Abbildung S4a) zu erörtern und um festzustellen, bei welchen zugesetzten Fluoridkonzentrationen eine Konzentrationsänderung wie in den Flussexperimenten durch welchen Adsorptionsprozess dominiert wird. Das Modell wird auch angewendet, um die Oberflächenladungen in den Experimenten abzuschätzen (Abbildung S4b). Es zeigt sich, dass bei allen im Experiment betrachteten Konzentrationen weniger als 1 % der Oberflächenstellen geladen sind, da die Adsorption von Fluoridanionen dominiert. Aus diesem Grund spiegeln die konzentrations- und flussabhängigen v-SFG-Intensitätsschwankungen nur einen sehr kleinen Bereich von Oberflächenladungsschwankungen wider, was auf eine hohe Empfindlichkeit der Experimente schließen lässt.
) aus unserem Modell verglichen werden. Aus diesem Vergleich geht hervor, dass die Adsorption/Desorption von Fluorid die von Calcium um etwa 5 Größenordnungen übersteigt. Da die Modellierung auf mehreren Annahmen und Vereinfachungen wie dem Langmuir-Adsorptionsmodell beruht, wird hauptsächlich darauf abgezielt, mechanistische Erkenntnisse zu gewinnen. Die experimentellen Ergebnisse in Verbindung mit dem Modell belegen eindeutig das Zusammenspiel zweier Adsorptionsreaktionen, wobei das Herauslösen von Fluorid gegenüber dem von Calcium deutlich überwiegt. Auch wenn es schwierig ist, quantitative Adsorptionsraten zu erhalten, kann die Dominanz der Fluoridadsorption um mehrere Größenordnungen bestimmt werden. Die hier beschriebene Schätzung wird auch verwendet, um die Auswirkungen von Fluorid- und Calciumkonzentrationen auf die Oberflächenladung (Abbildung S4a) zu erörtern und um festzustellen, bei welchen zugesetzten Fluoridkonzentrationen eine Konzentrationsänderung wie in den Flussexperimenten durch welchen Adsorptionsprozess dominiert wird. Das Modell wird auch angewendet, um die Oberflächenladungen in den Experimenten abzuschätzen (Abbildung S4b). Es zeigt sich, dass bei allen im Experiment betrachteten Konzentrationen weniger als 1 % der Oberflächenstellen geladen sind, da die Adsorption von Fluoridanionen dominiert. Aus diesem Grund spiegeln die konzentrations- und flussabhängigen v-SFG-Intensitätsschwankungen nur einen sehr kleinen Bereich von Oberflächenladungsschwankungen wider, was auf eine hohe Empfindlichkeit der Experimente schließen lässt.
Die abgeschätzte Dominanz der Fluoridadsorption/-desorption macht es bemerkenswert, dass der geringe Beitrag von Calcium letztendlich die durch den Fluss induzierten Veränderungen bei einer bestimmten Fluoridkonzentration des Volumens bestimmen kann. Mit diesem sensitiven experimentellen Ansatz der Kombination von oberflächenspezifischer v-SFG-Spektroskopie und Flussexperimenten wurde das komplexe Zusammenspiel einer dominanten Fluorid- und einer schwachen Calciumadsorptions-/desorptionsreaktion aufgedeckt und quantifiziert. Dies löst die in der Literatur bestehende Kontroverse über die potenzialbestimmende Rolle der beiden Ionen auf: Die Fluoridadsorption ist um Größenordnungen dominanter; es gibt jedoch auch einen Calciumbeitrag, der bei Konzentrationsänderungen, wie sie im Flussexperiment gemessen werden, die Änderung der Oberflächenladung vorgeben kann. Wir gehen davon aus, dass die Kombination von Flussexperimenten und oberflächensensitiver Spektroskopie ein nützliches Instrument zur Untersuchung von Grenzflächenreaktionen in einem breiteren Spektrum von Systemen sein kann. Ein solches Experiment erfordert die spektroskopische Zugänglichkeit der Oberfläche und einen Konzentrationsgradienten zwischen der Grenzfläche, an der die Reaktionen stattfinden, und dem Reservoir, da bei Fluss die Grenzflächenkonzentrationen und damit die chemischen Gleichgewichte der (auch indirekt) spektroskopisch untersuchten Spezies verändern werden. Die Anwendung unseres Ansatzes sollte für andere Mineral-Wasser-Grenzflächen einfach sein, könnte sich aber auch in anderen Bereichen der Oberflächenchemie wie der heterogenen Katalyse oder der Elektrochemie als aufschlussreich erweisen.
Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die Kombination aus oberflächenspezifischer v-SFG-Spektroskopie und Flussexperimenten geeignet ist, die komplexe Oberflächenchemie von Adsorptions-/Desorptionsreaktionen an der Fluorit-Wasser-Grenzfläche aufzudecken. Aufgrund der hohen Empfindlichkeit unseres Ansatzes konnte gezeigt werden, dass die Adsorption/Desorption von Calcium neben der dominierenden Adsorption/Desorption von Fluorid nur einen geringen Beitrag zur Oberflächenladung darstellt. Auf der Grundlage von v-SFG-Experimenten mit und ohne Fluss für eine Reihe verschiedener Fluoridkonzentrationen wurde der Beitrag der Fluoridadsorption/-desorption zur flussinduzierten Veränderung des chemischen Gleichgewichts an der Grenzfläche unterdrückt. Die daraus entwickelten Hypothesen wurden durch Experimente bei einer festen Fluoridkonzentration mit und ohne Zugabe von nur 1 % Calcium in der Volumenkonzentration (im Vergleich zur Fluoridkonzentration) verifiziert. Unsere Interpretation wird außerdem durch eine einfache Modellierung gestützt, welche auf zwei konkurrierenden Langmuir Adsorptions-/Desorptionsreaktionen beruht. Diese Modellierung bestätigt konzeptionell das Zusammenspiel zweier Adsorptionsreaktionen und ermöglicht es, die Dominanz der Adsorptions-/Desorptionsreaktion des Fluorids abzuschätzen: Die Wirkung von Fluorid auf die Oberflächenladung ist um mehrere Größenordnungen stärker als die Wirkung von Calcium. Mit diesen Ergebnissen wird eine Kontroverse in der Literatur gelöst, die bisher nur eine der beiden Adsorptions-/Desorptionsreaktionen, nicht aber das Zusammenspiel beider berücksichtigt hat. Insgesamt kann die Kombination aus oberflächenspezifischer v-SFG-Spektroskopie zur indirekten Messung der Oberflächenladung und Flussexperimenten genutzt werden, um chemische Prozesse an einer Mineral-Wasser-Grenzfläche mit hoher Sensitivität zu untersuchen. Es ist möglich, das Zusammenspiel zwischen sehr kleinen Beiträgen und damit die Komplexität von Grenzflächenreaktionen aufzudecken. Wir erwarten daher, dass dieser Ansatz in Zukunft bei der Untersuchung von Oberflächenreaktionen an einer Vielzahl von Fest-Flüssig-Grenzflächen, insbesondere in der Geochemie, Anwendung finden wird.
Author Contributions
P.O., J.H., E.H.G.B. und M.B. entwarfen das Forschungsprojekt. P.O. und S.H.K. führten die Experimente durch, P.O. analysierte die Daten und entwickelte das Modell. Alle Autoren diskutierten die Ergebnisse und verfassten das Manuskript.
Danksagung
P.O. dankt für die finanzielle Unterstützung durch das Max Planck Graduate Center mit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (MPGC). Außerdem danken die Autoren René van Roij und Willem Q. Boon für fruchtbare Diskussionen.
Interessenkonflikt
Die Autoren erklären, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.
Open Research
Data Availability Statement
Die Daten, die die Ergebnisse dieser Studie unterstützen, sind auf begründete Anfrage beim Autor erhältlich.