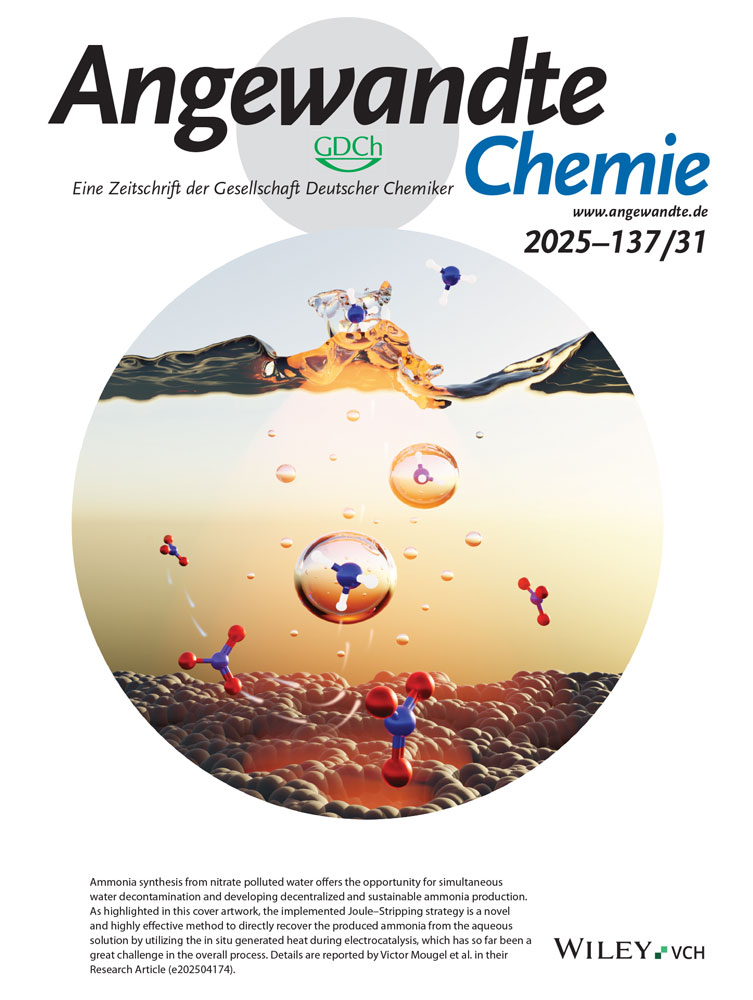Article
Full Access
Das Clusius-Dickelsche Trennrohr und die physikalisch-mathematische Theorie seiner Wirkungsweise und Leistungsfähigkeit
Professor Dr. H. Jensen,
Professor Dr. H. Jensen
Instituten für theoretische Physik und physikalische Chemie der Universität Hamburg
Search for more papers by this authorProfessor Dr. H. Jensen,
Professor Dr. H. Jensen
Instituten für theoretische Physik und physikalische Chemie der Universität Hamburg
Search for more papers by this author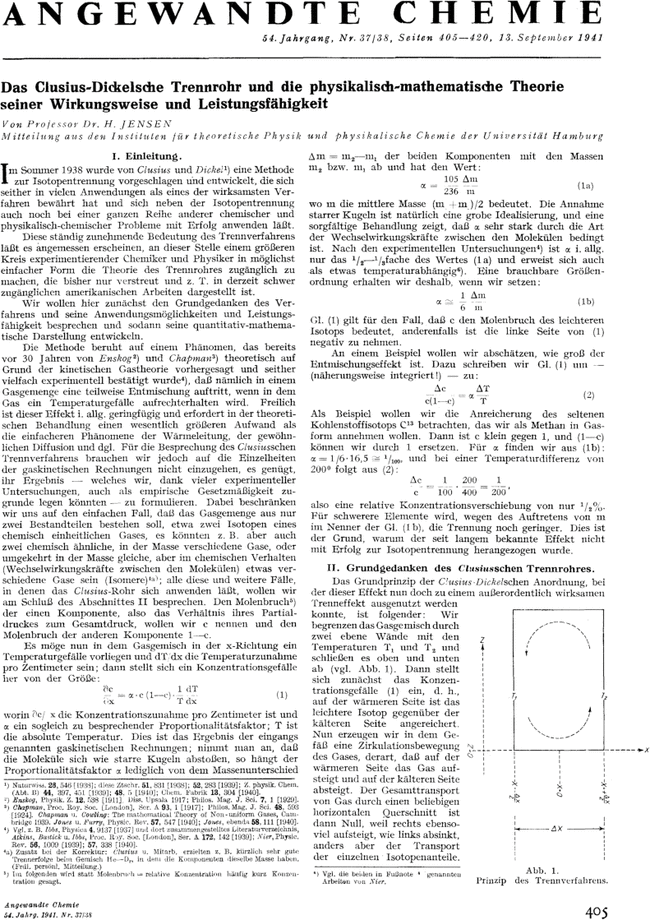
References
- 1 Naturwiss. diese Ztschr. 26, 546 [1938]; diese Ztschr. 51, 283 [1938]; diese Ztschr. 52, 283 [1939]; Z. physik. Chem. (Abt. B) 44, 397, 451 [1939]; Z. physik. Chem. 48, 5 [1940]; Chem. Fabrik 13, 304 [1940].
- 2 Enskog, Physik. Z. 12, 538 [1911], Diss. Upsala 1917; Philos. Mag. J. Sci. 7, 1 [1929].
- 3 Chapman, Proc. Roy. Soc. [London], Ser. A 93, 1 [1917]; Philos. Mag. J. Sci. 48, 593 [1924]. Chapman u. Cowling: The mathematical Theory of Non-uniform Gases, Cambridge 1939. Jones u. Furry, Physic. Rev. 57, 547 [1940]; Jones, Physic. Rev. 58, 111 [1940].
- 4
Vgl. z. B.
Ibbs,
Physica
4, 9137
[1937] und
dort zusammengestelltes Literaturverzeichnis,
10.1016/S0031-8914(37)80209-8 Google ScholarAtkins, Bastick u. Ibbs, Proc. Roy. Soc. [London], Ser. A 172, 142 [1939]; Nier, Physic. Rev. 56, 1009 [1939]; Physic. Rev. 57, 338 [1940]. 4a Zusatz bei der Korrektur: Clusius u. Mitarb. erzielten z. B. kürzlich sehr gute Trennerfolge beim Gemisch He—D2, in dem die Komponenten dieselbe Masse haben. (Frdl. persönl. Mitteilung.)
- 5 Im folgenden wird statt Molenbruch = relative Konzentration häufig kurz Konzentration gesagt.
- 6 Vgl. die beiden in Fußnote 4 genannten Arbeiten von Nier.
- 7 Das Verhältnis der Strömungsgeschwindigkeit zur mittleren Zirkulationsgeschwindigkeit muß notwending, wie die quantitativen Überlegungen der nächsten Abschnitte ergeben, kleiner als α Δ T/T, also wegen des kleinen Wertes von a sehr gering sein. 7a) Waldmann, Z. Physik Physic. Rev. 114, 53 [1939]; Debye, Ann. Physik [5] 36, 284 [1939].
- 8 Hertz, Z. Physik Ann. Physik [5] 79, 108 [1932]; Barwich, Z. Physik Ann. Physik [5] 100, 166 [1936]. Wegen eines detail-lierten Vergleichs der Trennerfolge beim Neon sei auf Tabelle 1 in der Arbeit von Clusius u. Dickel, Z. physik. Chem., (Abt. B) 48, 50 [1940] verwiesen.
- 9 Naturwiss. Z. physik. Chem. 28, 711 [1940].
- 10 Persönl. Mitt. V. Prof. Clusius. Zusatz bei der Korrektur: Inzwischen konnten bereits 500 ccm reines Kr86 gewonnen werden (Reinheit 99,5%).
- 11 Groth, Naturwiss. Z. physik. Chem. 27, 260 [1939]; Groth u. Harteck, Naturwiss. Z. physik. Chem. S. 584. 11a ) Physik. Z. Naturwiss. Z. physik. Chem. 41, 14 [1940].
- 12 Physik. Z. Naturwiss. Z. physik. Chem., im Erscheinen.
- 13 Rev. mod. Physics, im Erscheinen. 13a ) Ergebn. d. exakt. Naturwissenschaften, Bd. XX, J. Springer, Berlin, im Erscheinen.
- 14 Z. physik. Chem., Abt. A 44, 397 [1939].
- 15 Vgl. dazu den Bericht diese Ztschr. 54, 153 [1941].
- 16 Vgl. z. B. Wirtz u. Korsching, Naturwiss. 27, 110 [1939]; Clusius u. Dickel, Naturwiss. S. 148; Wirtz, diese Ztschr. 53, 594 [1940]; Ber. dtsch. chem. Ges. 73, 249 [1940].
- 17 Der nächste Abschnitt (IV) kann auch ohne Kenntnisnahme der in diesem Abschnitt gebrachten mathematischen Entwicklungen gelesen werden.
- 18 Gewöhnlich. schreibt man Dgrad (ρ c), wenn jedoch ρ räumlich veränderlich ist, gilt Gl. (3a).
- 19 Furry, Jones u. Onsager, Physic. Rev. 55, 1083 [1939]; Jones u. Furry, Physic. Rev. 57, 547 [1940]; Jones, Physic. Rev. 58, 111 [1940]; Bardeen, Physic. Rev. 57, 35 [1940]; Physic. Rev. 58, 94 [1940].
- 20 Da alle Größen nur von der radialen Richtung (x-Richtung) abhängen, läßt sich die Integration über die Richtung senkrecht zu x und z, also längs des Rohrumfangs, sofort ausführen, und der Umfang U ist einfach als Faktor vor das Integral zu schreiben. Dabei haben wir angenommen, daß der Umfang U groß gegenüber dem Abstand Δx von innerem und äußerem Rohr ist. Genauer müßte man für U den mittleren Umfang beider Rohre einsetzen.
- 21 Der Beitrag dieses Terms ist im Vergleich zu den übrigen Gliedern der GI. (15) klein im Verhältnis α/10° ΔT/T zu 1, d. h. in allen Fällen zu vernachlässigen.
- 22 Dieser Ausdruck kommt folgendermaßen zustande: Nach der Definition der Viscositätskonstante η übt die innere Reibung auf ein Flächenelement dF, das senkrecht zum Geschwindigkeitsgefälle steht, die Kraft K = dFη dv/dx aus. Auf ein Volumenelement, das durch zwei parallele Flächenstücke dF im Abstand dx begrenzt ist, wirkt also als' Kraft der Unterschied von dF·dv/df · an beiden Begrenzungsflächen, d. h. dx2 dk/dx = dxdF ·η · d2v/dx2; dxdF ist aber das Volumen, also ist die resultierende Kraft pro Volumeneinheit gerade η d2v/dx2. Hierbei ist η konstant gehalten (kleine Temperaturdifferenzen), im allgemeinen Fall muß man schreiben: Kraft pro Volumen-einheit = d/dx (η dv/dx).
- 23 Hier müssen wir natürlich auch bei kleinen Temperaturunterschieden die Veränderlichkeit von ρ mit der Temperatur berücksichtigen, da nur dadurch überhaupt die Zirkulationsströmung bedingt ist; dagegen können wir dann wieder dρ/dT = -ρ/T näherungsweise als konstant ansehen.
- 24 Für die Leser, die die Entwicklungen des vorigen Abschnittes überschlagen haben, sei noch einmal die Bedeutung der in den Formeln vorkommenden Größen angegeben: τ ist die in irgendeiner Phase des Trennprozesses in der Zeiteinheit nach oben beförderte Menge (in g) des leichten Isotops (bzw. nach unten beförderte Menge des schweren Isotops), U ist der Rohrumfang. In der betreffenden Phase des Trennprozesses hat das vertikale Konzentrationsgefälle den Wert de/dz erreicht. Tist die mittlere Temperatur, ΔT die Temperaturdifferenz zwischen äußerem und innerem Rohr bzw. Draht. ρ ist die Dichte des Gases (in g/cm3), D ist die Diffusionskonstante, η die Viscosität. ρ, D und η sind bei der mittleren Temperatur zu nehmen. Δx ist der Abstand zwischen äußerem und innerem Rohr (bzw. Draht). Die Bedeutung von τo, l und Δxo wird im folgenden Text erläutert.
- 25 Genauer gilt η = const V √ (1 + O/T)-1, mit O=Sutherlandsche Konstante, in weitem Temperaturbereich kann man jedoch ohne merklichen Fehler η durch η = const·T ersetzen. Entsprechendes gilt für die Temperaturabhängigkeit der Diffusionskonstanten. weil allgemein die Beziehung gilt ρD/η = const.
- 26 Die Änderung des Moleabruchs der leichten Komponente ist natürlich gleich der hinaufgebrachten Menge, dividiert durch die gesamte im oberen Vorratsbehälter befindliche Gasmenge, also pro Zeiteinheit gleich τ/M. Mit A bezeichnen wir wieder den maximalen Anreicherungsfaktor expl. (z/I) und mit a den zeitlich veränderlichen An reicherungsfaktor a = c(Z)/co, vgl. GI. (23).
- 27 log ist der natürliche Logarithmus, aus A = eZ/I folgt Z = · log A.
- 28 Vgl. dazu Clusius u. Kowalski, Chem. Fabrik 13, 304 [1940], wo Vorteile und Nachteile beider Konstruktionsarten besprochen sind,
- 29 Auch Herr Waldmann ist in ebenfalls unveröffentlichten Rechnungen unabhängig und nach einer anderen Methode zu denselben Ergebnissen gekommen.
- 30 Im folgenden ist unter log immer der natürliche Logarithmus zu verstehen.
Citing Literature
This is the
German version
of Angewandte Chemie.
Note for articles published since 1962:
Do not cite this version alone.
Take me to the International Edition version with citable page numbers, DOI, and citation export.
We apologize for the inconvenience.