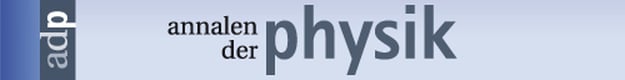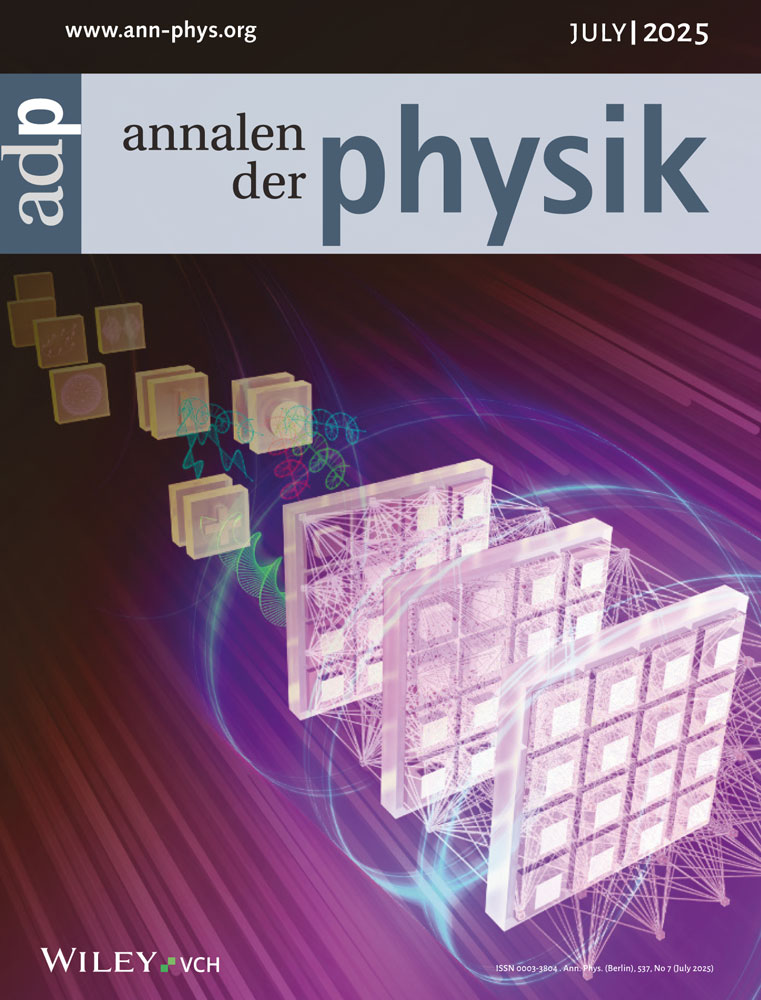Article
Full Access
Beschreibung einer photometrischen Methode zur Messung und Vergleichung der Stärke des farbigen Lichtes

References
- p201_1) Sollte diese Behauptung eine irrthümliche seyn, so wird sie dem Physiologen, der dem historischen Theil dieses schwierigen Capitels der Optik ziemlich fern steht, gern verziehen werden. Selbst in den neuesten Handbüchern der Physik finde ich wenigstens nur die Fraunhoferschen Zahlen. Auch Helmholtz erwähnt in seiner „physiologischen Optik”︁ bloss Fraunhofer's Methode zur vergleichenden Messung der Stärke des farbigen Lichtes.
- p202_1) Physiologie der Netzhaut, Breslau 1865, S. 139.
- p203_1) Dass diese Leistungen mit der Lichtstärke der Farbe und des Weiss variiren, versteht sich von selbst. Sie werden aber auch bei sehr geringen, Helligkeitsgraden immer noch hinreichen, um zur Farbenphotometrie gut verwendet werden zu können.
- p204_1) Eine Farbe erscheint uns weiss oder weisslich, nicht bloss – wie gewöhnlich gesagt wird – wenn sie ein gewisses, absolut sehr grosses, Maximum der Lichtstärke erreicht hat, sondern auch unterhalb dieses Maximum, wenn sie neben eine Farbe gleichen Tones, aber viel geringener Lichtstärke, gestellt wird.
- p204_2) Verdeckt man das Spectrum oder entfernt man die auf das sogenannte Scalafernröhrchen angeschraubte Platte, welche mit der horizontalen Spalte versehen ist, und lässt intensives Lampenlicht in das Rohr fallen, so ist das ganze Spectrum ausgelöscht und – in letzterem Fall – das ganze Sehfeld von einem noch deutlicherem Gelb erleuchtet, weil der Contrast der Spectralfarben jetzt wegfällt.
- p205_1) Die Verwendbarkeit dieses Verfahrens zur Erzielung schwacher Abschwächungen von P werde ich übrigens möglichst bald experimentell prüfen.
- p205_2) Die übliche Methode, welche mittelst der beleuchteten festen Scala des sog. Scalafernröhrchens die einzelnen Stellen des Spectrums misst, ist nicht für alle Fälle anwendbar. Ist das Spectrum überhaupt schwach,
- p209_1) In dem vorhin angegebenen Beispiel war die Zulage eines „schwachen”︁ Rauchglases nöthig, um die Merklichkeit der Spalte in eine Unmerklichkeit zu verwandeln. Ein derartiges Glas schwächt die, bei der Ebenmerklichkeit vorhandene, Lichtstärke der Spalte um 0,6. Nun ist aber, wenn durch eine Reihe Rauchgläser die Intensität von P bedeutend abgeändert ist, die Lichtstärke der Farbe eine enorme gegen die Lichtstärke der Spalte. Taxire ich die Lichtstärke der Farbe – was sehr viel zu niedrig gegriffen ist – 100mal grösser als die Lichtstärke des eben noch merklichen beigemischten Weiss der Spalte, so verwandelt die Zulage eines neuen Rauchglases, welches die Spalte unmerklich macht, die Lichtstärke des Spaltenlichtes in 1/160 der Lichtstärke der Farbe. Man sieht, dass sehr schwache Rauchgläser – auf deren Anwendung ich sogleich komme, einzeln genommen von keiner merklichen Wirkung seyn können. Man braucht für unseren Zweck nicht einmal zu wissen – und ich könnte auf diese Frage vorerst noch keine sichere Antwort geben – wie gross die Zumischung des weissen Lichtes zu den reinen Spectralfarben seyn muss, um letztere von den mit etwas Weiss versetzten Spectralfarben eben noch unterscheiden zu können. Meine Methode bietet übrigens ein bequemes Hülfsmittel, um auch diese Frage beantworten zu können. Sollte es sich herausstellen, dass das Verhältniss des zugemischten Weiss bei den einzelnen Farben verschieden – ja selbst sehr verschieden – seyn muss, um einen eben noch merklichen Unterschied der Sättigung der Farbe zu erhalten, so würde dadurch nur die Grösse des möglichen Beobachtungsfehlers in den einzelnen Bezirken des Spectrums variabel, die Methode aber keineswegs gefährdet werden.
- p211_1) Die von der trefflichen Steinheil'schen Werkstätte construirten Spectroscopspalten gestatten keine directen Ablesungen der Spaltbreite am Apparat selbst. Ich liess mir deshalb eine bewegliche Spalte verfertigen, deren Schraubenkopf mit einer Theilung in 100 Theile versehen ist, so dass, bei der Höhe des Schraubenganges von 0,245 Mllm. noch der hundertste Theil dieses Werthes bei der Veränderung der Spaltbreite bestimmt werden sollte. Mein Apparat leistet zwar etwas weniger, doch sind vollendete Micrometerschrauben für unseren Zweck, wo bloss relativ grosse Aenderungen der Spaltbreite noch von praktischem Werth sind, überflüssig. Veränderbare Spalten ohne Index sind auch für die gewöhnlichen Zwecke des Heliostatengebrauches mit gewissen Nachtheilen verbunden. Die Spaltbreite muss, wenn man ganz sicher seyn will, vor dem jedweiligen Gebrauch unter dem Mikroskop gemessen werden. Ich ziehe deshalb eine, mehrere Linien breite, feste Spalte vor, in welche ich einen Schieber einsetze, der wiederum mit einer constanten, viel schmälern, Spalte versehen ist. Der vorhin genannte Mechanicus verfertigte mir 3 Exemplare der Art von 0,25–0,33 und 0,4 Mllm. Spaltbreite, deren Ränder, bei einer Länge von 24 Mllm., unter dem Mikroskop, was ich nicht erwartet hätte, als tadellos parallel sich erwiesen.
- p212_1) Auch die wechselnde Accommodation des Auges bereitet unter Umständen kleine Schwierigkeiten, namentlich im Roth. Die Farben des Spectrums erscheinen so, als ob sie nicht in gleicher Entfernung vom Beobachter liegen; Brücke hat neuerdings verwandte Erscheinungen, die sich jedoch nicht auf das Spectrum beziehen, bezüglich der von ihm so genannten vorspringenden und zurücktretenden Farben (in den Wiener academischen Sitzungsberichten 1868 Juli) besprochen.
- p213_1) Bezüglich der, nicht bedeutenden, Disproportionalität zwischen den Alhidadengraden und den wirklichen Verschiebungen der beweglichen Spalte erinnere ich an das früher Bemerkte.
- p216_1) Dieses Spectrum wurde etwas weiter in das äusserste Roth verfolgt.
- p216_2) 28,0 Ende des Spectrums. Rothes Glas lässt bekanntlich bloss Roth und Orange durch.
- p216_3) d. h. im weniger hrechbaren Theil.
- p216_4) So schwaches Licht, dass die Angabe nur approximativ seyn kann.
- p218_1) Die geringe Lichtmenge nur approximativ bestimmt.
- p220_1) Wenn man nicht, mit Schmidt, eine aus fremden Beobachtungen abgeleitete Constante für das von jeder Glasplatte reflectirte Licht einführen will, was rein willkürlich wäre. Schmidt setzt in seiner Formel die lichtreflectirende Kraft der oberen und der unteren Glasfläche sogar geradezu gleich, obschon bereits Bouguer nachwies, dass die innere Reflexion stärker ist, als die äussere, etwa im Verhältniss von 1/28 zu 1/36.