Ethik, Chemie und das Bildungsziel Nachhaltigkeit†
Dieser Essay ist eine Gemeinschaftsarbeit, erstellt auf Grundlage der Beiträge zum Spezialsymposium “Ethics, Chemistry and Education for the Environment” im Rahmen des 3. EuCheMS Chemie-Kongresses in Nürnberg am 31. August 2010 und der anschließenden Diskussion. Es ist unsere Absicht, mit diesem Artikel zu zeigen, wie unabhängige, freie Partner einen Konsens erzielen können, vor allem in Zeiten, in denen ehemals feste wissenschaftliche Blöcke (wie Chemie, Physik und Biologie) zunehmend in viele kleine Unterdisziplinen zersplittern, die scheinbar an Zusammenhalt verlieren und auseinanderdriften. Vielleicht ist das unvermeidbar – und der ethische Diskurs könnte eine neue starke Verbindung herstellen.
Abstract
Verantwortlichkeit in den Naturwissenschaften in Bildung und fachlicher Praxis umzusetzen, damit Wissenschaftler ethischen Herausforderungen nicht länger wegen der geringen Kenntnis entsprechender Konzepte aus dem Weg gehen und das Vorsorgeprinzip kategorisch ablehnen, ist nach Meinung der Autoren eine zentrale Herausforderung, um eine friedliche und zugleich freigeborene Entfaltung des Individuums in einer wohlwollenden Gesellschaft zu erreichen, im fairen Geben und Nehmen. Welche Wege dahin führen können, wird sowohl anhand grundsätzlicher Überlegungen als auch an konkreten Beispielen wie einem Kurs in angewandter Ethik für Chemiestudenten und einem Förderprojekt im Kongo erläutert.
1. Nachhaltigkeit durch Chemie, eine Frage der Bildung
These are the days of miracles and horrors and hubris. The unveiling of the first synthetic living cell in May (2010) signalled that synthetic biology had emerged as a new technological frontier. Meanwhile, the Faustian bargain of a past frontier—using fossil fuels to provide energy—has come home to roost in the oil-ruined Gulf of Mexico, and in calls to geoengineer the climate. We are an innovating species, engaged in a balancing act. In the decades after the Second World War, innovation fuelled an unprecedented era of wealth creation while keeping us on the brink of nuclear annihilation. The green revolution fed billions while poisoning soil and water and destroying agrarian cultures. Today, synthetic biology and geoengineering portend a future in which managing socio-technical complexity will be every bit as challenging, if not more so. Is there a better way forward? Maybe—if we act fast, embrace our ignorance, and keep experts from taking over.1
Haben nicht die Experten zu all den Innovationen mit ihrer Forschung und deren Umsetzung in Dienstleistungen und Produkte durch die Industrie beigetragen, in der Chemie genauso wie in anderen Wissenschaften? Den Zwängen durch knapper werdende Rohstoffe gerecht zu werden war immer schon eine wichtige Triebkraft für die Erweiterung chemischen Wissens und die Entwicklungen der chemischen Industrie. Die Forschungsarbeiten von Haber und Bosch zur Fixierung von Luftstickstoff in Form von Ammoniak waren durch einen Engpass an natürlichem Nitrat, dem Chile-Salpeter, bedingt. Ähnliche Gründe führten zur Kohleverflüssigung durch Fischer und Tropsch. Ein drittes Beispiel ist die Erfindung synthetischen Gummis in den 1930er Jahren, wodurch die Abhängigkeit von Naturkautschuk-Importen aus tropischen Ländern geringer wurde, während gerade diese Abhängigkeit den betreffenden Handelsorganisationen um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert große Gewinne einbrachte, den Einwohnern der Herkunftsländer wie dem Kongo aber auch großes Leid. Heute ist es nicht anders. Mit der Herausforderung des sich abzeichnenden, möglicherweise schon überschrittenen Gipfels der Versorgungsmöglichkeit mit Erdöl, der Rohstoffbasis für die chemische Industrie und dem wichtigsten Energieträger für Verkehr und Transport, wird die Forschung zur Entwicklung leistungsfähiger und langlebiger Photovoltaik-Materialien immer wesentlicher.
Was aber bedeutet nun “Nachhaltigkeit”? Einfach weitermachen? Irgendwie schwingt in diesem Begriff ein Anklang an eine “bessere Welt” mit, und man kann sich schlecht vorstellen, dass jene Art von Nachhaltigkeit gemeint ist, die mit dem chemisch-industriellen Fortschritt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit ihren zwei Weltkriegen verbunden war, der Vernichtung von Millionen von Menschen, ermöglicht durch Habers Forschung und die Fertigkeit, Treibstoff für die Kriegsmaschinerie aus Kohle zu produzieren, auch in Auschwitz mit Tausenden von Zwangsarbeitern und dem großen Poeten und Chemiker Primo Levi als Laborsklaven.2
Zur Verwirklichung von Nachhaltigkeit braucht es wissenschaftliche Untersuchungen über komplexe Forschungsgegenstände, zum Beispiel bei geochemisch-physikalischen, umweltchemischen oder biochemisch-toxikologischen Fragen, bei denen Wissensaspekte aus einer großen Vielfalt von Disziplinen herangezogen werden müssen.3 Hier stellt sich die Frage, wer die Prioritäten der Forschung setzt. Sie sind vielfältig und hängen von den Umständen ab, unter denen Forschung durchgeführt wird. Im chemisch-industriellen Kontext, in dem wirtschaftlicher Ertrag im Vordergrund steht, werden sie durch Nachfrage und Erwartungen der Verbraucher bedingt, seien diese wirklich oder empfunden. Akademische, freie Forschung ist im Grunde die Suche nach Wahrheit, wobei die Prioritäten oft abhängig vom Stand des Untersuchungsprozesses sind, was sie vergleichbar mit einer Differentialgleichung macht. Neben der inneren Motivation des “Homo ludens” beeinflussen viele indirekte Faktoren wie die Interessen politischer und wirtschaftlicher Gruppen die Richtung des wissenschaftlichen Prozesses oder dominieren ihn sogar, wenn auch nicht immer auf den ersten Blick. Die Vernachlässigung solcher Kräfte kann dazu führen, dass “Wissenschaft (Umwelt-)Kontroversen verschlimmert”,3 ein Phänomen, das nicht neu ist. Dies kann wissenschaftlichen Fortschritt bremsen4 und zeitweilige Stagnation nach sich ziehen. Auf jeden Fall signalisiert es eine unzureichende Berücksichtigung philosophischer, ethischer oder gar spiritueller Grundfesten der Gesellschaft und des menschlichen Strebens.
Die Macht der chemischen Praxis – und wissenschaftsbasierter Technik im Allgemeinen – erreicht heute globale Ausmaße. Die “Grenzen des Wachstums”5 offenbaren sich in vielen Bereichen und werden in ökonomischen Erschütterungen wie der Bankenkrise im September 2009 und anderen soziopolitischen Phänomenen deutlich. Zugleich dauert der Wissenschaftsskeptizismus der Öffentlichkeit aus vielen Gründen fort. Einer dieser Gründe ergibt sich aus der Tatsache, dass wissenschaftliche Tätigkeit und ihre Umsetzung in industrielle Güter und Leistungen ein Maß an Disziplin in Denken und Handeln erfordern, das von vielen als unbequem empfunden wird, ein anderer daraus, dass Wissenschaftler und Industrie-Fachleute oft wenig Verständnis für die emotionalen Bedürfnisse und Ängste der Öffentlichkeit haben – ein Ergebnis des konventionellen Konzepts von Bildung als Förderung analytisch-intellektueller Fähigkeiten, während die Entwicklung empathisch-ethischer Fähigkeiten dem glücklichen Zufall überlassen bleibt.6 Sicherlich ist Ersteres eine wichtige Voraussetzung für professionelle Exzellenz, aber die Vernachlässigung des “Wofür”, der Philosophie von Verständnis und Verantwortung, hat einen herzlosen, kühl intellektuellen Ausbildungsprozess zur Folge, der dazu tendiert, menschliche Bedürfnisse und Träume auf der Strecke zu lassen. Dieses Gleichgewicht der beiden Facetten menschlichen Strebens zu verstehen und zu berücksichtigen sollte in der Verantwortung von Universitäten, ihren Lehrern und Forschern liegen – nicht nur weil sie Mitglieder ihrer Gesellschaft sind, sondern auch, weil Universitäten und ihre Fakultäten traditionell jene Institutionen sind, in denen die künftigen Kapitäne und Lotsen einer Gesellschaft ihr Wissen und ihre Fertigkeiten erlangen.7 Sind die alteingesessenen Universitäten offen für die dazu notwendigen Anpassungen8 oder sind sie so sehr mit ihren inneren Problemen und Prozessen beschäftigt, dass grundlegende Überholung akademischer Strukturen, eine neue Renaissance, von Nöten ist?
Das Missverhältnis der “Zwei Kulturen”9 und der Mangel an kultürlicher Sicht von Wissenschaft und Technologie wurden schon früher thematisiert.10 “Wissenschaft ist nicht nur methodische und wissenschaftliche Praxis, sondern auch Idee und Lebensart rationaler Kulturen. Logik und Gesellschaftsaspekte der Wissenschaft müssen durch Forschungsethik ergänzt werden, um den Wissenschaftsbegriff vollständig zu erfassen”.11 Der Bedarf an praktischer Realisierung von ethischen Prinzipien in der chemischen Ausbildung – was im weiteren Sinne ökologischer Bildung gleichkommt – wird durch das in den letzten Jahren gehäufte Erscheinen von Lehrbüchern und Monographien zur Wissenschafts- und Umweltethik12 verdeutlicht, durch Konferenzen und Workshops zu Ethik und Wissenschaft, z. B. die Foren über Ethik und Naturwissenschaften in Bayreuth, Ferrara und Torún13 oder das Symposium zu “Ethics, Chemistry and Education for the Environment” im Rahmen des 3. EuCheMS-Kongresses in Nürnberg. Dennoch bleibt eine schwierige Frage: Wie kann ethisch-empathische Bildung im Curriculum der Chemie – und anderer Fächer – praktisch verwirklicht werden? Die christlich-westliche Zivilisation gründet sich auf eine solche Kultur der Liebe, worauf wir mit Recht stolz sind. Andere sozio-politische Systeme der Welt haben unterschiedliche, doch äquivalente spirituelle Grundlagen von Respekt und Verständnis.
Das gegenwärtige Hauptproblem der Bildungsansätze entspringt einem tiefgreifenden Missverständnis. Der analytisch-intellektuelle Ansatz stellt eine starke und erfolgreiche Methodik bei der Behandlung wissenschaftlicher Fragestellungen dar, nämlich bei der Entscheidung, ob wissenschaftliche Hypothesen richtig oder falsch sind. Aber ethische Fähigkeiten wurzeln in der menschlichen spirituellen Realität, der anderen Seite konkreten menschlichen Seins.14 Hier sind viele Antworten möglich. Schwarzweiß-Ansätze sind unbrauchbar, denn sie führen zu Besserwisserei, Egoismus und Intoleranz. In diesem Bereich sind empathische Fähigkeiten, das Wissen des Herzens, viel wichtiger. Wo intellektuelle Einseitigkeit vorherrscht, führt sie zu einem gefühlsarmen Gesellschaftsmodell für junge Erwachsene, mit all seinen Folgen.8 Die Frage ist, wie kann, ohne Wissenschaft und Technologie zu behindern, eine angemessene philosophische und humanistische Grundlage unter praktischen Gesichtspunkten geschaffen werden, eine der großen Herausforderungen der Gegenwart.6 Das Abwägen, Diskutieren und Vorschlagen von Strategien und taktischem Vorgehen auf Konferenzen und in verschiedenen Publikationen ist ein Aspekt, die Realisierung in der Praxis ist ein anderer, und zwar um einiges anspruchsvoller. Zudem gibt es nicht nur ein Rezept oder nur eine Methode, sondern viele verschiedene Wege der Umsetzung sind möglich.
Im Folgenden wollen wir einige Ideen vorstellen, wie die Entwicklung einer Grundhaltung von fürsorglicher Verantwortung in einem chemisch-wissenschaftlichen Kontext realisiert werden kann. Wir erheben hier nicht den Anspruch, allumfassend oder allwissend zu sein, sind aber überzeugt, dass ein solcher Diskurs in die Hallen von Wissenschaft und Technologie gehört, um Nachhaltigkeit zu verwirklichen, zumindest für die unmittelbare Zukunft. Ein Weg – wir wagen zu sagen, der einzige, um Nachhaltigkeit langfristig zu gewährleisten – ist, diesen Dialog lebendig zu halten, die Fähigkeit zur anhaltenden Reflexion und Selbstreflexion eigener Überzeugungen und der geistigen Situation im Verhältnis zum Nachbarn, zum Konkurrenten und zum gesamten gesellschaftlichen und natürlichen Umfeld wachzuhalten. Praktische Wege dazu gibt es viele; zusammen mit moderner Wissenschaft und Technik – aber nicht durch sie! – scheinen diese Ziele erreichbar. Sie sollten jetzt, im Jahrzehnt der Erziehung zu nachhaltiger Entwicklung der UN,15 angegangen werden.
2. Drei Merkmale der Chemie
Betrachten wir die drei Hauptmerkmale der Chemie, in denen sie sich teilweise von anderen Disziplinen unterscheidet: 1) induktive Erkenntnis, 2) Kreativität und 3) Flexibilität. Alle drei nehmen den Chemiker in die Pflicht, sich mit ethischen Fragestellungen zu befassen.
- 1)
Wahre induktive Erkenntnis bedeutet ernsthaftes Experimentieren, womit Umfang und Kommunikation des Wissens erweitert werden. Gelegentlich geschieht dies unter Hintanstellen von Sicherheit und Achtung vor dem Menschen oder vor biologischen Grenzen. So ergibt sich die erste ethische Frage: Wo liegen die Grenzen des Experimentierens? Ein wesentlicher Aspekt dieser Frage bezieht sich auf Tierversuche: Sind sie notwendig oder können sie ersetzt werden, indem die benötigten Daten durch alternative Methoden gewonnen werden? Und sollten sie absolut unvermeidlich sein: Werden sie mit Achtung vor dem Tier, ohne physische Belastung oder große Schmerzen durchgeführt? Wird das Konzept der 3 R (Replacement, Reduction, Refinement)16 angewendet, werden Anstrengungen zu seiner Umsetzung unternommen?
- 2)
Kreativität bedeutet die Fähigkeit, neue Molekülstrukturen zu entwerfen oder bessere Wege zur Herstellung bekannter Moleküle zu finden. Manchmal werden die ursprünglichen Ziele einer Entwicklung vergessen; andere Verwendungen, vollkommen unterschiedlich zum ursprünglichen Zweck, können mitunter katastrophale Folgen haben. Ein Beispiel von vielen ist Thalidomid.17 Es entstammte einem Programm zur Suche nach Antibiotika, wurde dann aber als Wundermedizin gegen Schlaflosigkeit, Husten, Kopfschmerzen und morgendliche Übelkeit auf den Markt gebracht. Schon bald stellte es sich als stark missbildend für entwickelnde Föten heraus, wenn es von schwangeren Frauen am Ende des ersten Schwangerschaftsmonats eingenommen wurde. Während Wissenschaft und Industrie angemessene Maßnahmen zur Verbesserung der toxikologischen Tests ergriffen haben, sind die dramatischen Konsequenzen für die in jenen Jahren Geborenen, von denen die meisten heute ein Leben unter ärmlichen Bedingungen führen, von Gesellschaft, Politik oder Industrie nicht adäquat kompensiert worden. Eine andere Frage ist: Inwieweit ist der Entdecker einer Chemikalie verantwortlich für seine Entdeckung? Und weiter: Falls die Entdeckung eine wertvolle Errungenschaft für den Schutz von Gesundheit, Umwelt oder Lebensmittelqualität ist, darf es dann einen Patentanspruch geben?
- 3)
Flexibilität bedeutet die Fähigkeit, offen für unterschiedliche Interessen und Ziele zu sein, auch wenn sie sich widersprechen. Die grundlegende Frage für uns als Wissenschaftler und Forscher ist: Wie kann die technikfreundliche Seite der Chemie ökologisch verträglich gemacht werden?
3. Beispiele praktischer Ansätze zur ethischen Bildung
Wenn wir uns nicht selbst mit diesen schwierigen Fragen auseinandersetzen, ist es nicht verwunderlich, wenn die Öffentlichkeit der Chemie, ja der chemisch-wissenschaftlich geprägten Industrie im Ganzen eher skeptisch gegenübersteht. Es gibt unzählige Ebenen, auf denen Verantwortlichkeit und Respekt vor anderen und vor der Umwelt verdeutlicht werden kann. Natürlich ist klar, dass wir nicht vollkommen Herr über die Folgen unseres Handelns sind, dass es stets viel Unvorhersehbares außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten geben wird. Dennoch lässt sich leicht einsehen, dass die Art der chemischen – generell der wissenschaftlichen – Praxis Auswirkungen auf unsere Lebensweise, auf unsere direkten Nachbarn und auf die Umwelt hat und dass diese, abhängig von Stärke und Verbreitung einer Technik, sogar globale Ausmaße erreichen können. Des Weiteren gilt, dass unsere derzeitigen Lebens- und Arbeitsbedingungen auf einem Boden stattfinden, der in der Vergangenheit von anderen bereitet worden ist, die entweder daran aktiv mitgearbeitet haben oder die dazu passiv oder gar unter Ausbeutung beitragen mussten. Schließlich werden unsere heutigen Handlungen in einem unvorhersehbaren, aber möglicherweise großen Ausmaß die Zukunft von uns, unseren Kindern und den nachfolgenden Generationen bestimmen. Mit anderen Worten: Wir alle sind durch die Vergangenheit geprägt und gehen durch die Membran der Gegenwart in eine unvorhersehbare Zukunft. Warum sollten wir solche Fragen aufwerfen? Die Antwort ist einfach: Wir sind verantwortlich dafür, unsere Kinder mit der Fähigkeit und dem Mut auszustatten, sich der Unvorhersehbarkeit der Zukunft zu stellen. Am deutlichsten können wir dies dadurch demonstrieren und lehren, dass wir Interesse am Wohlbefinden der Mitmenschen in nah und fern zeigen. Dies kann auf allen Ebenen der (Aus)bildung und Forschung, in Universitäten, in der beruflichen Praxis geschehen, auch dadurch, wie wir anderen die Hand zum internationalen Wirken reichen.
3.1. Wo sind Schwächen, und wie können sie angegangen werden?
Zur Herausarbeitung von Grundbausteinen eines Kurses in angewandter Ethik in chemischen Lehrplänen18 sollten als erstes die Konsequenzen des sich stetig erweiternden Potenzials der Chemie betrachtet werden, nämlich – bedingt durch die Fortschritte in Technologie und Wissensverbreitung – nicht nur nützlich zu sein, sondern auch missbraucht werden zu können. So haben die Möglichkeiten für Einzelne, Terroranschläge zu verüben, ein bisher nie gekanntes Ausmaß erreicht.19 Nicht selten haben Terroristen Universitätsabschlüsse, und da sich rund um den Globus multikulturelle Gesellschaften ohne gemeinsame moralische Werte entwickeln, muss das Problem der vermeintlichen Wertefreiheit der Wissenschaft in Universitätslehrplänen angesprochen werden. Ein Kurs in Ethik sollte also nicht nur Wissen, sondern auch Kultur vermitteln, um von einem reformierten Denken zu einem reformierten Geist zu gelangen.6, 20 Entsprechend sollte den Studierenden nahegebracht werden: 1) eine ständig aktualisierte Vorstellung weltweiter Nachhaltigkeitsprobleme, 2) ein Gedächtnis für die großen Erfolgsgeschichten, aber auch für die Katastrophen als Folgen krimineller oder unangemessener Anwendung der Chemie und 3) das Wissen über die wichtigsten neueren philosophischen Beiträge zum ethischen Verstehen technologischer Zivilisation.6, 20–22
Drei von uns (F.D., H.F., J.M.) haben versucht, entsprechende Kurse für fortgeschrittene Studierende in Lehrpläne zu integrieren. Die wichtigsten Anliegen in Bezug auf globale Nachhaltigkeit sollten in einem solchen Kurs angesprochen werden, in dem Themen wie Krisen durch Wasserknappheit, Bevölkerungswachstum und Migration, Klimawandel oder die Grenzen an fossiler Energie und mineralischen Rohstoffen behandelt werden.
Die historische Sicht auf Wissenschaft im Allgemeinen und Chemie im Besonderen schafft neue Einsichten. Studierende wissen oft nicht, was in Seveso oder Bhopal wirklich passierte, nicht nur im Hinblick auf die wissenschaftlichen Aspekte, sondern auch hinsichtlich der menschlichen Dimensionen. Sie lassen sich aber, wie wir alle, von Geschichten faszinieren, und so ist dies ein anschaulicher Weg, Verantwortung und Vorsorgeprinzip zu lehren und zu lernen. Und da solche weltbewegenden Notsituationen nach entsprechenden praktischen Konsequenzen nicht nur auf politischer, gesellschaftlicher und individueller Ebene, sondern auch in Forschung und Industrie rufen, ergeben sich viele neue Möglichkeiten für Chemie und Wissenschaft im Ganzen.
Natur- und Geisteswissenschaften sollten zusammengeführt und ein fruchtbarer Dialog zwischen den Fachbereichen und ihren Studierenden entwickelt werden. Eine solchermaßen integrale Basis ist essenziell für eine reformierte Bildung: Dramen wie Der gefesselte Prometheus von Aischylos, der Chor in Antigone von Sophokles, Platons Dialog Theaitetos – alles dies sind bewegende Beispiele für die Betrachtung universeller ethischer Fragen, ebenso wie Mary Shellys Frankenstein oder Der moderne Prometheus. Daneben sollte ein Student die wichtigsten Denker der Gegenwart kennen, die zum Verständnis ethischer und sozialer Probleme beigetragen haben, zum Beispiel Hans Jonas und Ulrich Beck.
Hans Jonas’ Imperativ “Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden”22 wird heute von vielen als das Fundament für eine Ethik des Technologiezeitalters betrachtet, eine Erweiterung von Kants kategorischem Imperativ. Hans Jonas spricht die Tatsache an, dass unsere Handlungen als Resultat der Wechselwirkungen von Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft multiplikative und kooperative Effekte haben. Die Bedingungen von Nachbarschaft und Gleichzeitigkeit (hic et nunc), eine Grundlage vormoderner Ethik, sind für die moderne technische Praxis nicht mehr tauglich. Die Sphäre menschlichen Handelns ist nicht mehr das häusliche oder städtische Umfeld, sondern die gesamte Biosphäre. Mit dem Konzept des bestimmten Integrals als Summe verschwindend kleiner Teilbeiträge gelingt es, neue Probleme, z. B. Effekte kleiner Dosen zahlreicher Fremdstoffe, als Produkt kleiner Beiträge zu verstehen. Das Beispiel thermodynamischer Irreversibilität illustriert die Tatsache, dass Geschehenes unumkehrbar sein kann, und berührt den Unterschied zwischen ungewollter Beschädigung und bewusst hingenommenem Verbrechen. So zeigt sich die Nähe von Philosophie und Wissenschaft in ethischen Fragen.
Die Immanenz der Dualität menschlichen Handelns zu verstehen ist grundlegend notwendig, wie Ulrich Beck in seinem Buch Risikogesellschaft23 darlegt. “In der fortgeschrittenen Moderne geht die gesellschaftliche Produktion von Reichtum systematisch einher mit der gesellschaftlichen Produktion von Risiken.” Wohlstand ist fassbar und offenkundig, Risiken dagegen sind verborgen, können aber mit wissenschaftlichen Methoden und Instrumenten abgeschätzt werden. Hier zeigen chemometrische Definitionen von Fehlern erster und zweiter Art (H0 bzw. H1) und die damit verbundenen Wahrscheinlichkeiten (α bzw. β) ihre ethischen Komponenten. Die Unterschiede in der Definition von Evidenz in wissenschaftlichen Zusammenhängen und bei gesundheits- und umweltrechtlichen Fragen18 lassen erkennen, wie Konventionen einen ethischen Hintergrund haben können – oder nicht. In der Wissenschaft entspricht die Konvention, dass für Fehler erster und zweiter Art α=β=0.05 gilt, der Notwendigkeit zur Führung klarer Beweise aufgrund physikochemischer Tatsachen und Erkenntnisse, was für den Fortschritt der Wissenschaft sicherlich akzeptiert werden kann. Jedoch wird zu regulativen Zwecken zum Schutz menschlicher und ökologischer Unversehrtheit meist die Beziehung α>β herangezogen;18 dadurch wird die Zahl falsch positiver Voraussagen von Schadenswahrscheinlichkeiten zwar größer als die von falsch negativen Voraussagen, und es wird eine größere Zahl von Chemikalien als gefährlich eingestuft als es tatsächlich sind; aber damit wird auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass gefährliche Chemikalien als inert oder gutartig deklariert werden (Fehler zweiter Art, β). Die beiden Konventionen α=β und α>β haben also entsprechend unterschiedliche ethische Grundlagen. Dies gilt auch für Regelungen der EU (z. B. das Vorsorgeprinzip, das Verursacherprinzip oder die sogenannte 20-20-20-EU-Direktive,24 nach der bis 2020 der Treibhausgasausstoß und der Energieverbrauch jeweils um 20 % reduziert und 20 % unseres Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden sollen).
Der Ruf nach grundlegender Neugestaltung der schulischen und universitären Ausbildung ging maßgeblich von der UNESCO aus, indem sie den berühmten französischen Soziologen Edgar Morin um eine Studie bat,6 in der er die Berücksichtigung der folgenden sieben fundamentalen Bildungsprinzipien fordert: 1) die Blindheiten der Erkenntnis: Irrtum und Illusionen aufdecken; 2) Prinzipien einer umfassenden Erkenntnis suchen; 3) die Grundbedingungen des Menschen lehren; 4) die irdische Identität lehren; 5) lehren, sich den Ungewissheiten zu stellen; 6) Verständnis lehren und 7) die Ethik der menschlichen Gattung bedenken. Punkt 1 bedeutet, im Hinblick auf die Chemie, das Gedächtnis für die großen Irrtümer zu schärfen, die Punkte 3 und 4 zielen darauf ab, Bewusstsein und Wissen der Studierenden über die aktuellen Notlagen der/des Menschen in der Welt zu vertiefen.
Dies ist die eine Seite, der Blick auf die Gegebenheiten in der Welt. Doch auch unsere eigenen Positionen als Chemiker und Wissenschaftler müssen angesprochen werden, die Bedingungen, unter denen wir arbeiten, wie Universitäten und ihre Mitglieder Wissenschaft lehren und praktizieren, wodurch sie (wir) motiviert werden, wie sie (wir) ihre (unsere) Handlungen verstehen und was sie (wir) damit beabsichtigen. Dies hängt zum großen Teil von unseren allgemeinen und individuellen Prägungen durch unsere Erziehung ab, von dem Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, vom spezifischen kulturellen Kontext, in dem wir lebten und leben, und von vielen weiteren, mitunter unbekannten oder unbewussten Triebkräften. Zum Erkennen der eigenen individuellen Gründe für (un)ethisches Verhalten ist dies wesentlich.
3.2. Nachhaltigkeit, die Fähigkeit zur Wahrnehmung von Wirklichkeit: ein praktischer Kurs
Nach einem Protokoll von J. McGregor und J. Wetmore25 umfasst ein solcher Kurs vier Unterrichtseinheiten im Abstand von jeweils zwei Wochen. Das Projekt hat zwei Ziele: Zum einen dient es als Modellstudie, um Wege zum Einbringen ethischer Fragen in die tägliche Laborarbeit zu finden und zu verbessern, zum anderen sollen die Teilnehmer ermutigt werden, Wissenschaft aus einer anderen als der ihnen gewohnten Perspektive zu betrachten. Des Weiteren kann die Form der Diskussion im Sinne der Diskursethik von Habermas26 dazu beitragen, allgemeingültige Werte und Regeln zu finden.
Die erste Einheit beginnt mit der Frage “Warum bist Du Wissenschaftler geworden?”. Jeder Teilnehmer hat fünf bis zehn Minuten Zeit, über seine Beweggründe nachzudenken, und präsentiert sie anschließend. Weitere Fragen wie “Was erwartet die Gesellschaft als Geldgeber von Dir, dass Du mit diesem Geld tust?”, “Stimmt das mit Deinen Idealen überein?” können gestellt werden, um die Teilnehmer anzuregen, ihre Gedanken zu verteidigen, zu erklären oder zu hinterfragen. Diese erste Sitzung soll den Teilnehmern, die üblicherweise keine Erfahrung in Fragen der Ethik oder der Sozialwissenschaften haben, ein Gefühl für nichtnaturwissenschaftliche Probleme geben.
Die zweite Einheit beginnt mit der Frage “Wie beeinflusst Wissenschaft die Gesellschaft?”. Die Teilnehmer erwähnen in der Regel einige positive und negative Einflüsse, meist technische Errungenschaften. Es ist bemerkenswert, dass die Teilnehmer ohne äußeren Einfluss zwei Hauptblickwinkel entwickeln, die allgemein bekannt sind, nämlich technologischen Determinismus27 und Sozialkonstruktivismus.28 Viele Teilnehmer sind der Meinung, dass Wissenschaftler – zumindest in der Grundlagenforschung – für den Gebrauch oder Missbrauch ihrer Forschungsbefunde nicht verantwortlich seien. Die zweite Frage in dieser Sitzung “Wie beeinflusst die Gesellschaft die Wissenschaft?” ist schwieriger, illustriert aber mit der Vielfältigkeit der Antworten die starke Verbindung zwischen beiden Perspektiven.
Die dritte Einheit sollte sich auf die Arbeit der Teilnehmer beziehen. Als Beispiel sei die Diskussion über die Auswirkungen von Forschung an biomimetischen Systemen und ihr Anwendungspotenzial genannt, mit Fragen wie “Siehst Du einen Bedarf an mehr Regulation?”, “Fühlst Du Dich sicher bei dem, was Du tust?”. So bestand in einer Sitzung der Konsens, dass es unmöglich sei, Auswirkungen von Forschung vorherzusehen, und dass nur Regelungen getroffen werden können, nachdem sich die Dinge entwickelt haben. Die bloße Erwähnung des Vorsorgeprinzips führte zu lautem Protest.
In der letzten Einheit arbeiten die Teilnehmer in Zweier- oder Dreiergruppen jeweils an einer eigenen Aufgabe, zum Beispiel dem Verfassen eines Briefes an eine Expertenkommission mit der Frage, wie das Auftreten einer Hautirritation nach versehentlichem Verschütten einer Suspension, möglicherweise ein medizinisch unbekanntes Phänomen, zu untersuchen und zu bewerten sei. Diese Sitzung verläuft in der Regel äußerst kontrovers, da die Teilnehmer erneut jegliche Verantwortung für die Auswirkungen ihrer Forschung ablehnen.
Nach dem letzten Treffen wird ein Bogen mit Fragen zur Bedeutung der behandelten Themen für die Arbeit der Teilnehmer ausgeteilt, wobei auch nach Verbesserungsvorschlägen gefragt wird. Einige Teilnehmer sehen überhaupt keinen Wert für ihre tägliche Arbeit, andere finden die Denkanstöße und Wege belebend, Wissenschaft aus anderen Blickwinkeln als den üblichen zu betrachten.
Das Projekt ist bisher ein voller Erfolg: Für die Teilnehmer, die lernen, über Chemie ohne Erwähnung von Molekülen zu sprechen, und für das Konzept selbst, das damit für künftige Kurse verbessert werden kann. So ergab sich zum Beispiel, dass “amerikanische” und “deutsche” Antworten sehr verschieden sein können. Die gesamte bisherige Erfahrung mit diesen Kursen spricht für die unbedingte Einbeziehung ethischer und sozialer Aspekte in naturwissenschaftliche Lehrpläne, denn ein Hauptgrund, warum Wissenschaftler ethischen Herausforderungen aus dem Weg gehen und das Vorsorgeprinzip kategorisch ablehnen, ist ihre geringe Kenntnis entsprechender Konzepte.
3.3. Von der Universität ins Berufsleben: Herausforderungen annehmen
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Universitätsstudiums ist es ein erhebendes Gefühl, die Bachelor-, Master- oder Doktorurkunde entgegenzunehmen. Der weitere Berufsweg in Universität, Industrie, Behörde oder Gewerbe steht bevor. Eine gute Entscheidungshilfe ist dabei die sorgfältige Analyse des Arbeitsmarktes. Die im Studium erworbenen Fähigkeiten sind nun mit den Anforderungen und Erwartungen der Gesellschaft und besonders mit denen des spezifischen Arbeitgebers29 abzustimmen. Auch erwartet die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, dass die Investition in die Vermittlung von Wissen und Bildung zur ökonomischen und kulturellen Entwicklung der Gemeinschaft beiträgt und so als Wert zurückfließt.
Firmen und Institutionen sind bei Stellenbesetzungen stets darauf bedacht, Personen anzusprechen und einzustellen, die den Anforderungen der ausgeschriebenen Positionen möglichst genau entsprechen. Zwar ist eine Einarbeitung in das spezielle Betätigungsfeld unerlässlich, doch sollte sie kurz und damit kostengünstig sein. Unterschiedliche, durchaus auch gegensätzliche Interessen können in solchen Situationen auftreten. Industrielle und berufliche Interessenvertretungen haben Standards festgelegt, mit denen ethisches Verhalten beider beteiligter Seiten sichergestellt werden soll. So muss die Beschreibung der Anforderungen der Position klar und wahrheitsgetreu sein, und anderseits müssen Fähigkeiten und Leistungsbereitschaft des Bewerbers aufrichtig dargestellt werden. Beide Seiten profitieren von klar festgelegten Rahmenbedingungen, wie sie oft von den betreffenden Berufsverbänden und Interessenvertretungen vorgeschlagen werden. Damit entsteht ein Klima wechselseitigen Respekts unter Wahrung des Selbstwertes.
Unternehmen und Organisationen, die sich an solche Leitlinien halten, können jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern faire Bedingungen unter Aufrechterhaltung oder gar Steigerung ihres Gewinns bieten. Dies ist mehr als Qualitätsmanagement! Bewerber können ihre soziale Verantwortung und Bereitschaft zur Sicherung des gemeinsamen Ertrags durch profunde Leistung zeigen. Wenn moralische Bedenken oder Gewissenskonflikte auftreten, sollten diese respektvoll und wohlwollend mit der Kollegenschaft besprochen werden, um sie einer Lösung zuzuführen. Falls dies nicht möglich scheint, ist eine einvernehmliche Trennung ohne Verunglimpfung des Gegenübers das Beste. Die persönliche Integrität aller Beteiligten und die legitimen Interessen eines Unternehmens oder einer Institution sind dabei auf jeden Fall zu wahren.
Warum ist ethisches Verhalten gerade in chemischen Belangen so wichtig? Das geringe chemische Fachwissen in der Gesellschaft erfordert, dass die moralische Verantwortungsbereitschaft der in den Unternehmen tätigen Personen deutlich wird. Es gibt Situationen, in denen Chemiker als Einzelpersonen Entscheidungen treffen müssen, die unter chemischen Gesichtspunkten zwingend sind und nicht durch demokratische Abstimmung oder hierarchische Anordnung herbeigeführt werden können.
Damit sich die Berufsgruppe der Chemiker, die Chemie als Berufsbild und die chemische Industrie gedeihlich entwickeln können, sind respektvolles Agieren und gegenseitiges Verständnis grundlegend erforderlich. Um das zu erreichen, ist es essenziell, dem schwierigen Vorgang des Einstellens und Eingestelltwerdens besondere Beachtung zu schenken. Wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, erfordert ein dauerhaft erfolgreiches Agieren von Industrieunternehmen Teams, die dieses ethische Verhalten akzeptieren und beherrschen.
3.4. Ethik in Angelegenheiten der chemischen Industrie
Im vergangenen Jahrzehnt haben Finanzskandale in der Industrie – wie bei Enron in den USA oder Parmalat in Italien – oder im Sport, wie auch Vetternwirtschaft in manchen Bereichen der Politik zu wachsendem öffentlichem Skeptizismus gegenüber etablierten Autoritäten geführt. Zugleich wuchs der Wunsch der Bürger nach Werten wie Transparenz und Wahrhaftigkeit.30 Die hohe Bedeutung moralischer Werte in jedem Aspekt des täglichen Lebens, auch im Geschäft der chemischen Industrie, ist damit offensichtlich.
Vor der industriellen Revolution betraf Ethik im Wesentlichen den Wirkungsrahmen der öffentlichen Moral. Später fügten fortschreitende Wissenschaft und Technik sowie gesellschaftliche Entwicklungen neue Dimensionen hinzu. Ethisches Handeln manifestiert sich heutzutage in Tugenden wie Verantwortlichkeit, Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Fairness im Umgang mit anderen, Ehrlichkeit, Handlungstransparenz, Respekt vor den Rechten und der Privatsphäre anderer, Fürsorge für Abhängige. Und in der Industrie zählen weitere Werte wie die Sicherung des Wohlbefindens der Angestellten, die Beachtung legitimer Interessen von Zulieferern, Kunden und der sozialen Gemeinschaft oder der Schutz der Umwelt.
Forschung und Entwicklung mit den ihnen eigenen ethischen Anforderungen sind besonders wichtige Bereiche der chemischen Industrie, da sie starke Auswirkungen auf die Zukunft von Unternehmen und Gesellschaften haben. Da gerade der Industriesektor Chemie von hohen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken und von potenziell starken Wirkungen von Emissionen und Abfall auf die Umwelt geprägt ist, auch von Firmenfusionen und -sanierungen, ist hier hohes Bewusstsein für ethische Werte vonnöten. Dies gilt besonders für Umbruchphasen, in denen die Beschäftigten beträchtlichen Unsicherheiten ausgesetzt sind. In solchen Zeiten ist Transparenz in der Kommunikation nach innen wie nach außen von größter Wichtigkeit.
Viele Firmen haben Regeln und Maßnahmen konzipiert, um ethisches Verhalten zu fördern, wie Geschäftsregeln, Grundsätze zur Geschäftsethik, Beschaffungsleitlinien, Grundsatzerklärungen zur Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter sowie zum Umweltschutz, Bevollmächtigungsregeln, Schutz der Privatsphäre von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Kunden, ethische Richtlinien für externe Beziehungen einschließlich derer mit Behörden, Qualitätssicherung, Anerkennung und Schutz von geistigem Eigentum. Die meisten Unternehmen versuchen, eine Kultur der Ethik aufzubauen, allerdings sind nicht alle erfolgreich. Dazu sind Beschäftigte und Vorgesetzte notwendig, die verstehen, warum eine solche Kultur für die langfristige Lebensfähigkeit eines Unternehmens unerlässlich ist. Betriebsstrukturen haben, wie Menschen, viele Dimensionen; sie müssen entwickelt werden, um erfolgreich zu sein und zu bleiben.
Einige Schlüsselattribute eines auf Rechtschaffenheit basierenden Industrieunternehmens sind folgende: 1) Sinn der Beschäftigten für Verantwortung und die Berechenbarkeit ihrer Handlungen und der Handlungen anderer, 2) Beschäftigte können alle Themen und Anliegen ohne Angst vor Vergeltung zur Sprache bringen, 3) Vorgesetzte gehen in ihrem Verhalten mit gutem Beispiel voran, 4) Führungskräfte kommunizieren die Wichtigkeit von Loyalität bei schwierigen Entscheidungen, und 5) sie sind sich der Situationen mit hohem Potenzial zu unethischem Verhalten bewusst; außerdem gibt es – sollte ein solcher Fall eintreten – Methoden, ethische Probleme zu identifizieren und zu lösen.
Wie ethische Prinzipien umgesetzt werden können, soll am Beispiel der Sanierung von kontaminierten Böden und Grundwässern unter einem Industriegebiet verdeutlicht werden.31 Alle Beteiligten lernten dabei, mit den Beziehungen und Interessengegensätzen der auf demselben Gelände angesiedelten Betriebe umzugehen und mit Behörden und Öffentlichkeit nach Lösungen zu suchen. Dabei entstanden Firmenausgründungen mit neuen Betätigungsfeldern, neuen wissenschaftlichen und technischen Ansätzen. Natürlich waren die Verhandlungen zwischen den betroffenen Firmen, mit der Kommunalverwaltung und mit anderen Interessenvertretern und Meinungsträgern wie Zeitungen, Gewerkschaften, Arbeitern und Umweltparteien nicht ohne Konflikte. Zahlreiche Debatten und Diskussionen über Prioritätensetzungen bezüglich Sanierung gegenüber industrieller Entwicklung und über die Auslegung von Gesetzen mussten geführt werden. Schließlich wurden Lösungen durch folgende Vorgehensweise gefunden:
- 1)
Verpflichtung, praktikable Lösungsansätze pro-aktiv zu unterbreiten, die über die bloße Anwendung bestehender Gesetze hinausgehen,
- 2)
Ausarbeitung und Durchführung eines regionalen Gesamtplans, um Konflikte zu mildern und eine Fortsetzung der gewerblichen Aktivitäten zu sichern,
- 3)
Schaffung eines Klimas des Vertrauens unter allen beteiligten Parteien,
- 4)
Förderung von Transparenz im gesamten Prozess durch Einrichtung eines Masterkurses in Zusammenarbeit mit der regionalen Universität (Ferrara).
Schließlich wurde das gesamte Grundwassersanierungs-Projekt als gemeinsame Initiative aller Betriebe durchgeführt, unter Nominierung eines einzigen Projektleiters und Repräsentanz der gesamten Gruppe gegenüber Behörden durch eine Firma.
Die Unternehmen lernten dabei, dass 1) industrielle Weiterentwicklung von der Verfügbarkeit von Ausweichflächen abhängt, 2) Sanierungen ebenso hohe Priorität haben wie gewerbliche Investitionsprojekte und 3) industrielle Entwicklungspläne mit Sanierungsprogrammen in Einklang gebracht werden müssen. Die Öffentlichkeit und die Behörden lernten, dass 1) Geländesanierung am besten durch fortdauernde gewerbliche Aktivitäten gesichert werden kann und 2) neue Projekte auf dem Gelände die Chancen für eine schnelle Sanierung verbessern.
Überzogenes Streben nach maximaler kurzfristiger Profitabilität, grenzenloser Ehrgeiz von Spitzenmanagern und mangelnde Moral beaufsichtigender Dienststellen, all dies schädigt das Gemeinwohl und bremst die soziale und wirtschaftliche Entwicklung.32 Sicherung des Gemeinwohls erfordert von jedem Teilnehmer – auch in der Industrie – die Beachtung gemeinsamer Werte wie Solidarität, Ernsthaftigkeit, Hingabe, Arbeitsmoral sowie Austausch von Erfahrung und Wissen durch kontinuierliche Ausbildung.33
Manchmal mangelt es an Kapital, an Fachpersonal oder an Ideen, aber viel öfter an Glaubwürdigkeit und Vertrauen unter den Parteien! Vertrauen ist eine maßgebliche Voraussetzung des Erfolgs in vielen Tätigkeiten – doch Vertrauen muss freiwillig gegeben werden. Ethisches Verhalten dank Vertrauen und Glaubwürdigkeit trägt dazu bei, Kosten zu senken, Risiken zu verringern und wirtschaftliche Unternehmungen ertragreicher werden zu lassen.
3.5. Angewandte Ethik: eine nachhaltige Perspektive für junge Akademiker im Kongo
Ein weiterer Testfall ist, ob wir bereit sind, unseren Teil an Verantwortung für die Lage der Welt wie sie ist zu akzeptieren, eingedenk der Tatsache, dass der Kolonialismus, durch Verschärfung und unter Ausnutzung der in den jeweiligen Regionen schon vorhandenen sozialen Schwächen und Ungerechtigkeiten, zur heutigen Realität vieler armer Gegenden der Welt beigetragen hat. Dafür wurde auch schon früher plädiert34 – nun sollten praktische Schritte folgen.
Die meisten Universitäten im tropischen Afrika sind mit gravierenden Problemen konfrontiert, wie geringen finanziellen Mitteln, unzureichenden Infrastrukturen, hohen Zahlen an Studierenden, armseligen Forschungsbedingungen und ineffektiven Verwaltungen. Dennoch gibt es auch dort viele kompetente Lehrer ihres Fachs. Die schwierigen Forschungs- und Lehrbedingungen motivieren aber die jungen Studierenden nicht, eine akademische Karriere in Betracht zu ziehen. Die Lehre basiert im Wesentlichen auf Ergebnissen, die anderswo erarbeitet wurden, und es ist – bedingt durch den Mangel an finanziellen Mitteln und das Versickern internationaler Subventionen im Korruptionssumpf – mehr als schwierig, eine ernstzunehmende und sichtbare Forschungstradition aufzubauen. Der Ernst der Lage wird durch massive Abwanderung von qualifizierten Forschern eher größer. Um junge, vielversprechende Akademiker in diesen Ländern zu halten, müssen Exzellenzinseln geschaffen werden. Einer neuen Generation motivierter junger Menschen, die in der Lage sind, zur sozialen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Heimatländer beizutragen, soll ein Zuhause sowie der Mut und die Fähigkeit zur Teilnahme am gerechten Wettbewerb gegeben werden.
Die Ausbildung im Sekundarbereich der Schulen und an den Universitäten sowie die Forschung wurden von Regierungen und Geldgebern lange zugunsten der Grundausbildung der Menschen zu Arbeitern und Konsumenten vernachlässigt.35 Der Förderung von kritischen Denkern und Forschern einen gleichen Stellenwert einzuräumen ist deutlich teurer und erfordert größere Umsicht. Hohe intellektuelle Fähigkeiten basieren zweifellos auf einer soliden Bildung. Diese sollte unbedingt in der Verantwortung verlässlicher Kollegen aus den betreffenden Ländern liegen, da sie mit den Gewohnheiten, Sitten, kulturellen und persönlichen Hintergründen vertraut sind. In Sandwichmodellen dagegen können die Studierenden in Master- und Graduiertenprogrammen vom Reichtum des Nordens und dessen Kompetenz in Form von Doppeldiplomen profitieren. Gemeinsame Vorschriften für Abschlussarbeiten aufzustellen ist aufwendig, trägt aber dazu bei, dass Kompetenzen ausgetauscht, die Selbstversorgung gestärkt, bilaterale und multidisziplinäre Projekte begonnen und Netzwerke aufgebaut werden können.
Ein solches Projekt wird von zweien von uns (G.B., K.N.I.) im Kongo gemeinsam mit V. Mudogo und seinen Kollegen verfolgt, ein Partnerschaftsprogramm zwischen der Universität Würzburg und der Universität Kinshasa (UNIKIN), ehemals Léopoldville. Die UNIKIN wurde 1954 gegründet und war eine der führenden Universitäten im tropischen Afrika. Menschen aus vielen Ländern, sogar aus Europa, kamen, um in “KIN la Belle” (schönes Kinshasa) zu studieren.36 Doch in den letzten Jahrzehnten hat die UNIKIN enorm unter den schwierigen politischen Umständen gelitten. Heute sind die Gebäude, die Instrumente und die Bibliothek in einem kritischen Zustand. Die soziale und wirtschaftliche Lage des akademischen Personals erschwert Forschung und Lehre. Noch schlimmer für die Absolventen ist der Mangel an Möglichkeiten für akademische und andere berufliche Karrieren. All dies bildet einen Teufelskreis – für kluge, kreative Köpfe in einem Land so reich an fruchtbaren Böden, Mineralien und Biodiversität.
Herz des Projekts ist das Exzellenz-Stipendiensystem BEBUC, das von mehr als zwanzig privaten Paten aus Europa, den USA und Afrika unterstützt wird. Es zielt auf wahre Nachhaltigkeit ab. Die Sponsoren sind zugleich Partner und Berater der Studierenden, und sie sollen ihnen so auch die Rückkehr nach Kinshasa nach einem Studienaufenthalt im Ausland erleichtern. Eingeführt im Jahr 2008 ist das Projekt dazu gedacht, herausragende Studierende zu identifizieren und ihnen zu helfen, zunächst im Kongo mit Tiefgang und zügig zu studieren, dann für Master-Studien und/oder Doktorarbeiten ins Ausland zu gehen, um danach als Professoren und Führungskräfte von morgen in den Kongo zurückzukehren.
Der erste Baustein umfasst die Unterstützung von Bachelor-Studenten, ausgesucht in einem kompetitiven, aber transparenten und fairen Auswahlverfahren, mit Kurzvorträgen und Prüfung durch eine internationale Jury. Zur Pilotphase I wurden zunächst nur Studierende der Chemie und Pharmazie zugelassen, von denen vier herausragende Kandidaten ausgewählt wurden. Sie erhielten ihre Stipendienurkunden in einer feierlichen Zeremonie in Anwesenheit des gesamten Präsidiums der UNIKIN, des Kultusministers, des Vertreters der deutschen Botschaft und des Bürgermeisters von Kinshasa. Zugleich erhielten sie den Status von Gaststudenten an der Universität Würzburg, mit freiem Zugang zur elektronischen Bibliothek. Am Ende dieser Phase wurden die Studierenden erneut geprüft (diesmal in Englisch, nicht in ihrer “Muttersprache” Französisch); aufgrund hervorragender Studienergebnisse wurden alle Stipendien verlängert (ein typischer Probevortrag einer Kandidatin, mit Tafel und Kreide, ist in Abbildung 1 zu sehen).
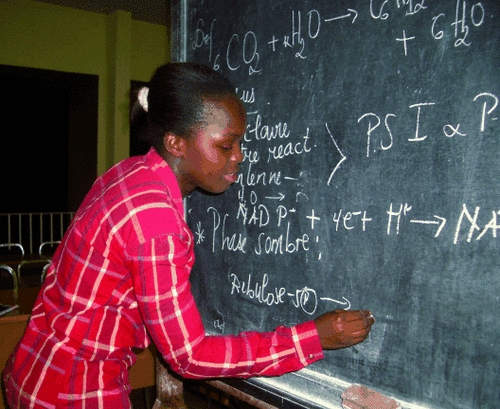
Eine Kandidatin, hier eine Studentin der Biologie, während ihres zehnminütigen Vortrags.
Ab April 2009 (Pilotphase II) wurden 10 Stipendiaten unterstützt, ab August 2009 (Pilotphase IIb) 16 Stipendiaten, und 2010 (Phase III) konnte das System dank der zusätzlichen Unterstützung durch die private Kröner-Stiftung auf alle Fächer ausgeweitet werden; derzeit werden mehr als 30 Studierende gefördert. Außerdem profitieren die Stipendiaten nun von einer besseren Infrastruktur – mit Tutoren, einer Sekretärin und ihrem Büro sowie einem großen Seminarraum mit Computern und weiterer Ausstattung.
Der zweite Baustein von BEBUC ist das Master-Studienprogramm, vorzugsweise an einer anderen afrikanischen Universität, damit die Studierenden lernen, Probleme im afrikanischen Kontext zu lösen, was zudem ihre afrikanische Identität stärkt.
Der dritte Baustein soll den Studierenden die Promotion an exzellenten ausländischen Universitäten ermöglichen, möglichst wieder in Austauschprogrammen (Sandwichverfahren). Nach langen Jahren der Unterrepräsentation kongolesischer Doktoranden wird es Zeit, dass auch andere Organisationen wieder Bewerbungen von herausragenden Kandidaten aus dem Kongo bekommen.
Der vierte – entscheidende – Baustein ist die Förderung der Rückkehr an kongolesische Universitäten. Harte Arbeit wird nötig sein, um akzeptable Bedingungen zu schaffen und jungen Wissenschaftlern bei der Rückkehr in ihr Heimatland zu helfen. Im ersten Schritt wird zurzeit eine junge Pharmazeutin unterstützt, die über Pflanzen mit Aktivität gegen Helminthen (Würmer) forscht, gefördert mit Mitteln des TDR-Sonderprogramms für Forschung und Schulung an Tropenkrankheiten der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Nach den vielversprechenden Ergebnissen in Kinshasa wurde das Stipendiensystem vor kurzem auf die Université Catholique du Graben (UCG) in Butembo im Ostkongo erweitert, wo 2010 die Pilotphase I mit zwei herausragenden Medizinstudenten begonnen hat. Die UCG, anders als die UNIKIN, ist eine kleine, private, junge Universität mit rund 1300 Studierenden und einem begrenzten Fächerangebot. Das Ziel ist es, Erfahrung mit zwei so unterschiedlichen Institutionen zu sammeln und das BEBUC-System zu optimieren, bevor es auf weitere Universitäten ausgedehnt wird.
Wir sind der festen Überzeugung, dass dieses System als Modell für die Wiedereinführung von Exzellenz auch in anderen afrikanischen Ländern dienen kann, natürlich unter Berücksichtigung der regionalen Umstände und Unterschiede.
4. Zusammenfassung
Dies sind nur einige Beispiele, wie Verantwortlichkeit in den (chemischen) Wissenschaften in Bildung und fachlicher Praxis umgesetzt werden kann; viele andere sind denkbar. Moralische Werte unterliegen steter Veränderung, abhängig von dem philosophischen Hintergrund und den populären Vorstellungen der Zeit, den gesellschaftlichen und politischen Bedingungen, dem Land und seiner Wirtschaft, seinem Klima und seinen geophysikalischen Gegebenheiten, dem Wohlstand und dem Einfluss sozialer Gruppen, der individuellen Erziehung und sogar den Idiosynkrasien einflussreicher Individuen. Doch jenseits dieser stark variablen Folgen sozialer und individueller Tugenden und Eigenschaften gibt es eine tiefsitzende Sehnsucht nach friedlicher und zugleich freigeborener Entfaltung des Individuums in einer wohlwollenden Gesellschaft, im fairen Geben und Nehmen. Wie Bertrand Russell vor mehr als einem halben Jahrhundert ausdrückte,37 verleihen Wissenschaft und Technik dem Menschen die Macht, von der Umwelt zunehmend unabhängiger zu werden, allerdings unter tendenzieller Zurückdrängung von Individualität, da Wissenschaft und Technik gut organisierte Strukturen erfordern. Daher betrachtete Russell wissenschaftlich und technisch geprägte Philosophien als Philosophien der Macht, in denen Ziele und Absichten oft vergessen würden. Sein Vorschlag als Gegenmittel war die Schaffung einer neuen Philosophie unter Kombination der Solidität des Römischen Reichs und des geistigen Idealismus Augustinischer oder Franziskanischer Theokratie. Andere Weltregionen und Kulturen mögen unterschiedliche, aber äquivalente Lösungen finden.
Es ist vorhersehbar, dass es starke Abneigungen und Ängste auf dem Weg zu einem globalen menschlichen Gemeinwesen auf höherem Niveau zu überwinden gilt, und dies nicht nur bei der “goldenen Milliarde”. Doch Länder und Gesellschaften, die dies nicht auf sich nehmen und die zutiefst demokratische Vision einer Entwicklung hin zu einer ethisch-spirituellen Kultur nicht vorantreiben, werden rückständig bleiben. Ähnlich wie im Fall der Bewegung hin zu einem besseren ökologischen Verständnis, wie es vor einem halben Jahrhundert von Rachel Carson38 und anderen angestoßen wurde, werden Länder und Gesellschaften, die diese Herausforderung annehmen und sich mit den Bedürfnissen und Voraussetzungen humaner und wertebewusster Praxis von Wissenschaft und Technik auseinandersetzen, ökonomisch und kulturell voranschreiten, selbst wenn es, wie zu Beginn des wachsenden Umweltbewusstseins in den 1970er Jahren, anfangs große Widerstände gäbe und die Unmöglichkeit der Durchführung aufgrund immenser Kosten behauptet würde. Diejenigen, die früh anfangen, Bildungsprogramme mit dem Ziel, eine gerechtere menschliche Gesellschaft zu schaffen, in die Tat umzusetzen, werden gedeihen und eine neue Phase wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwungs erreichen, wie vom Wirtschaftswissenschaftler Leo Nefiodow39 vorausgesagt (Abbildung 2); diejenigen, die dies nicht tun, werden unterentwickelt bleiben. Ziel ist es, das, was zu Recht als angewandte Hoffnung40 bezeichnet wird, in den Universitäten und allen Bildungsinstitutionen zu verbreiten. Dank Weltraumforschung und Technik ist augenfällig geworden, dass wir alle im selben Boot sitzen – das sollte Grund genug sein, den nötigen gesunden Menschenverstand wachzurufen, um Schiffbruch zu vermeiden.
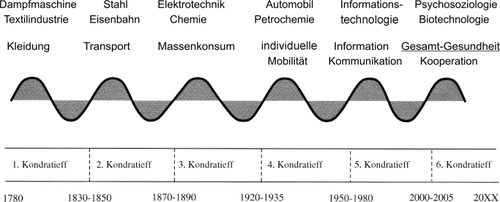
Haupttriebkräfte der Technik und abgeleiteter sozialer Gewinn der vergangenen und künftigen Kondratieff-Zyklen (mit Erlaubnis des Autors39 modifiziert).
Acknowledgements
All denen, die an der Organisation zahlreicher Cheesefondue-Workshops und den Foren zu “Ethics and Science for the Environment” (ESforE) mitgewirkt haben, die geholfen haben, die hier präsentierten Ideen und Einsichten zu diskutieren und zu verfeinern, gebührt Dank – dem Philosophen Maik Hosang (Bautzen, Deutschland), dem Franziskanerpater Nelson Junges (Porto Alegre, Brasilien), den Unternehmern Marion Schneider (Bad Sulza, Deutschland) und Louis Arnoux (Toulon, Frankreich), den Wirtschaftswissenschaftlern Leo Nefiodow (St. Augustin, Deutschland) und Patrizio Bianchi (Ferrara, Italien), den Chemie-Kollegen Zdzislaw Chilmonczyk (Warschau, Polen), Carl Djerassi (Stanford, USA), Richard Ernst (Zürich, Schweiz), Günther Bonn (Innsbruck, Österreich), Boguslaw Buszewski (Torún, Polen) und vielen weiteren. Besonderer Dank gilt Gianna Borghesani und Salvatore Mazzullo (ehemals Lyondell-Basell Ferrara), die mit großer Hingabe die ESforE-Foren vorangetrieben und ihre Bedeutung für die chemische Industrie betont haben. Dank gilt auch Prof. V. Mudogo, Mitbegründer des Kinshasa-Programms, und den Mitgliedern des BEBUC-Stipendienauswahlgremiums, insbesondere den Professoren D. Kalenda, J. Ndelo und M. Bokolo, den Mitgliedern des Fördervereins Uni Kinshasa e.V. und den großzügigen Paten, die die Stipendien aus eigener Tasche finanzieren, der Else-Kröner-Fresenius-Stiftung und der WHO/TDR. Des Weiteren danken wir der Universität Würzburg für die andauernde Unterstützung und den Glauben an das Kongo-Projekt. Zu guter Letzt danken wir den beiden anonymen Gutachtern für ihre Vorschläge und Hinweise.
Biographical Information
Hartmut Frank studierte in Marburg und Tübingen Chemie und promovierte 1973. Nach zwei Jahren als Postdoc am Baylor College of Medicine in Houston synthetisierte er in Tübingen die erste polymere enantioselektive Phase für die Gaschromatographie. Aus dieser Zeit stammt sein Interesse an Dualität. Nach der Habilitation in Analytischer Chemie und Toxikologie befasste er sich von 1993 bis 2008, dem Jahr seiner Pensionierung, in Bayreuth mit Umweltchemie und Ökotoxikologie. Sein größer werdendes Interesse am “Wozu” brachte ihn – zusammen mit einer internationalen Gruppe von Freunden und Kollegen — zur Organisation von Cheesefondue-Workshops und Foren über Ethik und Naturwissenschaften.
Biographical Information
Gerhard Bringmann studierte Chemie und Biologie in Gießen und Münster. Nach seiner Promotion bei B. Franck 1978 und einem Postdoc-Aufenthalt bei D.H.R. Barton in Gif-sur-Yvette (Frankreich) habilitierte er sich 1984 in Münster. Seit 1987 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Organische Chemie der Universität Würzburg. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Naturstoffchemie. Zu seinen Auszeichnungen zählen die Adolf-Windaus-Medaille (2006), die Ehrendoktorwürde der Universität Kinshasa (2006), der Paul-J.-Scheuer-Preis (2007) und die Ehren-Gastprofessur der Peking University (2008). 2008 initiierte er ein Stipendiensystem zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Kongo.






