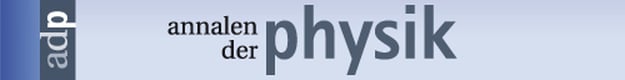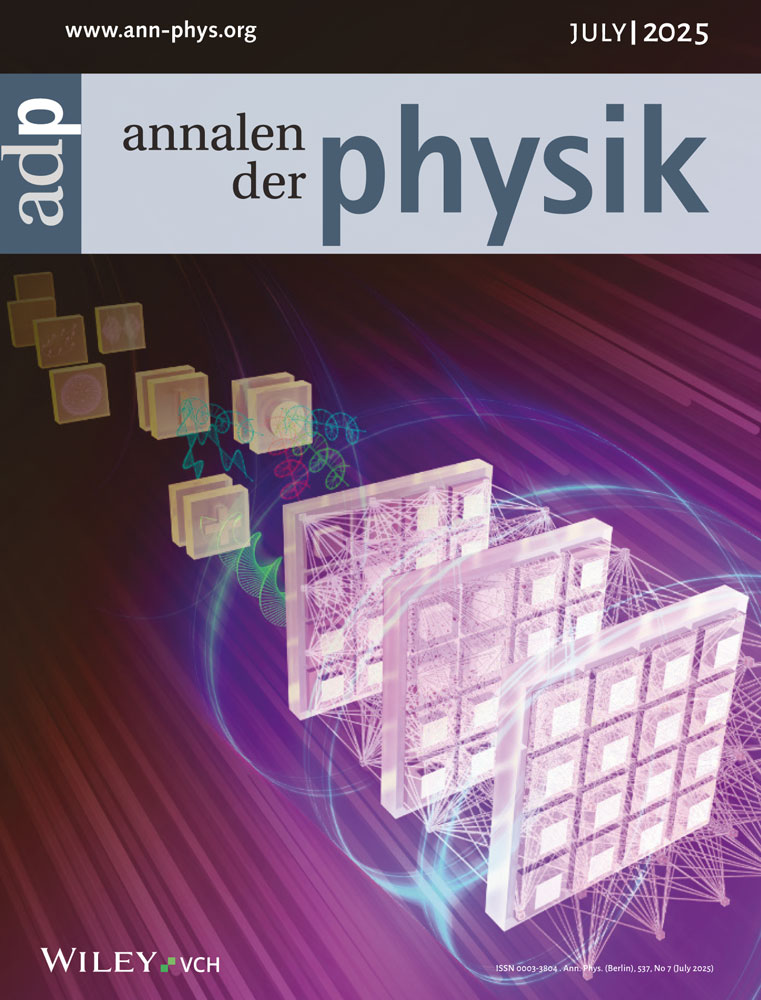Article
Full Access
Ueber die Gränzen der Magnetisirbarkeit des Eisens und des Stahles
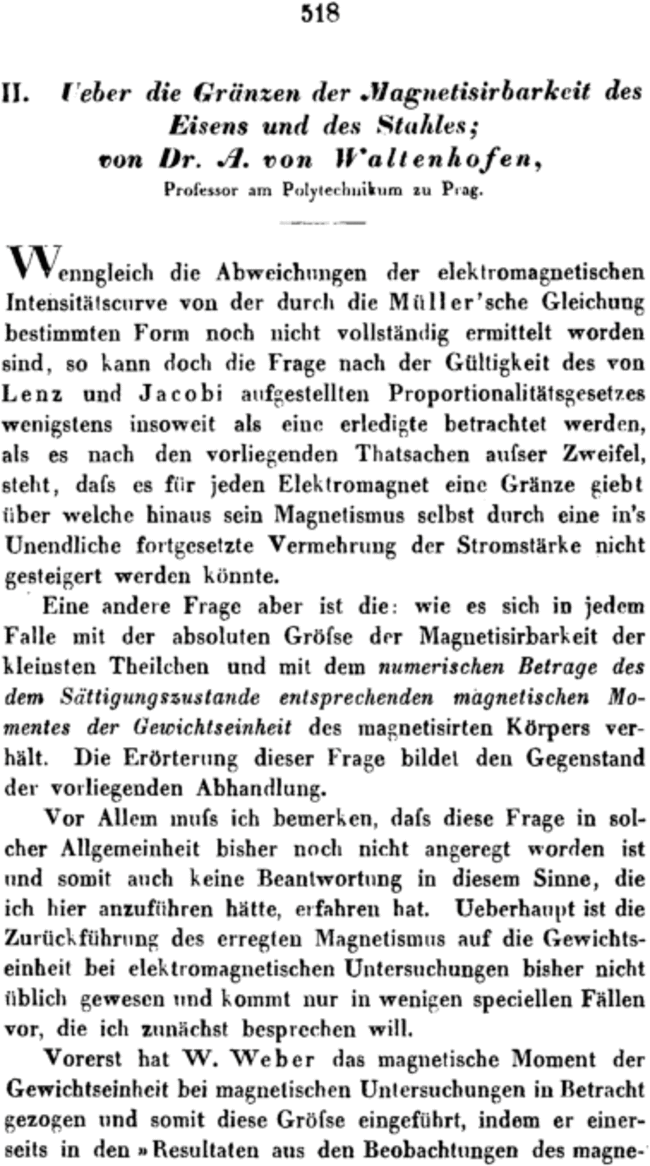
References
- p519_1) Diese wichtige Angabe, auf die ich später zurückkommen werde, findet sich in der Abhandlung: „Messung starker galvanischer Ströme”︁ usw. in der gelegentlich eingeflochteten Bemerkung, dass man bei einem sehr starken Stahlmagnet „400 Maafs Magnetimus auf 1 Milligramm Stahl rechnen kann.”︁
- p519_2) n μ = 2324,68.
- p520_1) Ich habe nämlich β durchwegs unter der Voraussetzung bestimmt, dass die Bogen in Graden, die Gewichte γ in Grammen und die Momente y in Millionen von absoluten Einheiten ausgedrückt werden. So erhält man m = 2616 für β = 0,0291.
- p521_1) Siehe meine Abhandlung „Ueber das elektromagnetische Verhalten des Stahles”︁ Abdruck aus dem 48. Bd. der Wiener Sitzungsberichte S. 25 und 26.
- p521_2) Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Bd. 48. Auch diese Annalen Jahrgang 1864.
- p521_3) Man kann diese Folgerung übrigens auch aus der Scheidungstheorie ableiten, wenn man gleichschweren Molecülen gleiche endliche Mengen der Fluida zuschreibt.
- p521_4) Diess würde nur dann der Fall seyn müssen, wenn man von der Annahme ausgehen wollte, dass die magnetische Sättigung in einer vollständigen Parallelstellung aller Molecularmagnete bestehe.
- p522_1) Diess gilt, wie gesagt, nur für den Zustand der Sattigung; denn bevor diese erreicht ist, wird die Magnetisirung im Innern des magetischen Stabes weniger vorgeschritten seyn als in der Nähe der Oberfläche und gegen die Enden zu weniger als in der Mitte.
- p522_2) Eine nicht minder interessante Aufgabe wäre die Ableitung eines Ausdrucks für die Arbeit, welche der zur Hervorbringung eines bestimmten Sättigungsgrades erforderlichen Drehung der Molekularmagnete entspricht, wobei vielleicht die Weber'sche Theorie der Molekularmagnete als Grundlage der Rechnung dienen könnte.
- p523_1) Abdruck aus dem 52. Bande der Sitzungsberichte der Wiener Akademie Seite 25 bis 27.
- p526_1) wenn derselbe nur überhaupt in der bei den beschriebenen Versuchen beobachteten Weise magnetisirt wird.
- p527_1) Und für α die Zahl 1,853; siehe die citirte Abhandlung Seite 9.
- p528_1) Das correspondirende α erheischt dann natülich auch eine entsprechende Aenderung, die jedoch für den vorliegenden Zweck nicht weiter in Betracht kommt.
- p529_1) Ich habe nämlich gezeigt, dass diess bis zu 1/4 des früher angenommenen Maximums (1679) eines gleichschweren Eisenstabes zutrifft, also nahe zu derselben runden Zahl (420) führt.
- p530_1) Diess zeigen auch schon meine Versuche mit den Stäben 1, 2, 3, 4 u. 5 in der citirten Abhandlung über die Müller'sche Formel.
- p531_1) Nämlich β = 0,01865 für Spirale I und β = 0,0291 für Spirale III, welcher mit dem für dieselbe Spirale gefundenen β = 0,0274 dem oben für diese Spirale angenommenen Mittel β = 0,282 zu Grund liegt.
- p531_2) Siehe dessen »Bericht etc.« S. 518 und meine Abhandlung über »die Müller'sche Formel, Seite 25 bis 28, wo ich die fragliche Relation ebenfalls als nicht bestätigt bezeichnete. Uebrigens ist Seite 27, 5. Zeile von unten ein Druckfehler; statt 1,47 soll es heissen 1,147.
- p532_1) Die letzte Gleichung giebt für β = 0,00778 obigen Mittelwerth b = 144, also allgemein B = 144 l.
- p533_1) Siehe meine oben citirte Abhandlung über die Müller'sche Formel.
- p533_2) Nämlich bis etwa 2/3 derselben.